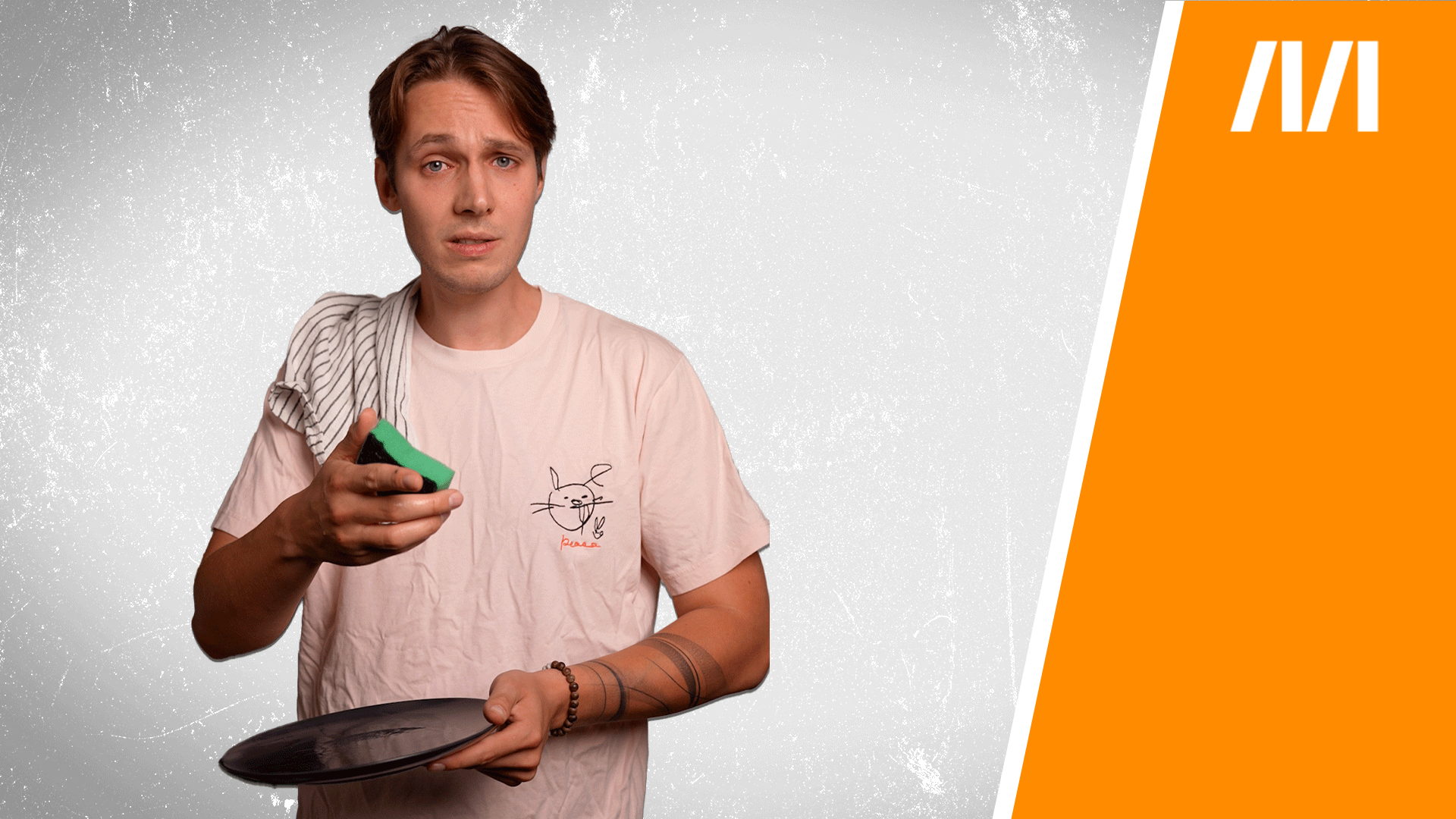Im Budget ist ein Loch: Wie es zu stopfen wäre
Ein Loch ist im Budget, liebe Leute, liebe Leute.
Ein Loch ist im Budget, liebe Leute – ein Loch!
– "Dann stopf es - liebe Regierung"
– "Ja, womit denn?"
Der Finanzminister muss ein Budget präsentieren, das vor allem eines tut: Das riesige Budgetloch stopfen. Kein Geld mehr da – angeblich. Aber wie konnte es so weit kommen? Und was tun wir dagegen? Und vor allem: Wer bezahlt es? Schauen wir uns das mal an.
1. Wie ist das Budgetloch entstanden?
Zuerst: Was bedeutet überhaupt Budgetloch? Ganz einfach: Der Staat gibt viel mehr aus, als er einnimmt. In den letzten Jahren hat Österreich enorm viel Geld ausgegeben – und gleichzeitig weniger eingenommen. Das Ergebnis: Ein Milliarden-Loch im Haushalt.
Wir erinnern uns: Kaum war die türkis-grüne Regierung im Amt, folgte ein Ausnahmezustand dem nächsten. Corona-Pandemie, dann Russlands Angriff auf die Ukraine mit Energiekrise, dazu extreme Preissteigerungen. Der Staat musste handeln. Er schnürte Hilfspakete, warf mit Geld um sich nach dem Motto „koste es, was es wolle“. Tatsächlich flossen zwischen 2020 und 2024 fast 19 Milliarden Euro an Unternehmen – Corona-Hilfen, Kurzarbeit-Unterstützung. Vieles davon war nötig, klar: Kurzarbeit etwa rettete Jobs. Aber: Nicht alle haben gleichermaßen profitiert. Große Konzerne haben teils fette Gewinne gemacht mit unseren Steuergeldern. Nicht wenige bekamen Millionen vom Staat obwohl sie höhere Profite als vor der Krise schrieben. Prominente Beispiele: René Benko oder Martin Ho – Unternehmer, die kräftig Hilfe kassierten, nur um ein paar Monate später Insolvenz anzumelden. Undurchsichtige Strukturen wie die COFAG (Covid-Finanzierungsagentur) wurden gegründet, die Milliarden verteilte, aber kaum kontrolliert wurde, Beratungsteams und parteinahe Personen verdienten gut daran. Viel Geld ist versickert – bezahlt von uns allen.
Gleichzeitig hat die Regierung freiwillig auf Einnahmen verzichtet. Steuersenkungen zur Unzeit: Unternehmen zahlen heute weniger Körperschaftsteuer auf Gewinne (statt 25% nur mehr 23%) als vor den Krisenjahren. Unternehmen wurden auch bei Lohnnebenkosten entlastet. Und die Abschaffung der kalten Progression – also die automatische Inflationsanpassung der Steuerstufen – verschafft zwar fast allen Haushalten etwas Luft, besonders aber den Besserverdienenden.
Unterm Strich fehlen dadurch dem Staat - also uns allen - jährlich einige Milliarden Euro.
Warum hat man das gemacht? Nun, die ÖVP entlastet am liebsten Unternehmen und Wohlhabende. Die Grünen stimmten zu, um ihre Projekte (wie den Klimabonus) durchzubringen. Das Resultat? Der Staatshaushalt wurde auf Dauer geschwächt. Hohe zusätzliche Ausgaben und geringere Einnahmen haben stark zum Budgetloch beigetragen.
Doch das ist nur die halbe Geschichte. Dann begann auch noch Österreichs Wirtschaft zu schwächeln. Zwei Jahre hintereinander schrumpfte die Wirtschaft – so etwas gab es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht. Die hohen Preise taten ihr Übriges: Die Leute konnten sich weniger leisten. Viele legten ihr Geld auf die Seite, statt es auszugeben, Konsumflaute! Unternehmen investierten weniger. Die Folge: Weniger Steuereinnahmen für den Staat, während die Ausgaben weiter stiegen (z.B. für Pensionen, höhere Gehälter im öffentlichen Dienst) All das riss das Loch noch größer.
Weiterhin gegönnt haben wir uns Unternehmensförderungen auf Rekord-Niveau: Vor allem jene, die jetzt am wenigsten beitragen sollen, haben kräftig abkassiert. Die türkis-grüne Regierung pumpte Milliarden in die Wirtschaft – 39 Milliarden Euro zusätzlich an Unternehmensförderungen und Subventionen - viel mehr als das aktuelle Sparpaket überhaupt einbringt.
Jetzt muss dieses Loch gestopft werden. Also wird kräftig gespart.
2. Welche Sparmaßnahmen werden gesetzt?
Die Regierung hat ein Sparpaket von rund 6,4 Milliarden Euro geschnürt, um das Budget zu sanieren. Im ersten Jahr. Kommendes Jahr sollen dann weitere 8,7 Milliarden Euro eingespart werden. Schauen wir uns die größten Brocken an:
Sparen bei Förderungen und Leistungen – 3,8 Mrd. € Einsparung Unter „Fokus statt Überförderung“ versteht die Regierung vor allem Kürzungen bei Klima, Bildung und Sozialem. Ein paar Beispiele:
- Klimabonus wird abgeschafft
Dieser Bonus – bis zu 254 Euro pro Jahr und Nase sollten die Kosten der Co2-Steuer abfedern, gerade für jene mit geringem Einkommen. Zwei Milliarden Euro hat das gekostet. Nun spart man sich das: Jede:r in Österreich verliert dadurch Geld. Ein Beispiel: Eine vierköpfige Familie bekam 2022 insgesamt etwa 800 € Klimabonus vom Staat überwiesen. Künftig: 0 €. Der CO2-Preis auf Sprit, Gas & Co. bleibt aber – zahlen müssen wir ihn trotzdem. Effekt: unterm Strich weniger Geld in den Taschen aller Haushalte. Aber: Unten schmerzt der Wegfall am meisten.
- Sozial- und Familienleistungen werden nicht mehr an die steigenden Preise angepasst
Wir haben eben erst beschlossen, dass Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld, Studienbeihilfe, Reha-Geld etc. jährlich automatisch erhöht werden, wenn alles teurer wird. Das wird nun für 2025 und 2026 ausgesetzt. Das ist faktisch eine Kürzung. Was bedeutet das konkret? Eine Familie mit zwei Kindern bekommt nächstes Jahr rund 165 Euro weniger als sie mit Inflationsanpassung bekäme, 2027 fehlen ihr schon knapp 300 Euro. Wenn das bis 2029 weitergeht, summiert sich der Verlust auf über 500 Euro. Familien mit mehr Kindern verlieren natürlich noch mehr – bei fünf Kindern sind es über 1.400 Euro weniger bis 2029. Das ist richtig viel Geld.
Diese Kürzung trifft vor allem einkommensschwache Haushalte – und sie trifft Frauen härter als Männer: Weil Frauen häufiger Kinder betreuen und Sozialleistungen beziehen. Besonders drastisch sind Alleinerziehende betroffen, denn ihr Einkommen besteht zu mehr als einem Viertel aus Sozialleistungen. Gleichzeitig ist jede dritte Alleinerziehende armutsgefährdet. Ein Sparbeitrag auf dem Rücken der Familien, der pro Jahr rund 182 Millionen Euro bringen soll.
- Bildungskarenz wird gestrichen, ersetzt durch Weiterbildungszeit.
Bisher konnten Arbeitnehmer:innen für Weiterbildung eine zeitlang aus dem Job aussteigen und erhielten Weiterbildungsgeld. Künftig soll dieses Modell durch ein neues ersetzt werden – mutmaßlich weniger großzügig. Konkrete Folge: Wer eine Ausbildung machen will, bekommt weniger Unterstützung oder strengere Auflagen. Draufzahlen tun Beschäftigte, die sich fortbilden oder z.B. nach der Elternkarenz beruflich neu durchstarten wollen. Für sie wird es schwieriger, sich diese Auszeit zu leisten.
- Gratis-Öffiticket für 18-Jährige ade
Eigentlich sollten alle zum 18. Geburtstag ein Jahr lang kostenlos das Klimaticket nutzen können – also Öffis in ganz Österreich. Das war ein Prestigeprojekt der Grünen. Jetzt wird es ersatzlos gestrichen. Viele 18-Jährige verlieren ein Stück Mobilität oder ihre Eltern hunderte Euro, wenn sie ihnen das Ticket nun kaufen müssen.
- Mehrwertsteuer-Befreiung für Photovoltaik-Anlagen wird abgeschafft
Auf Deutsch: Solaranlagen auf dem Dach werden wieder 20% teurer, weil die bisherige Steuererleichterung wegfällt. Konsequenz: Weniger Anreiz für private Haushalte, in Solarenergie zu investieren – schlecht fürs Klima und schlecht für alle, die ihre Stromrechnung durch eigene Panels senken wollten. Hier spart der Staat ein paar Millionen, aber es bremst die Energiewende aus.
Dazu kommen: Kürzungen bei Klima- und Umweltförderungen. Offenbar meint die Regierung, es wurde zu viel in Klimaschutz investiert. Wo genau gekürzt wird, ist noch offen, aber klar ist: Maßnahmen für Umwelt und Klima werden zurückgefahren. Ironisch: Während die Klimakrise immer drängender wird, spart man ausgerechnet hier. Leidtragende sind künftige Generationen – und unser Planet.
- Breitbandausbau wird gebremst
Gelder für schnelles Internet auf dem Land werden gekürzt. In manchen Regionen bedeutet das: länger warten auf vernünftiges Internet. Digitaler Rückschritt, um ein paar Millionen zu sparen. Wem nützt das? Vielleicht dem Finanzminister auf dem Papier. Wem schadet das? Schüler:innen, Betrieben und allen, die auf gute Internetverbindung angewiesen sind, vor allem außerhalb der Städte.
- Große Bahnprojekte der ÖBB werden verschoben
Neue Bahnstrecken oder Ausbauprojekte werden auf unbestimmte Zeit vertagt. Heißt: Die längst überfällige Verbesserung des Zugverkehrs kommt später oder gar nicht. Wer auf bessere Öffis hoffte – Pech gehabt. Stattdessen wird man wohl länger auf der Autobahn im Stau stehen. Auch das spart kurzfristig Geld, kostet aber langfristig Lebensqualität und Klimaschutz.
Das alles läuft unter „Überförderungen abbauen“. Man habe in manchen Dingen zu großzügig verteilt, sagt der ÖVP-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) und meint Klimabonus und die Bildungskarenz. Mit anderen Worten: Die Bevölkerung war verwöhnt, jetzt wird gestrafft. Familien, Schüler:innen, Studierende, Pendler, junge Leute, klimaengagierte Bürger – kurz: Wir alle.
Unter dem Titel „Gerechte Budgetsanierung“ sollen auch neue Einnahmen von 1,9 Mrd. Euro helfen, das Budgetloch zu stopfen. Schauen wir mal, was drin steckt:
- Energieunternehmen sollen länger blechen
Der Energiekrisenbeitrag – im Prinzip eine Übergewinnsteuer für Stromkonzerne – wird verlängert. Gut so, denn z.B. Verbund oder OMV haben in der Energiekrise exorbitant hohe Gewinne gemacht. Allein der Verbund hat seit dem Ausbruch der Energiekrise Übergewinne in Höhe von 3,8 Milliarden Euro gemacht und nur ein Bruchteil davon wurde wieder zurückgeholt. Hier schöpft der Staat einen Teil ab. Aber: Da ginge mehr.
- „Stabilitätsbeitrag“ der Banken wird erhöht
Das klingt kompliziert, heißt aber: Banken müssen vorübergehend mehr Abgaben leisten, eine Art erweiterte Bankenabgabe. Der Hintergrund: Die Banken haben durch die Zinserhöhungen der Europäische Zentralbank riesige Extra-Profite gemacht. Sie haben deutlich höhere Kreditzinsen kassiert, aber ohne die Sparzinsen entsprechend zu erhöhen. Aus dieser Zinsschere sprudeln die Gewinne. Viele EU-Länder haben deshalb neue Bankensteuern eingeführt.
Österreich macht jetzt einen kleinen Schritt in diese Richtung. Gerechnet wird mit einigen Hundert Millionen zusätzlich.
Zum Vergleich: Würde Österreich eine Bankensteuer einführen, die dem EU-Durchschnitt entspricht, kämen rund 850 Mio. € pro Jahr herein. Die jetzige Maßnahme dürfte kleiner ausfallen, aber wenigstens ein Signal: Auch Banken sollen etwas beitragen.
- Höhere Steuern auf Immobilienspekulationen
Genauer: Gewinne aus Umwidmungen von Grundstücken werden höher besteuert. Wenn also ein Bauerwartungsland plötzlich Bauland wird und der Besitzer es teuer verkauft, langt der Staat mehr zu. Das trifft Spekulanten und Immobilieninvestoren. Ein Schritt in Richtung Fairness, denn bisher konnte man solche Planungsgewinne relativ milde versteuern. Die Mehreinnahmen hier sind aber überschaubar.
- Top-Verdiener bleiben länger bei 55% Steuer
Österreich hatte 2016 eine zusätzliche Steuerstufe von 55% für Einkommen über 1 Mio. Euro eingeführt, diese aber befristet. Sie wäre demnächst ausgelaufen, das hätte Spitzen-Verdiener entlastet. Jetzt wird die 55%-Spitzensteuer um vier Jahre verlängert. Heißt: Einkommens-Millionäre müssen weiterhin diesen hohen Steuersatz auf jeden Euro über der Million zahlen. Fair enough – ein Geschenk an die Reichsten wird so verhindert, und der Staat behält pro Jahr ein paar Millionen an Einnahmen, die sonst verloren gegangen wären.
- Stiftungen zur Kasse
Reiche Familien parken ihr Vermögen gern in Privatstiftungen, weil man dort Steuern sparen kann. Die Sätze dafür werden nun erhöht. Details sind technisch, aber unterm Strich sollen wohl Stiftungen etwas mehr Steuer zahlen, was wiederum hauptsächlich Vermögende trifft. Auch das bringt einige Millionen zusätzlich.
Summa summarum: Diese neuen Einnahmen von ~1,9 Mrd. € kommen größtenteils von großen Playern – Energie, Banken, Spitzenverdiener und Extremreiche. Hier leisten zur Abwechslung mal Konzerne und Vermögende einen Anteil. Allerdings: Verglichen mit dem, was Haushalte einsparen müssen, ist ihr Anteil mickrig. Nur 21 % des Sparpakets tragen Unternehmen im heurigen Sparpaket alleine, fast die Hälfte zahlen ausschließlich die privaten Haushalte - und hier wiederum werden Haushalte mit ohnehin schon niedrigen Einkommen relativ gesehen besonders stark belastet.
Im Kapitel “Struktur und Verwaltung” sollen 1,3 Mrd. Euro geholt werden.
- Höheres faktisches Pensionsantrittsalter
Die Regierung will, dass wir länger arbeiten, bevor wir in Pension gehen. Frühpensions-Modelle wie die Korridorpension sollen unattraktiver werden, man darf sie erst später antreten. Ziel: Menschen bleiben ein paar Monate oder Jahre länger im Job, zahlen Beiträge ein und beziehen später Pension – das spart am Papier dem Budget Geld: allein nächstes Jahr bringt das 300 Millionen. Aber: fast ein Drittel der älteren Menschen wechselt nicht aus einem Job in die Pension, sondern aus der Arbeitslosigkeit. Wer in späteren Jahren seinen Arbeitsplatz verliert, ist so gut wie chancenlos am Arbeitsmarkt, weil ihn Unternehmen schlicht nicht mehr einstellen. Die Verschlechterung bei der Korridorpension ohne gleichzeitige Maßnahmen, wie etwa harte Strafzahlungen für Betriebe, die ältere Arbeitnehmer systematisch draußen halten, ist eine bittere Pille.
- Administratives Schulpersonal kommt nur schrittweise
Eigentlich sollten Schulen Unterstützungspersonal bekommen – also z.B. Schulsekretär:innen oder sozialpädagogische Fachkräfte, damit Lehrer entlastet werden. Das war im Regierungsprogramm angekündigt. Jetzt wird daraus: „schrittweise Einführung“, sprich: auf die lange Bank geschoben. Für Schulen heißt das: Weiter Mangel an Unterstützung, Lehrer müssen viel Organisatorisches selbst erledigen, Probleme bleiben liegen.
- Personalstopp im öffentlichen Dienst
Es werden keine neuen Stellen auf Bundesebene geschaffen, außer im Bildungsbereich. Bereits zugesagte Posten (z.B. zusätzliche Richter:innen, die man versprochen hat, um Gerichtsverfahren zu beschleunigen) sollen zwar kommen, aber darüber hinaus: Einstellungsstopp. Ämter bleiben unterbesetzt, längere Wartezeiten bei Behörden, mehr Arbeit für bestehende Beamt:innen. Man spart Gehälter ein – dafür leidet der Service für Bürger:innen
3. Wer trägt nun die Hauptlast all dieser Sparmaßnahmen?
Zahlen müssen vor allem die privaten Haushalte – also wir Bürger:innen. Mehr als die Hälfte des Sparpakets zahlen Österreichs Familien, Pensionist:innen, Arbeitnehmer:innent, während große Konzerne, und Extremreiche vergleichsweise glimpflich davonkommen. 80 Prozent der Konsolidierung werden bei Ausgabenkürzungen geholt – ein historisch hoher Anteil. Gleichzeitig bleibt auf der Einnahmenseite „alles beim Alten“: Die Reichsten im Land werden von echter Besteuerung weiterhin verschont.
Das kann uns doppelt teuer zu stehen kommen. Denn: Wir stecken bereits in der einer tiefen Wirtschaftskrise. Stellen wir uns vor, euer Auto steckt im Schlamm. Der Motor stottert, das Auto kommt kaum voran. Würdet ihr jetzt den halbvollen Tank auch noch absaugen? Sicher nicht – ihr braucht doch Treibstoff, um wieder rauszukommen. Genauso ist es mit dem Staat und der Wirtschaft. Wenn die Wirtschaft im dritten Rezessionsjahr feststeckt und der Privatkonsum schwächelt, ist der schlechteste Zeitpunkt, dem System noch mehr Geld zu entziehen.
Sparen in der Krise verschlimmert die Lage: Genau das sagen Wirtschaftsexpert:innen: Sparpakete ziehen uns die ohnehin lahme Wirtschaft noch weiter nach unten. Noch mehr sparen hieße, die Rezession tiefer und länger zu machen.
Zusätzlich könnte man versuchen, schon jetzt Maßnahmen zu setzen, die das Budgetloch stopfen helfen, ohne den Wirtschaftsmotor abzuklemmen und ohne die Haushalte noch mehr zu belasten? Dafür müssen wir dorthin schauen, wo das Geld wäre.
4. Wie könnte man das Budget einnahmenseitig sanieren – ohne die Haushalte zu belasten?
Die gute Nachricht: Es gibt Alternativen zur reinen Spar-Orgie.
Man könnte das Budgetloch auch von der anderen Seite stopfen – also bei den Einnahmen ansetzen, statt nur bei den Ausgaben. Konkret: Steuern und Abgaben erhöhen, aber gezielt dort, wo es sozial gerecht und ökonomisch verkraftbar ist. Nämlich bei jenen, die viel haben oder zuletzt von der Krise profitiert haben. Das sind noch dazu jene Haushalte mit hoher Sparquote, die ihren Konsum kaum einschränken müssen, wenn sie einen größeren Beitrag zum Schließen des Budgetlochs leisten müssen. Hier ein paar Vorschläge, die seit langem auf dem Tisch liegen:
- Vermögenssteuer – Millionär:innen zur Kasse bitten.
Österreich erhebt praktisch keine Vermögenssteuer mehr. Die klassische Vermögensteuer wurde 1993 abgeschafft, seither tragen große Vermögen so gut wie nichts mehr zum Staatshaushalt bei. Ergebnis: Während in anderen Ländern Reiche substanziell beitragen, kommt in Österreich nur 1,5% des Steueraufkommens aus vermögensbezogenen Steuern – wir sind damit Schlusslicht im internationalen Vergleich. Dabei ist das Potenzial riesig: Eine moderate Vermögenssteuer könnte rund 5 Milliarden € pro Jahr bringen – und das betrifft nur die reichsten 5% der Haushalte, deren Lebensstandard dadurch kaum tangiert wäre. Sie würden nicht weniger reich - nur weniger schnell noch reicher. Warum also keine Vermögenssteuer? Bislang fehlt der politische Wille – vor allem ÖVP und NEOS sind strikt dagegen. Doch angesichts des Budgetlochs ist diese Verweigerung zunehmend unvernünftig.
- Erbschafts- und Schenkungssteuer – gegen die dynastische Geldelite.
Auch diese Steuer wurde abgeschafft (2008). Seither kann in Österreich ein Multimillionär sein Vermögen steuerfrei an die Kinder weiterreichen, während Arbeitnehmer auf jeden Euro Lohn Steuer zahlen. Das ist ungerecht. Eine Erbschaftssteuer mit entsprechenden Freibeträgen beträfe nur Millionärs-Erben und könnte dem Staat rund 1 Milliarde € pro Jahr einbringen. Das belastet keine „normalen“ Familien, sondern die Erben von Luxusvillen und Firmenimperien. Fast alle entwickelten Industrie-Nationen kennen eine Erbschaftssteuer – nur wir leisten es uns weiterhin ein Steuersumpf für Extrem-Reiche zu sein. Höchste Zeit, das zu ändern und einen Teil großer Erbschaften an die Allgemeinheit zurückzugeben, statt immer größere Dynastien entstehen zu lassen.
- Höhere Gewinnbesteuerung – Unternehmen wieder in die Pflicht.
Erinnern wir uns: Die Körperschaftsteuer (KÖSt) – das ist die Steuer auf Unternehmensgewinne – wurde gerade erst von 25% auf 23% gesenkt. Das hat Unternehmen jährlich gut bis zu 1,2 Milliarden Euro an Steuern erspart. Diesen Schritt könnte man rückgängig machen. Einfach zurück zu 25% – schon hätte der Staat über eine Milliarde mehr Einnahmen: fast siebenmal so viel wie er durch die Familienleistungskürzungen spart. Die Prioritätenfrage stellt sich hier deutlich: Will ich 1,2 Mrd. reinholen, indem ich Großkonzerne wieder normal besteuere? Oder will ich 182 Mio. sparen, indem ich Familien die Inflation nicht ausgleiche? Zumal Österreichs Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich ohnehin niedrig ist: In Deutschland zahlt ein Konzern auf Gewinne rund 30% Steuer, bei uns wären es selbst mit 25% noch deutlich weniger. Ein Aufstocken auf z.B. 27% wäre immer noch im Mittelfeld – und würde weitere Milliarden bringen.
- Förderdschungel und Schlupflöcher - genauer hinschauen.
Neben der KÖSt gibt es noch andere Hebel: Viele Unternehmen profitieren von Ausnahmen und Schlupflöchern, von Forschungsprämien bis Investitionsfreibeträgen. Ein gründliches Durchforsten der Unternehmensförderungen könnte Überflüssiges zutage fördern. Die Regierung selbst weiß, dass es da Luft gibt – sie hat ja eine Förder-Taskforce angekündigt, die den „Förderdschungel“ mit der Machete durchforsten soll. Man könnte aber auch gleich bei den offensichtlichsten Posten anfangen: Beispielsweise den Dieselprivilegien oder der zu niedrigen Flugticketabgabe – klimaschädliche Subventionen, deren Streichung bis zu 1 Mrd. € bringen würde und zugleich gut für die Umwelt wäre. Oder man schaut sich die Corona-Hilfen an: Überförderte Unternehmen, die trotz staatlicher Hilfe Gewinne gemacht haben, könnten im Nachhinein zur Kasse gebeten werden. Schätzungen des Momentum Instituts zufolge ließen sich aus überzahlten Energiehilfen oder COFAG-Mitteln mindestens 1,4 Mrd. € zurückholen– wahrscheinlich sogar mehr, wenn man alle Fälle prüft. Jeder Euro, den man sich da zurückholt, muss nicht von uns Bürgern im Sparpaket erbracht werden.
Übergewinne abschöpfen – Krisengewinne gerecht verteilen.
Windfall Profits, Übergewinne – egal wie man es nennt: In den letzten Jahren gab es Branchen, die dank der Krise unverhoffte Rekordgewinne erzielt haben. Bei den Energiekonzernen hat man das bereits erkannt und mit dem Energiekrisenbeitrag reagiert. Doch warum nur befristet und warum so zögerlich? Banken etwa haben wir oben erwähnt: Ihre Zinsgewinne der letzten Jahre sind extrem – in Spanien, Italien, Ungarn, Tschechien u.v.m. wurden daher spezielle Bankenabgaben eingeführt. Österreich könnte problemlos ähnliches tun. Das Aufkommenspotenzial liegt je nach Ausgestaltung zwischen 69 Mio. und 1,7 Mrd. € pro Jahr, der Mittelwert bei rund 850 Mio. Euro. Das ist fast ein Fünftel des gesamten Sparvolumens, das Österreich nächstes Jahr bräuchte– mit nur einer Maßnahme, die keinen normalen Haushalt belastet.
Man sieht: Es gibt einen Werkzeugkasten voller Einnahmenmaßnahmen, mit denen sich das Budget sanieren ließe, ohne die breite Masse zu schröpfen und dadurch die Konjunktur abzuwürgen. Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, Übergewinnsteuer, höhere Unternehmenssteuern, Millionärsabgaben – alles würden die treffen, die in den letzten Jahren geschont wurden und die es sich leisten können.
Es läuft auf eine einfache Frage hinaus: Wer soll das Loch stopfen? Jene, die es verursacht haben und deren Schultern breit genug sind, um etwas mehr zu tragen? Oder wieder einmal die Vielen, von denen sich viele abstrampeln müssen, um durchzukommen?