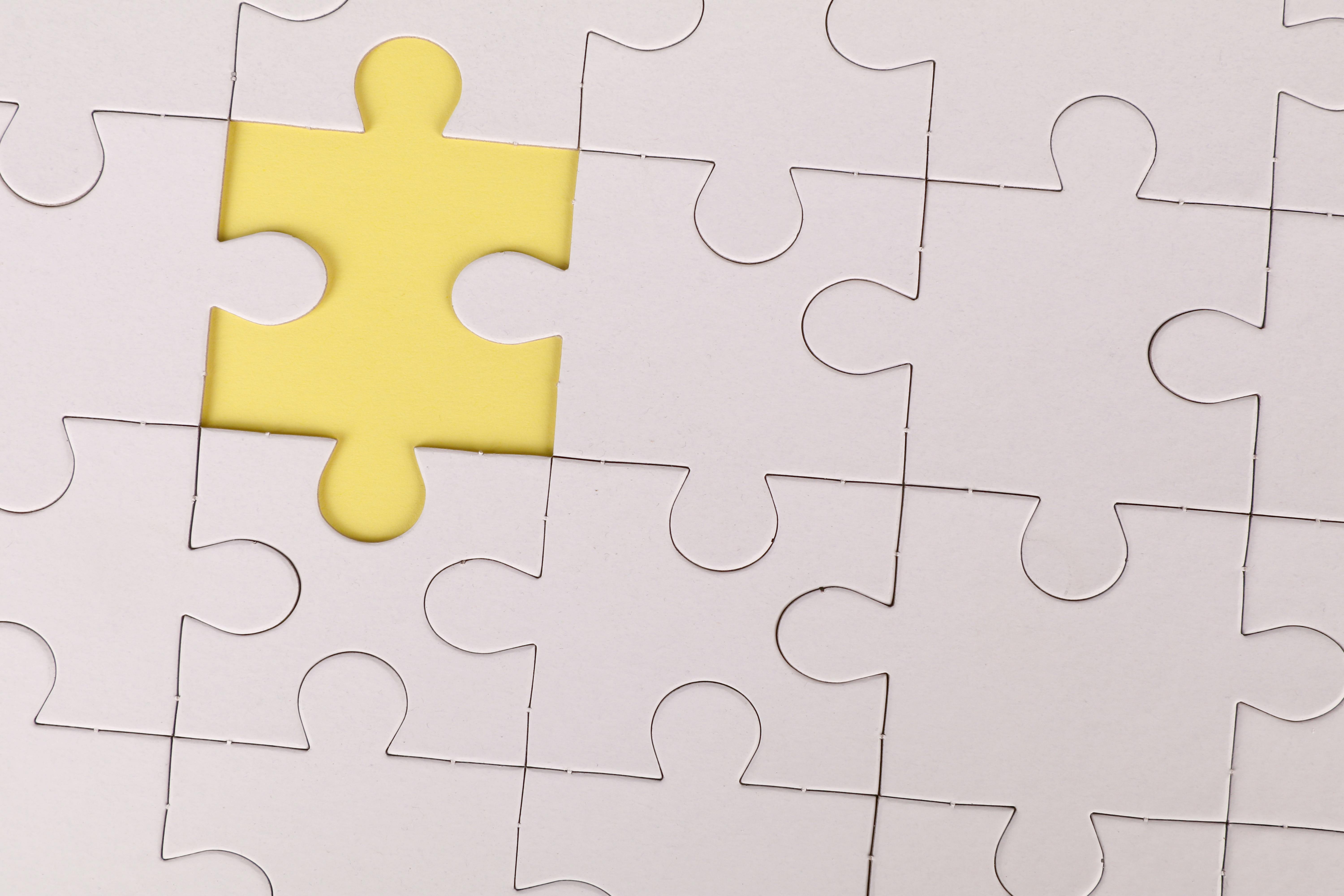Warum werden so viele Anträge auf Berufsunfähigkeit abgelehnt?

"Hätte sie mich zwei, drei Jahre in Ruhe gelassen, würde ich schon längst wieder halbwegs normal arbeiten können, zumindest wären die Chancen bedeutend höher gewesen", sagt Gerald (Name geändert) über seinen Kampf um die Anerkennung seiner Berufsunfähigkeit. Er ist wütend und müde. Fast fünf Jahre und ein Gerichtsverfahren lang dauerte es, bis die PVA anerkannte, dass er nicht arbeiten kann und somit Anspruch auf finanzielle Unterstützung hat.
So wie dem Techniker ging und geht es vielen Österreicher:innen. 105.000 Menschen beziehen Rehabilitationsgeld oder eine Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspension. Einfach gesagt: Sie können aus gesundheitlichen Gründen für mindestens sechs Monate pro Jahr nicht arbeiten. Ob jemand einen Anspruch auf diese Zahlungen hat, entscheidet in Österreich die Pensionsversicherungsanstalt (PVA).
Der Weg zu dieser Unterstützung ist steinig: Am Anfang steht ein langer Leidensweg mit körperlichen oder seelischen Problemen, die das Arbeiten unmöglich machen. Es folgen unzählige Arztbesuche, Zukunftsängste und oft ein leeres Konto. Und mittendrin steht die PVA, die sich dem Anschein nach mit Händen und Füßen dagegen wehrt, Menschen die nötige Hilfe zu gewähren, um wieder auf die Beine zu kommen. Geralds Geschichte ist ein Beispiel von vielen.
Daheim galt: "Wer nicht arbeitet, ist ein Arschloch"
"Ich habe schon lange mit psychischen Problemen gekämpft, Erschöpfung und Depression", erzählt Gerald im Gespräch. "Es war mir zunächst aber egal, ich habe einfach weitergearbeitet. Vom Vater hieß es: Wer arbeitet, ist ein Mensch. Wer nicht arbeitet, ein Arschloch."
Vor zehn Jahren traf ihn im Schlaf die erste Panikattacke. Im Krankenwagen dachte er, er hätte einen Herzinfarkt. Das war nicht der Fall, und er wurde zu seinem Hausarzt geschickt. Der verschrieb Tabletten, die kurzfristig halfen. Gerald schleppte sich fünf weitere Jahre und durch weitere Panikattacken. "Dann habe ich mich sogar selbstständig gemacht. Ich dachte, wenn ich mir die Zeit selbst einteile, bekomme ich meine Probleme in den Griff", erzählt er. Das war ein Irrglaube. Nach einem letzten Versuch mit einer Teilzeitanstellung ging nichts mehr – und der neue Leidensweg mit der Behörde begann.
Acht Minuten entscheiden über ein Schicksal
Ein Jahr lang bekam er Krankengeld. Danach ist die PVA zuständig. Zu diesem Zeitpunkt hatte er – wie die meisten Betroffenen – eine dicke Mappe mit ärztlichen Befunden gesammelt, die seine Arbeitsunfähigkeit belegten. Damit ging er zur Begutachtung durch die PVA. Dort erlebte er Unglaubliches:
"Der Termin war um 11:40 Uhr, ich war zehn Minuten früher da. Mir kamen zwei Männer am Gang entgegen, die über das Mittagessen gesprochen haben. Ich wusste nicht, dass einer der beiden mein begutachtender Arzt ist. Das stellte ich erst fest, als ich ins Zimmer gerufen wurde. Er hat sich weder vorgestellt noch mich angeschaut. Dann hat er meine Befunde zur Seite gelegt und mir ein paar Fragen zu meinem Tagesablauf gestellt. Ohne mich anzusehen, hat er mich mit einer Handgeste verabschiedet. Gedauert hat das vielleicht zehn bis fünfzehn Minuten. Nicht viel später kam die vollständige Ablehnung meines Antrags per Post."
Der Kampf dagegen dauerte Jahre
Wer abgelehnt wird und nicht klagt, muss sich nach Auslaufen des Krankengeldes beim AMS melden und landet oft in der Notstandshilfe. Gerald entschied sich trotz leerem Konto und dank der Hilfe von Freund:innen zu klagen.
Die Zerreißprobe zog sich über Jahre, mit Reha-Aufenthalten und Gerichtsverhandlungen, die er nur mit starken Medikamenten für die Psyche durchstand. Das Leben war stark eingeschränkt. Solange man Leistungen bezieht, gibt es Urlaub nur auf Antrag. Man darf nicht einmal das Bundesland verlassen.
"Heute weiß ich zwar noch immer nicht, ob ich jemals wieder ansatzweise normal arbeiten kann, aber habe auch irgendwie resigniert. Dennoch: Wenn ich das ganze erzähle, kribbelt es aber noch immer am ganzen Körper und ich merke, wie sich wieder eine Panikattacke anbahnt", sagt er und nicht nur einmal droht die Stimme zu brechen. Er denkt, aktuell nicht mehr als ein, zwei Wochen am Stück arbeiten zu können. Eigentlich wäre er noch jung genug, um mehr als zehn Jahre zu arbeiten.
Jährlich tausende Klagen gegen die PVA
"Drei Viertel der Anträge auf Rehabilitationsgeld werden abgelehnt", berichtet Jürgen Holzinger. Er ist Gründer und Obmann des Vereins ChronischKrank, der rund 15.000 Menschen in ihrem Kampf um ein würdevolles Leben mit Krankheit unterstützt.
"Wir beraten im Jahr bei rund 1.000 Klagen gegen die Sozialversicherung bzw. die PVA", so Holzinger. Vielen geht es wie Gerald. "Die Betroffenen kommen mit offiziellen Facharzt-Befunden. Das hat alles Hand und Fuß." Die Gutachten der PVA seien hingegen oft minderwertig und dauerten meist nur zehn bis 15 Minuten.
Dabei wünschen sich fast alle Betroffenen, wieder arbeiten zu können. Das wird aber unmöglich gemacht, wenn man statt Hilfe in die Arbeitslosigkeit geschickt wird. Holzinger vermutet dahinter eine politische Strategie: "Meine Einschätzung ist, dass man aus politischen Gründen möglichst wenige Bezieher:innen von Berufsunfähigkeitspension oder Reha-Geld will." Sprich: Der Mensch selbst kann nicht arbeiten gehen, die Unterstützungszahlungen muss wer anderer als die PVA machen und diese hat die Kosten nicht zu verantworten.
Unsichtbares Leid lässt sich schwer beweisen
Offizielle Statistiken zeigen, dass psychische Erkrankungen mit 46,9 % der Hauptgrund für Berufsunfähigkeit sind.
Genau hier liegt das Problem der oberflächlichen Begutachtung, berichtet auch AK-Expertin Monika Weißensteiner. Während körperliche Einschränkungen oft leicht nachweisbar sind, ist das bei psychischen Problemen meist nicht der Fall. Plakativ gesagt: wenn jemandem Körperteile fehlen, die man fürs Arbeiten brauchen würde, ist das auch in 10 Minuten feststellbar.
Sich wegen seelischer Probleme Hilfe zu suchen, ist für viele ohnehin schon schwer. Wenn man dann endlich weiß, was los ist und man sich wieder aufrichten will, wird man – aus Sicht der Betroffenen – von der PVA schlecht behandelt.
"Wer tut sich das freiwillig an?"
Doch mittlerweile trifft die strenge Praxis der PVA nicht nur Menschen mit psychischen Erkrankungen. Auch bei körperlichen Krankheiten wie ME/CFS, dem chronischen Erschöpfungssyndrom, kommt es massenhaft zu Ablehnungen. Das ist eine schwere, von der WHO anerkannte neuroimmunologische Erkrankung, die oft nach einer Virusinfektion auftritt und die Betroffenen an ihr Zuhause fesselt. Seit der Corona-Pandemie ist sie zumindest stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt.
Trotzdem werden Anträge von ME/CFS-Betroffenen laut Recherchen von APA, ORF und Dossier zu über 70 Prozent abgelehnt. Immer wieder wird die Diagnose auch fälschlicherweise in eine psychosomatische Erkrankung geändert. Das geht dann auch mit falschen Therapien einher.
Emil*, der selbst betroffen ist, vermutet, dass die PVA damit Sozialbetrug verhindern will. Doch er fragt sich: "Wer tut sich das freiwillig an? Da arbeite ich lieber als Schrauber im Schichtbetrieb bei der VÖEST und habe meine Ruhe und mein Geld." Sein Punkt ist klar: Niemand simuliert eine Krankheit, die das Leben derart einschränkt. Das System scheine möglichst wenig Menschen mit Leistungen unterstützen zu wollen.
Was sagt die PVA?
Die PVA selbst teilt auf Anfrage mit, dass ihre Gutachten "objektiv, schlüssig und nachvollziehbar" seien und man damit nach gesetzlichen Vorgaben handle. "Alle für die PVA tätigen Gutachter:innen handeln gemäß dieser gesetzlichen Vorgaben." Die Begutachter:innen seien, in aller Regel auf die vorgelegten Vorbefunde sogar angewiesen, sofern diese wissenschaftlich evidenzbasiert und objektiv seien.
Das zuständige Gesundheitsministerium klingt ähnlich. Die Gutachten würden "nach einheitlich hohen Qualitätsstandards durchgeführt" werden und man achte auf die Einhaltung sämtlicher Vorgaben sowie am neuesten Stand zu sein. Reformbedarf gibt es trotzdem. Denn eine solche ist zu Reha-Geld, Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspension im aktuellen Regierungsprogramm vereinbart. Aber da ist noch kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
Die Qualität dieser Gutachten wird trotz dieser Zusicherungen von vielen Seiten kritisiert. Wenn jährlich rund 10.000 Berufsunfähigkeitspensionen gewährt werden, aber alleine ChronischKrank rund 15.000 Personen berät und jährlich 1.000 Klagefälle begleitet, gibt es ein offensichtliches Problem. Holzinger, Gerald und Emil fragen sich, wie unabhängig Gutachter:innen seien, die von der PVA beauftragt werden. Diese werden zudem auch in einem Verein ausgebildet, der unter anderem auch der PVA gehört (ÖBAK). Eine zentrale Forderung von Kritiker:innen ist daher die Einführung von unabhängigen Gutachter:innen.
Ein Systemfehler, der Menschen krank macht
Am Ende des Tages werden Menschen im Kreis geschickt. Wem benötigte Berufsunfähigkeitsleistungen verweigert werden, der braucht trotzdem erst recht irgendeine andere Versicherungs- oder Transferleistung.
Warum man am Weg dorthin Menschen wie Gerald psychisch und finanziell "ruiniert", das ist die große Frage. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Bescheidbeschwerden von ChronischKrank zu 50 Prozent erfolgreich sind. Diese kosten aber, ein Teil der Antragsteller:innen fügt sich ihrem Schicksal.
Eine naheliegende Lösung sind unabhängige Gutachter:innen. Die Hoffnung ist, dass sie dafür sorgen können, dass Betroffene wie Gerald und Emil rasch die richtige Behandlung bekommen. Vielleicht gilt bei manchen Krankheitsbildern dann das, was Gerald eingangs sagt: Dass man längst wieder arbeiten und somit ins System einzahlen könnte.