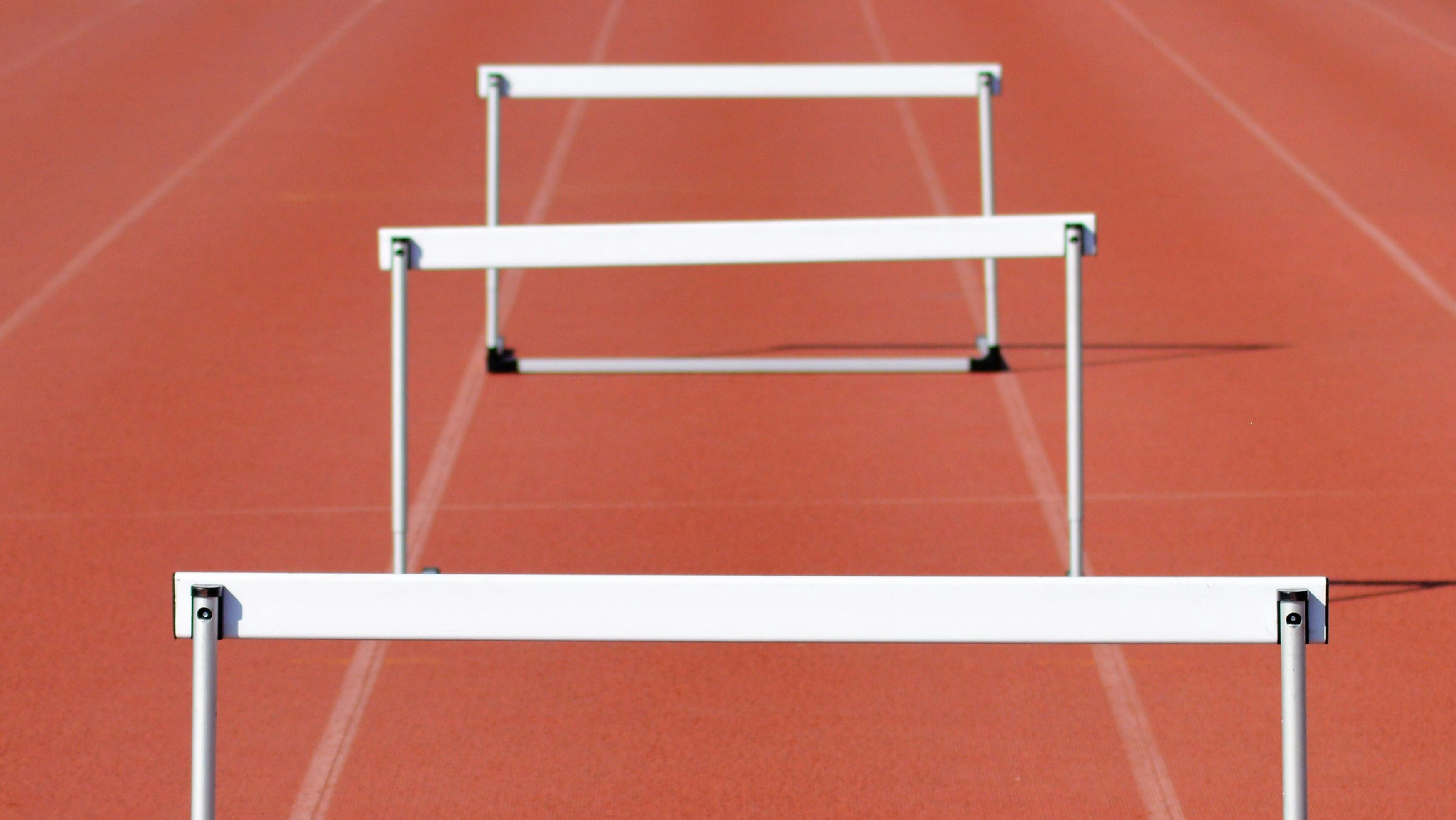Bildungskarenz neu: Wer profitiert von der neuen Weiterbildungszeit?
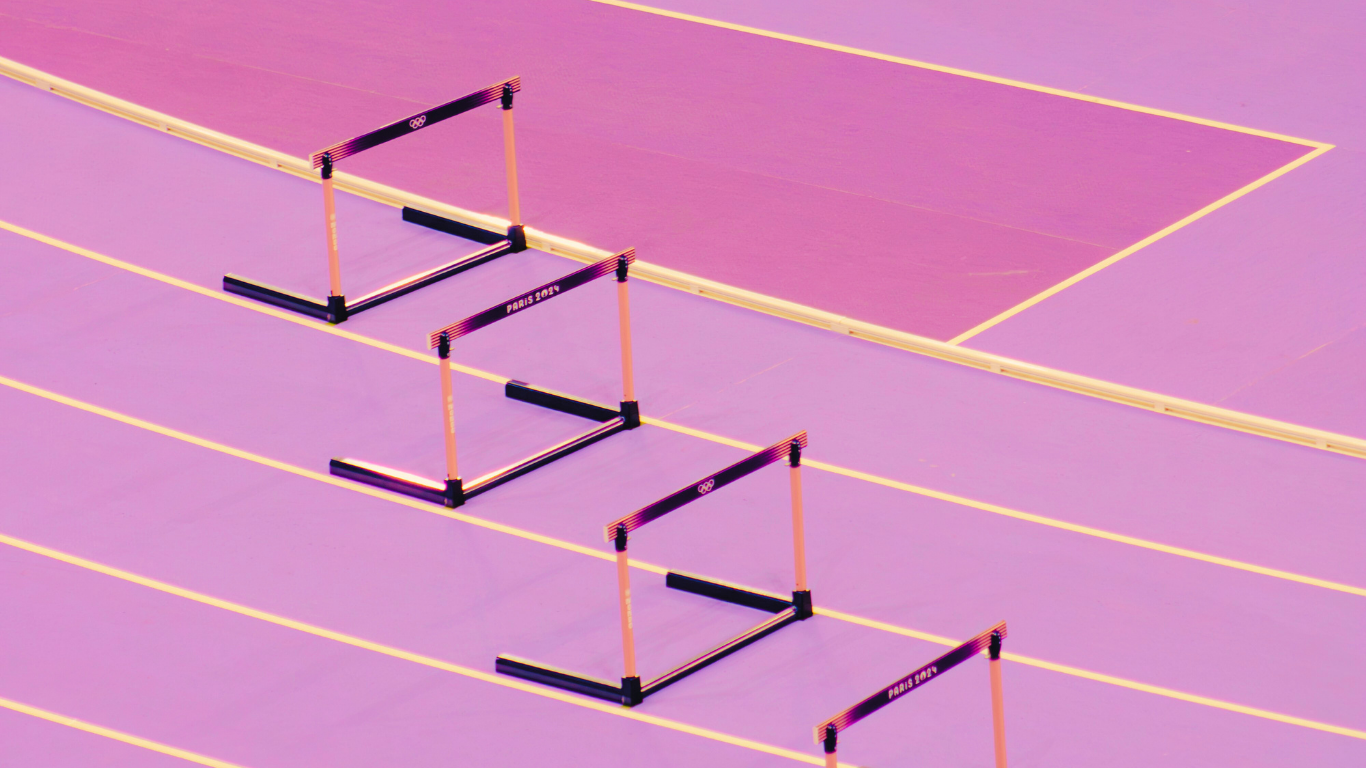
Die Bildungskarenz war in Österreich ein Erfolgsmodell - wenn auch eines, das nie frei von Kritik war. Sie erlaubte es Arbeitnehmer:innen, mehrere Monate oder auch ein Jahr aus dem Job auszusteigen, um sich weiterzubilden - und das finanziell abgesichert. Genutzt haben dieses Instrument in erster Linie Frauen. Laut einer WIFO-Studie lag ihr Anteil bei 73 Prozent. Besonders auffällig: Seit 2019 stieg die Zahl jener Frauen, die direkt im Anschluss an die Elternkarenz in die Bildungskarenz wechselten. Für sie war Weiterbildung kein „nice to have“, sondern eine Brücke zurück ins Erwerbsleben.
Dass dieses Modell Wirkung hatte, zeigen die Daten. Frauen, die nach ihrer Elternkarenz Bildungskarenz in Anspruch nahmen, hatten später eine signifikant höhere Beschäftigungsquote als vergleichbare Frauen ohne Weiterbildungskarenz. Auch ihre Einkommen entwickelten sich besser. Damit war die Bildungskarenz ein Instrument, das sowohl persönlich als auch volkswirtschaftlich Sinn machte: Die Qualifikationen stiegen, die Erwerbsbeteiligung wuchs, langfristig erhöht sich damit auch das Steueraufkommen.
Der Fortschritt der Weiterbildungszeit
Nun kommt die Reform. Die alte Bildungskarenz wird zur „Weiterbildungszeit“ umgebaut. Sie bringt Fortschritt, aber auch Rückschritt. Positiv ist die finanzielle Seite. Der Tagessatz steigt spürbar an und wird künftig an die Teuerung angepasst.
Für Menschen mit niedrigen Einkommen ist das entscheidend, denn bisher war Weiterbildung für sie oft unleistbar. Wer von einem Monatsbudget knapp über der Armutsgrenze lebt, kann es sich nicht leisten, für Monate oder gar ein Jahr nur den AMS-Tagessatz zu beziehen. Mit den höheren Sätzen wird Weiterbildung realistischer: zumindest theoretisch.
Damit wird ein Fehler korrigiert, der Weiterbildung lange zu einem Privileg von Besserverdienenden gemacht hat.
Die Rückschritte gegenüber der Bildungskarenz
Doch während die finanzielle Unterstützung verbessert wird, steigen die Zugangshürden. Wer künftig eine Weiterbildungskarenz in Anspruch nehmen will, muss zwölf Monate ununterbrochen im selben Betrieb gearbeitet haben. Wer bereits einen Uniabschluss hat, braucht sogar vier Jahre Vorbeschäftigung. Und direkt nach der Elternkarenz ist ein Antritt für ein halbes Jahr ausgeschlossen.
Dazu kommt: Wer teilnehmen will, muss ein hohes Stundenmaß an Weiterbildung nachweisen: mindestens 20 Wochenstunden, für Eltern mit Kindern bis sieben Jahre immer noch 16 Stunden.
Diese Vorgaben sind nicht neutral. Sie bevorzugen durchgängige Vollzeitbiografien und erschweren den Zugang für Menschen mit Job-Unterbrechungen, Teilzeit und Care-Verpflichtungen. Anders gesagt: Sie bevorzugen ein Erwerbsprofil, das in Österreich überwiegend männlich ist. Frauen arbeiten deutlich häufiger Teilzeit und haben längere Unterbrechungen durch Kinderbetreuung. Genau jene Frauen, die bisher von der Bildungskarenz profitierten, werden durch die neuen Regeln ausgebremst.
Auf Gnade der Arbeitgeber:innen und des AMS
Erschwerend kommt hinzu, dass der Rechtsanspruch auf die neue „Weiterbildungszeit“ sogar noch abgeschwächt wurde. Der Arbeitgeber muss wie bisher weiterhin zustimmen (bei höheren Einkommen sogar zuzahlen). Internationale Studien zeigen, dass genau dieses Zustimmungserfordernis eine entscheidende Barriere ist. In Deutschland, Finnland oder Schweden belegen Evaluationen, dass Arbeitgeberfreigaben und schwammige Formulierungen wie „zwingende betriebliche Gründe“ dazu führen, dass Anträge eher abgelehnt oder verschleppt werden.
Beschäftigte, vor allem in kleinen Betrieben, verzichten daher oft schon im Vorfeld. Für Österreich gibt es (noch) keine Daten, doch die internationale Evidenz ist eindeutig: je größer der Spielraum der Arbeitgeber, desto geringer die tatsächliche Nutzung. Und weil Frauen überdurchschnittlich in kleinen Betrieben und in Teilzeit arbeiten, trifft auch diese Hürde sie besonders.
Nun wird der Anspruch sogar noch weiter geschwächt, weil man auch gegenüber dem AMS keinen Rechtsanspruch mehr hat. Wenn man den Arbeitgeber überzeugt hat, kann das AMS jetzt immer noch nein sagen.
Ein volkswirtschaftliches Problem
Damit ergibt sich ein widersprüchliches Bild. Auf der einen Seite wird Weiterbildung finanziell attraktiver, gerade für Menschen mit niedrigem Einkommen. Auf der anderen Seite werden die formalen und faktischen Zugangsvoraussetzungen verschärft - mit Folgen vor allem für Frauen. Die Reform verschiebt die Zielgruppe: weg von den Müttern, die nach der Familienphase den Wiedereinstieg suchten, hin zu stabilen Vollzeitbeschäftigten mit ungebrochener Erwerbsbiografie.
Volkswirtschaftlich ist das ein Problem. Österreich steht vor enormen Transformationsaufgaben: Digitalisierung, Energiewende, Pflege. Weiterbildung ist der Schlüssel, um Beschäftigte fit für neue Anforderungen zu machen. Es liegt im gemeinsamen Interesse, dass möglichst viele Zugang zu Weiterbildung haben.
Wenn aber Frauen, Teilzeitkräfte oder Beschäftigte in Kleinbetrieben durch die Architektur der neuen Regelung tendenziell ausgeschlossen werden, wird Potenzial verschenkt. Die positiven Effekte, die das WIFO bei Frauen nach der Elternkarenz dokumentiert hat, drohen zu verpuffen.
Bildungskarenz neu: Die ambivalente Reform
Die Reform ist also ambivalent. Sie korrigiert eine alte Schwäche, indem sie die finanzielle Basis stärkt. Aber sie baut neue Hürden auf, die ausgerechnet Frauen treffen, die die unbezahlte Arbeit zuhause schultern müssen.
Noch ließe sich nachbessern. Kürzere Wartezeiten nach der Elternkarenz, niedrigere Mindeststunden für Eltern, enge Definitionen von Ablehnungsgründen und automatische Zustimmung bei Fristversäumnissen wären naheliegende Schritte. Fest steht: Am Ende entscheidet nicht der Tagessatz allein über die Wirkung der Reform, sondern die Frage, wer überhaupt teilnehmen darf. Solange diese Antwort lautet „vor allem Männer mit stabiler Vollzeitkarriere“, bleibt die „Weiterbildungszeit“ nur ein halber Fortschritt – und ein ganzer Rückschritt für Frauen.
Quellen:
- WIFO: Evaluierung der Bildungskarenz und der Bildungsteilzeit
- Frontiers: Educational Leave as a Time Resource for Participation in Adult Learning and Education (ALE)
- The effects of an education-leave program on educational attainment and labor-market outcomes
- International review of study/training leave policies
- CEDEFOP: Training leave - Policies and practice in Europe