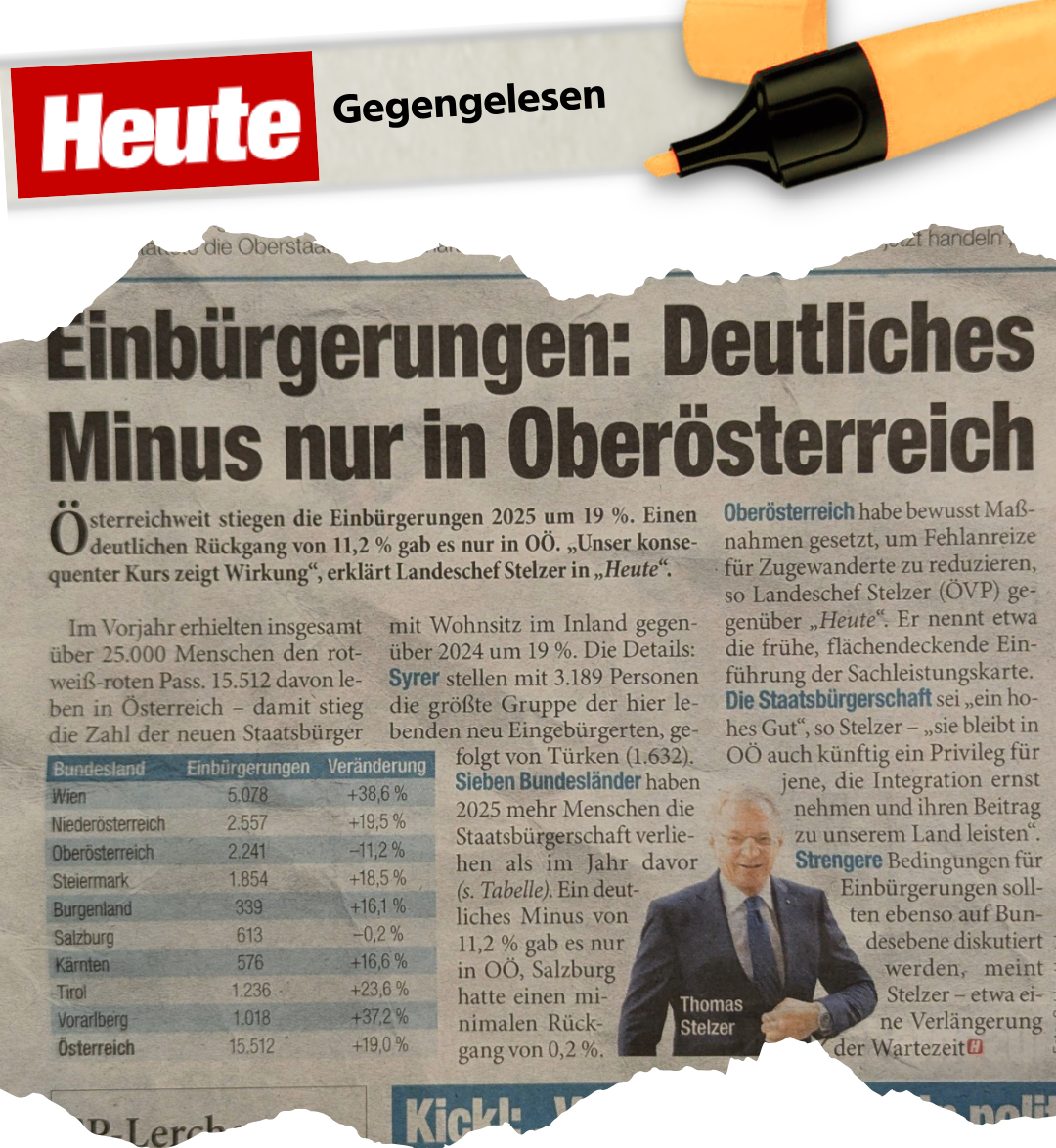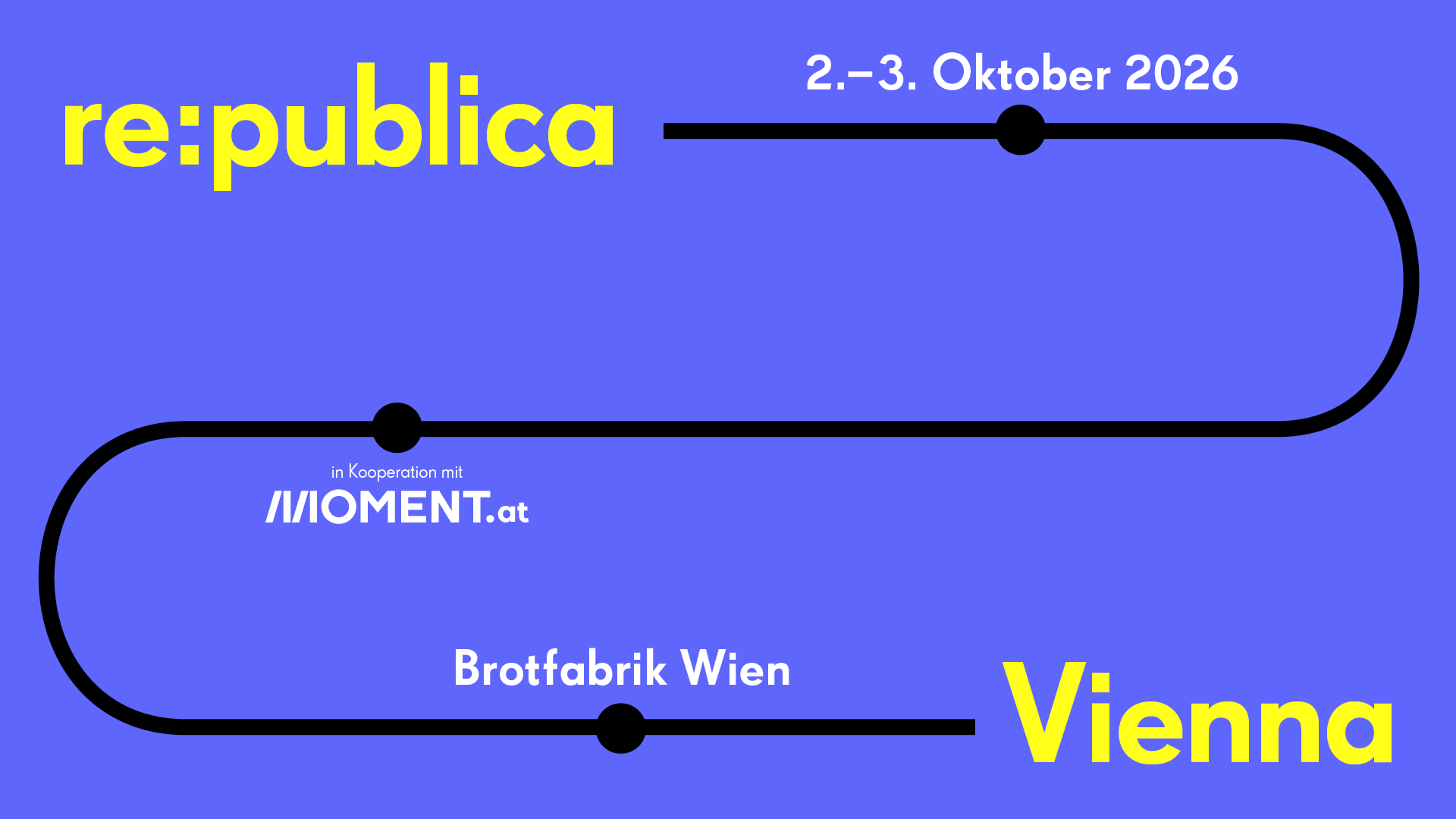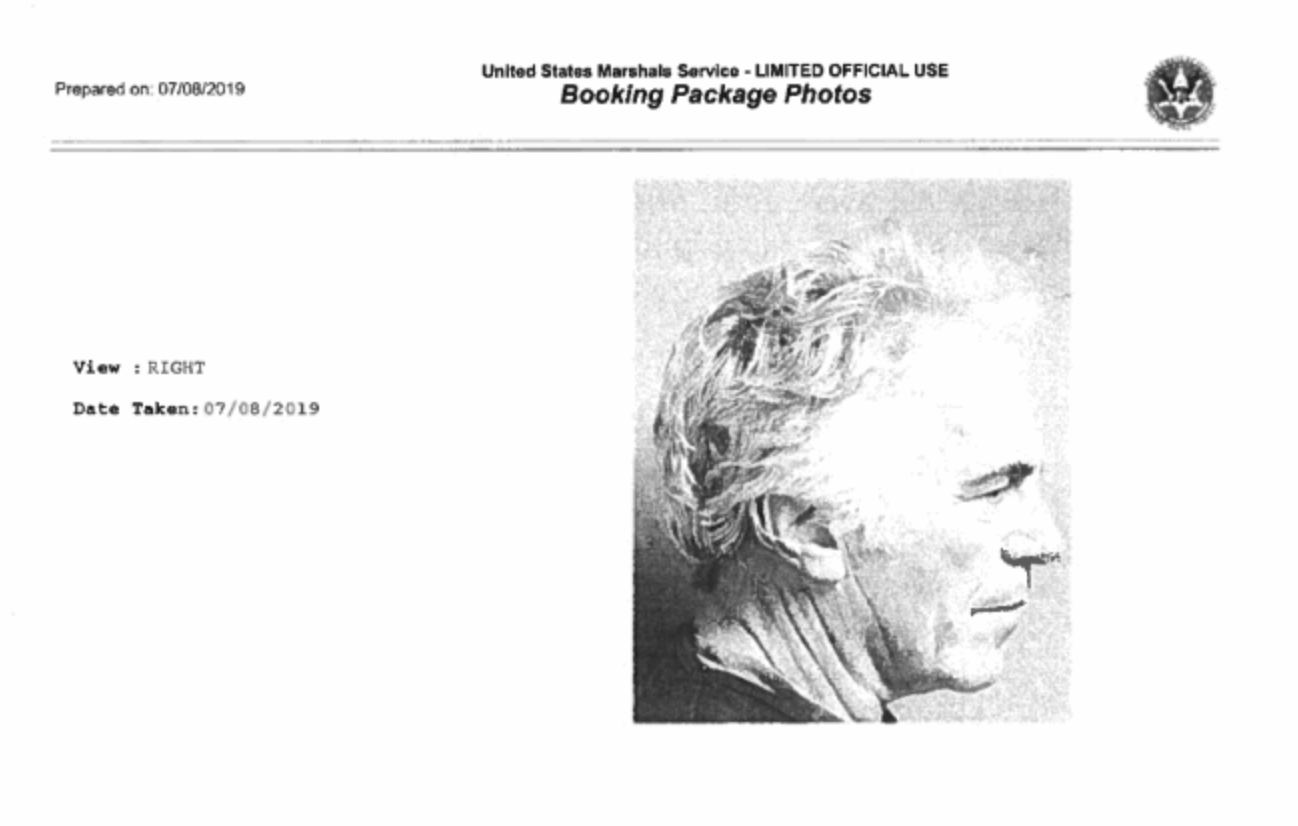Wie die Austerität den Kapitalismus an der Macht hält

Sparen ist das Gebot der Stunde. Hatte die ÖVP sich vor der Nationalratswahl noch strategisch über das Haushaltsloch ausgeschwiegen – danach war es nicht mehr zu leugnen. Mit Steuergeschenken an Unternehmen und Einmalzahlungen nach dem Gießkannenprinzip rissen die vergangenen Regierungen ein Loch ins Budget – und überschritten damit die EU-Defizitgrenze von drei Prozent. Die Rechnung soll nun die Mehrheit tragen – das zeigen die kürzlich vorgestellten Budgetpläne der neuen Regierung. Über zwei Jahre sollen 15 Milliarden Euro eingespart werden. Dafür sollen etwa der Klimabonus und die Bildungskarenz wegfallen. Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld und Reha-Geld werden nicht an die Teuerung angepasst. Außerdem steigen Steuern und Gebühren für alle. Immerhin: Auch die Bankenabgabe soll steigen.
Was die Regierung plant, hat einen Namen. Viele kennen ihn aus der Euro-Krise. Als die Banken in der globalen Finanzkrise 2007/8 in den Abgrund stürzten, verschuldeten europäische Staaten sich hoch, um sie zu retten. Allerdings drückte das bereits zuvor verschuldete Staaten wie Griechenland in eine Staatsschuldenkrise. Als Medizin für die hohen Schulden galt eine radikale Kürzungspolitik. Deren Name lautet: Austerität.
In Griechenland hatte das dramatische Folgen: 2014 lebten drei Millionen Griech:innen unter der Armutsgrenze - ein Drittel der Bevölkerung. Heute hat das Land zwar seine Schulden abbauen können und die Wirtschaft wächst. Doch für die Mehrheit bedeutet das im Alltag immer noch Verzicht, für viele sogar Not. Noch immer ist mehr als jeder vierte Mensch arm. Das kaputt gesparte Gesundheitssystem ist marode, die Reallöhne sind immer noch niedriger als vor der Finanzkrise.
Im Zuge der Euro-Krise verschrieben sich die europäischen Staaten verstärkt der Austeritätspolitik. Die Schuldenaufnahme der Mitgliedsstaaten sollte fortan strenger überwacht und Verstöße geahndet werden. Eben das droht nun Österreich.
Austerität: Lange Geschichte einer schlechten Idee
Doch die Geschichte der Austerität geht viel weiter zurück. Und sie ist bei weitem nicht unumstritten. Immer wieder kritisierten Ökonom:innen und Politiker:innen sie als falsche Medizin der Wirtschaftsstabilisierung. Und doch wird sie immer wieder aufs Neue verordnet. Warum?
Weil sie funktioniert, wenn man die Perspektive wechselt. Das schlägt die US-amerikanisch-italienische Ökonomin Clara Mattei vor. Austerität ist keine gute Wirtschaftspolitik, aber ein starkes Machtinstrument der Besitzenden. Ökonomen und Finanzbeamte entwickelten sie in den 1920ern, um die kapitalistische Ordnung vor den wirtschaftsdemokratischen Experimenten der Arbeiter:innen zu schützen.
Diese Geschichte erzählt Mattei in ihrem jüngst ins Deutsche übersetzten Buch „Die Ordnung des Kapitals“. Anschaulich entwickelt sie ihr Argument an den Fallbeispielen des liberaldemokratischen Großbritannien und faschistischen Italien.
Der gebrochene Kapitalismus
Und die Geschichte geht so: Um ihre Kriegswirtschaften am Laufen zu halten, griffen beide Länder in den bis dahin unregulierten Kapitalismus ein. Industrien wurden verstaatlicht, die gesamte Wirtschaft darauf ausgerichtet, “Grundbedürfnisse im Inland zu befriedigen und die Kriegsanstrengungen im Ausland zu unterstützen“, führt Mattei aus.
Damit brachen die Regierungen das heilige Gebot des Kapitalismus: die Unantastbarkeit des Marktes. Der starke Staat und der Kriegskollektivismus als Rechtfertigung von alldem, brachten den unerwünschten Nebeneffekt, dass die Menschen zu träumen begannen: Wenn der Staat die Wirtschaft lenken kann, um dem Krieg zu genügen, wieso sollte er sie nicht auch in Friedenszeiten lenken – und zwar zum Wohle aller, auch der Arbeitenden?
Einen ähnlichen Effekt haben wir in Österreich während der Corona-Pandemie beobachten können. Auch hier haben sich viele gefragt: Auf einmal werden Milliarden zur Pandemiebekämpfung locker gemacht. Wieso war nicht schon vorher Geld da? Schließlich fehlte es in Krankenhäuser und Schulen bereits viel länger an allen Ecken und Enden.
Plötzlich Wohlfahrtsstaat
Mattei zeigt auf: Eine Folge des Ersten Weltkrieges war, die allgemeine Wohlfahrt als Staatsziel zu begreifen. Das wirkte bis in hohe Regierungszirkel. So kündigte der britische Premierminister Lloyd George 1918 an: „Wir werden diejenigen, die an einem dunklen Ort gelebt haben, auf ein Plateau heben, wo sie die Strahlen der Sonne empfangen können“.
Die Sozialausgaben erhöhten sich in Großbritannien als auch Italien enorm. Italien versechsfachte sie zwischen 1915 und 1920 gar. Soziale Rechte und Sicherungsnetze wurden eingerichtet, das Wohnungsproblem angegangen und Preiskontrollen eingeführt. Das sollte die erstarkende Arbeiterschaft besänftigen, bewirkte aber das Gegenteil: Die Arbeiter:innen „wurden durch sie angespornt“, so Mattei. Sozialistische Parteien und Gewerkschaften wuchsen, Streiks nahmen zu.
Die Herrschenden werden nervös
Die Bewegung der Arbeiter:innen griff zunehmend die Grundlagen des Kapitalismus an. Sie forderte etwas, das die Industriellen bedrohte: die Mitbestimmung an der Produktion. In Großbritannien trieben die Bergwerksarbeiter den Wunsch nach einer Wirtschaftsdemokratie selbstbewusst voran. In Italien loteten derweil Genossenschaften und Gilden die Grenzen des Kapitalismus aus.
Noch weiter gingen die Metallarbeiter beider Länder, die sich in Fabrikräten selbstverwalteten. In Italien kam es zu massenhaften Fabrikbesetzungen, die schlussendlich zu einer Vereinbarung mit den Metall-Industriellen führten. Unter Druck der Regierung stimmten sie einer gewerkschaftlichen Kontrolle in der Industrie, erheblichen Lohnerhöhungen und bezahltem Urlaub zu. Die Ökonomie wurde plötzlich als politisch formbar verstanden und die Arbeiter:innen als ihre Gestalter.
Die Industriellen organisieren sich
Besetzungen, hohe Steuern auf Vermögen, Übergewinn und Erbe, das Schwächeln der Produktion und eine hohe Inflation bedeuteten für die Industriellen: weniger Vermögen, sinkende Gewinne und Machtverluste. Und so begannen auch sie sich zu organisieren.
1920 in Brüssel und 1922 in Genua fanden sie zu internationalen Finanzkonferenzen zusammen. Hohe Finanzbeamte und Ökonomen waren eingeladen, Gewerkschaftsvertreter hingegen nicht. Um die Wirtschaft zu stabilisieren, so ein britischer Finanzbeamter, müsse fortan gelten: „hart arbeiten, hart leben, hart sparen“. Gemeint waren damit natürlich die Arbeiter:innen. Denn: Als Grund für die Wirtschaftskrise erachteten die Anwesenden nicht etwa den Krieg, sondern den „Überkonsum“ der fordernden Massen.
Die Entwicklung der Austeritätspolitik
Um die Arbeiterschaft wieder auf ihren Platz zu verweisen und Gewinne zu sichern, wurde die Austeritätspolitik entwickelt. Dabei sind Kürzungen und ausbleibende Investitionen ein wichtiges Instrument. So hängen die Arbeitenden wieder stärker vom Markt ab, etwa weil die öffentliche Gesundheitsvorsorge nicht reicht und sie privat vorsorgen müssen.
Aber Austerität umfasst nicht nur einen ausgeglichenen Staatshaushalt. Auch eine Besteuerung, die die Mehrheit stärker belastet als Reiche und so von unten nach oben verteilt gehört dazu. Oder eine Politik der hohen Zinsen. Während es für Haushalte teurer wird, wenn sie sich Geld ausleihen müssen, freuen sich jene, die Geld zum Verleihen haben.
Hohe Zinsen drosseln die Wirtschaft, sodass mehr Menschen arbeitslos werden. Die Verhandlungsmacht der Arbeiter:innen wird schwächer. Zuletzt zählt Mattei auch eine staatliche Industriepolitik zur Austerität, die gezielt den "Arbeitsfrieden" zugunsten der Unternehmer sichert. Indem Gewerkschaften geschwächt, Streiks unterdrückt und der Arbeitsmarkt dereguliert wird.
Eine Frage der Macht, nicht der Wirtschaft
"Austerität ist ein wichtiges Bollwerk zur Verteidigung des kapitalistischen Systems", fasst Mattei ihre Untersuchung zusammen. Sie zementiert die "Ordnung des Kapitals" ein. Also das Machtgefälle zwischen Unternehmern und Kapitalgebern einerseits und all jenen, die für sie arbeiten andererseits.
Dass diese Politik in den 1920ern entstand, als eine wirtschaftsdemokratische Alternative zum Greifen nahe schien, ist kein Zufall. Deshalb war es nicht einfach, sie durchzusetzen. Wieso sollten italienische und britische Arbeiterinnen und Arbeiter ihre Träume begraben, die gerade noch mit kollektiven Produktionsweisen experimentiert hatten?
Passende Ideologie
Um die Zustimmung für die Sparpolitik zu erlangen, wurde die neoklassische Sicht der "reinen Ökonomik" verbreitet. Sie versteht Wirtschaft als ein System der Naturgesetze. Sein Motor ist der Unternehmer, der spart und investiert.
Arbeiter:innen hingegen werden hier zu "unproduktiven Verbrauchern", so Mattei. Ihr Konsum und ihre Löhne müssten niedrig gehalten werden, um die Inflation zu zähmen, die Produktion anzukurbeln und das Land wettbewerbsfähig zu machen.
In solch einer Welt gibt es keine Interessenskonflikte. Ökonomie ist dann eine Sache der Expert:innen – und nicht des Volkes, das die Wirtschaft nach seinen Wünschen formt. Denn: Das würde lediglich die angeblichen Naturgesetze des Marktes stören.
Gehts den Industriellen gut, gehts uns allen gut
Auch heute ist dieses Denken noch tonangebend. Ökonomische Zwänge werden behauptet, um die Interessen der Unternehmer:innen als Allgemeinwohl zu verkaufen. In diesem Sinne haben hierzulande zuletzt Industriellenvereinigung und Wirtschaftsforschungsinstitute Lohnzurückhaltungen und eine Senkung der Lohnnebenkosten gefordert.
Das überzeugt die Menschen jedoch nicht immer. Matteis Analyse zeigt: Um Austerität durchzusetzen, wurden historisch nicht nur Argumente, sondern auch Zwang verwendet. In Italien unterdrückten erst faschistische Trupps, dann der faschistische Staat die Arbeiterschaft. 1922 stimmte Benito Mussolini sie bei seiner ersten Parlamentsrede auf "Sparsamkeit, Arbeit, Disziplin" ein. Im liberaldemokratischen Großbritannien zwang der Markt die Arbeiterschaft ganz ohne Schlägertrupps in die Knie: "Die Abschaffung von Sozialprogrammen zwang die Mehrheit zum Sparen", schreibt Mattei und ergänzt: Es "setzte ein Überlebensinstinkt ein, der Streiks verhinderte, Forderungen nach höheren Löhnen unterband und alle Arten von aufmüpfigem Verhalten zurückhielt".
Demokratie oder Faschismus? Hauptsache Macht
Matteis Pointe ist folgende: Wenn die Herrschenden ihre Macht mit Austeritätspolitik sichern, ist es ihnen herzlich egal, ob liberale Demokrat:innen oder Faschist:innen ihnen dabei helfen. Während Liberale sich oft als Bollwerk gegen den Faschismus verstehen, störten sie sich nicht an Mussolinis wirtschaftspolitischem Durchgreifen. Sie bejubelten es sogar.
Auch heute legen die Wirtschaftsprogramme der europäischen Rechten diese mögliche Allianz nahe. So war es in Österreich etwa die Industriellenvereinigung, die sich nach der Nationalratswahl hinter den Kulissen für eine Koalition der ÖVP mit der FPÖ einsetzte.
Austerität wird Normalzustand
Die Geschichte der Austerität zieht sich bis heute durch. Und doch hat sich etwas geändert. Sie hat sich von ihren kämpferischen Ursprüngen entfernt und sich als zeitloses Dogma in den Institutionen verewigt. Etwa in den strengen Schuldenregeln der EU. Das bedeutet: Sie wirkt auch dann, wenn der Kapitalismus ohnehin fest im Sattel sitzt.
Die heutigen Sparmaßnahmen in Österreich sind keine Reaktion auf eine Krise des Kapitalismus – sondern Beweis seiner Stärke. Austeritätspolitik gilt als derart alternativlos, dass es gar keine große Diskussion darüber gibt, in wessen Interesse sie ist.
Die Wut auf das System
Was nun spannend bleibt, ist etwas, das Mattei außen vorlässt – aber ungewollt anregt. Der Untertitel des Buches lautet irreführend: "Wie Ökonomen die Austerität erfanden und dem Faschismus den Weg bereiteten". Gemeint ist damit lediglich: Der italienische Faschismus war eine für manch Mächtige willkommene Gelegenheit, harte Sparpolitiken durchzusetzen. Intuitiv versteht sich der Untertitel jedoch anders: Austerität untergräbt die Lebensgrundlage vieler Menschen, ihre Wut auf "die da oben" wird schlussendlich von Rechten mobilisiert.
In genau dieser Situation befindet sich Österreich bereits seit Längerem. Von Unzufriedenheit mit der Lage profitiert meist die FPÖ. Die kommende Austeritätswelle könnte das nun verstärken. Dabei hat die FPÖ in den Verhandlungen mit der ÖVP schon die Grundlage für das aktuelle Budget geschaffen. Während man schlussendlich erfolglos um eine Regierung verhandelte, schickte man im Prinzip den heutigen Sparplan nach Brüssel. Die spätere Dreierkoalition änderte daran eher nur Details.
Ist der Faschismus also nicht nur ein gutes Mittel für die Gewinner:innen der Austeritätspolitik, sondern – zumindest aus Sicht liberaler Ökonomen – auch eine ungewollte Nebenwirkung? Auf diese Frage antwortet Mattei bei ihrer Lesung in Wien:
"Das ist die andere Seite der Geschichte. Rechte Politiker bieten den Menschen einen Sündenbock für die Entbehrungen, die sie tagtäglich erleben. Sie gerieren sich als „starker Mann“, der diese Probleme löst. Jedoch werden sie nur mit weiterer Austerität reagieren. Es ist ein Teufelskreis."
Diesen Zusammenhang haben bereits mehrere Studien bewiesen.
SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer, vormals als linker Ökonom bekannt, sollte sich solcher Gefahren bewusst sein. Jüngst warnte er gar vor einem „Teufelskreis“ der Sparpolitik. Mehr Einsparungen würden die Konjunktur schwächen, was letztlich das Defizit erhöhen würde. Dennoch stimmte er die Bevölkerung nun auf "zwei harte Jahre" ein. Unklar ist also, ob und wie er den Teufelskreis durchbrechen will und ob seine Regierungskonstellation dazu bereit ist.
Noch wichtiger ist aber: Die Politik verbleibt bisher in der Logik, die Mattei kritisiert: Austerität ist nicht nur schlechte Wirtschaftspolitik, sondern Klassenpolitik von oben. Und die begünstigt außerdem die autoritäre Wende der Gesellschaft. Ob die Regierung also neben dem Teufelskreis der abgewürgten Konjunktur auch diesen zweiten, viel gefährlicheren Teufelskreis des Autoritarismus erkennt: Danach sieht es nicht aus.