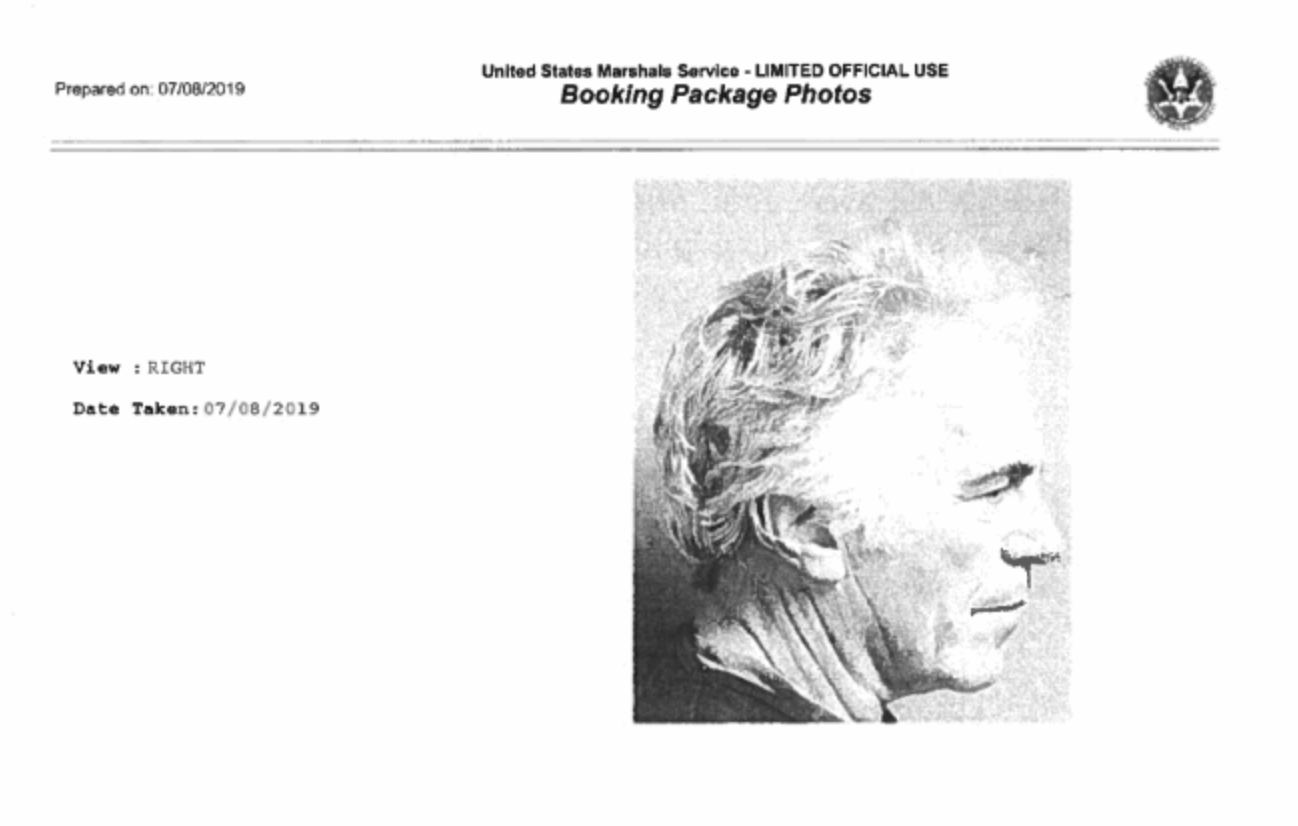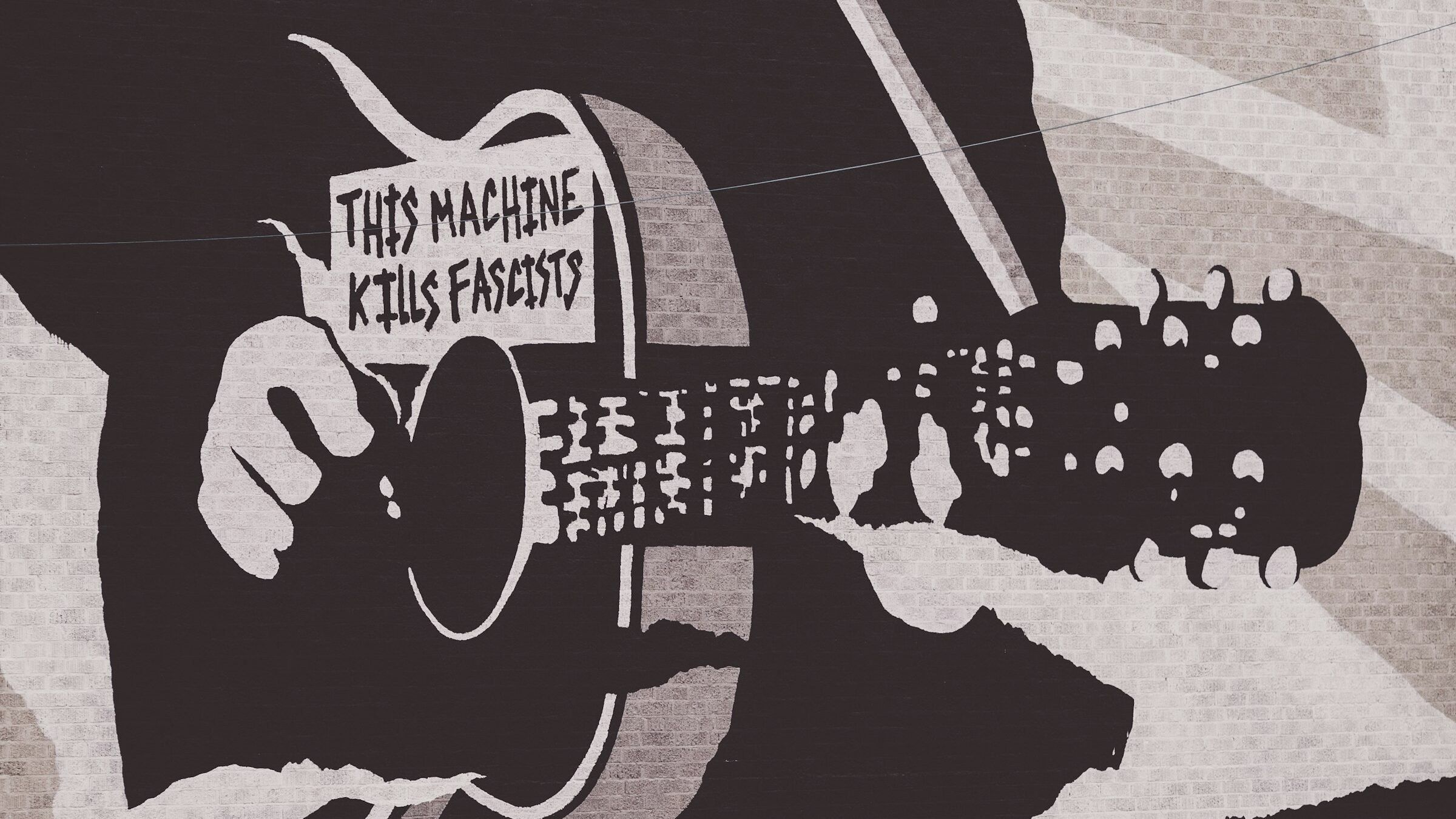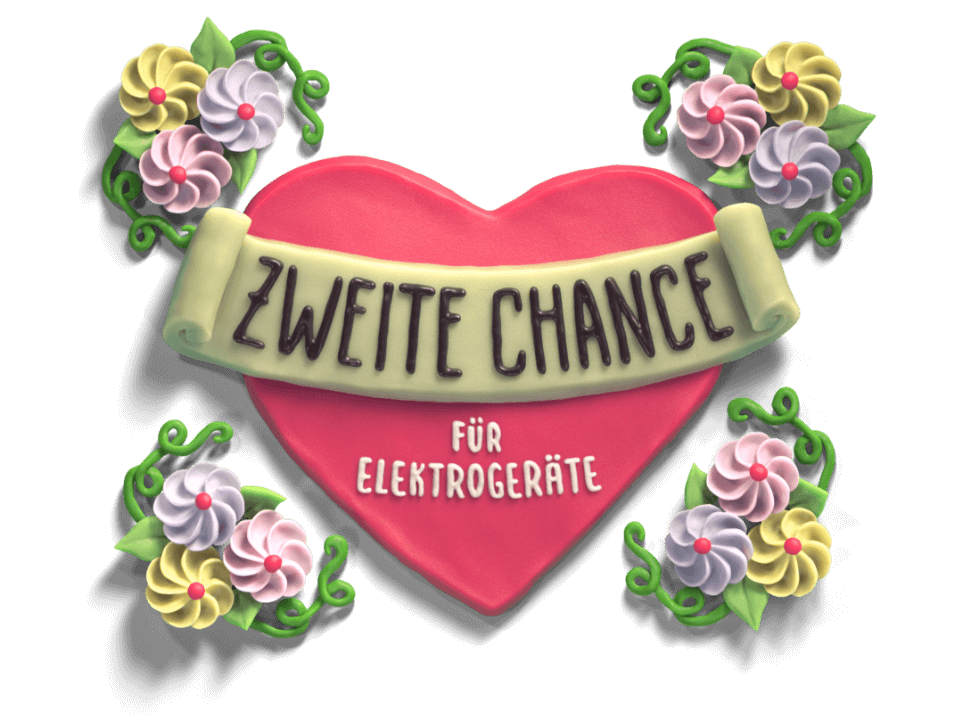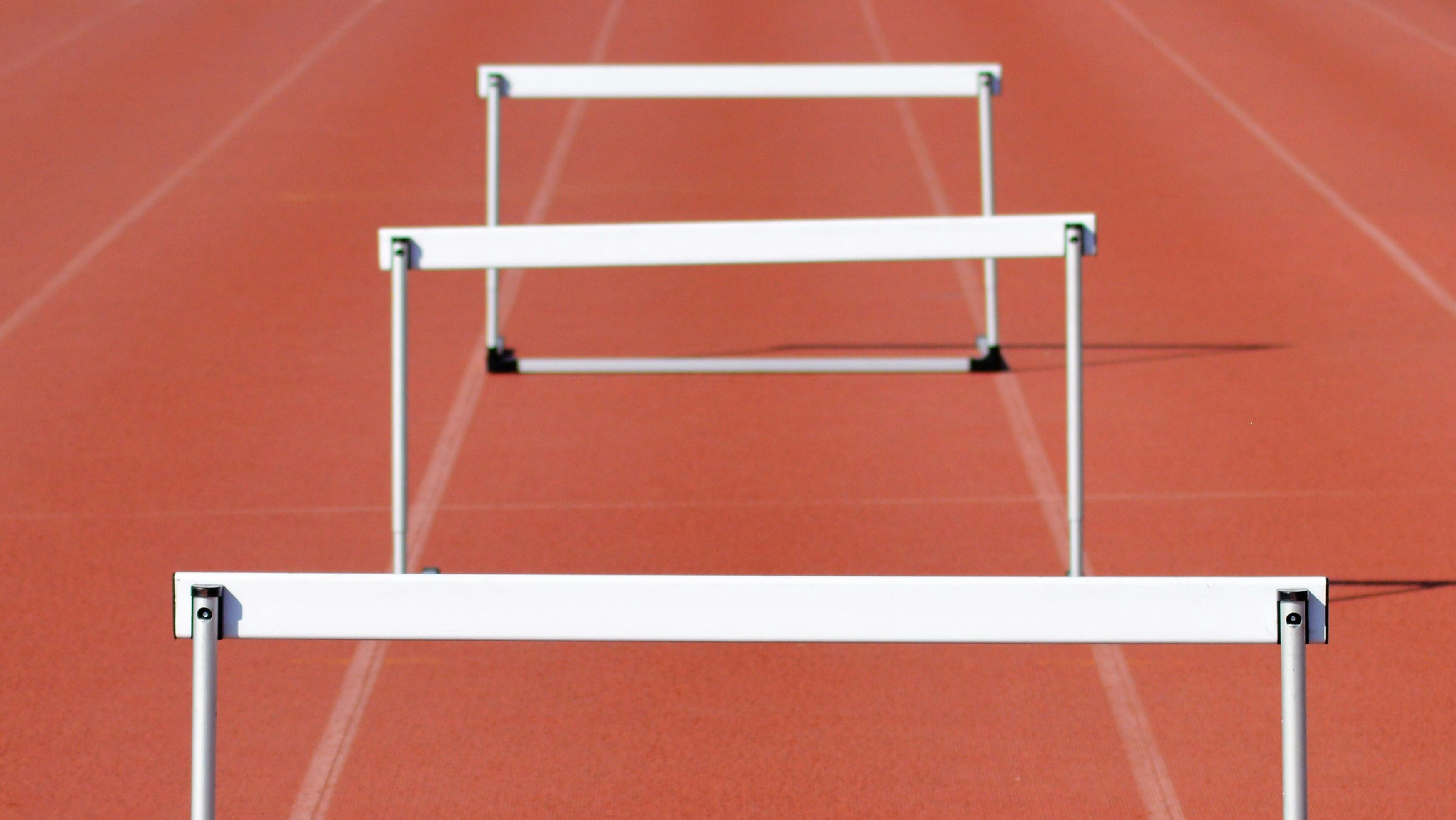Corona als Gefahr für die Demokratie? "Was jetzt selbstverständlich ist, darf kein Dauerzustand werden"

Lara Möller, Politikwissenschafterin an der Uni Wien, darüber, was die Corona-Krise politisch mit uns und unserer Gesellschaft macht.
In Österreich, Deutschland oder Frankreich ist das –zum Glück – anders. Auch wenn die Möglichkeiten des parlamentarischen Handelns aktuell stark eingeschränkt sind, bleiben auch in der Krise alle formellen demokratischen Entscheidungswege aufrecht.
Und trotzdem hängen auch wir täglich vor dem Fernseher und schauen gebannt auf die starken Männer hinter den Mikrophonen, die uns bitte aus der Situation herausbringen sollen. Was macht das mit uns als Gesellschaft? Ein Anruf bei Lara Möller, Politikwissenschaftlerin an der Uni Wien und am Demokratiezentrum Wien.
MOMENT: Lara, was machen Krisen mit uns und unserer Demokratie?
Lara Möller: Grundsätzlich fordern Krisen wie jetzt die Demokratie auf sehr vielen Ebenen heraus: gesellschaftlich, politisch, sozial, wirtschaftlich, ökologisch. In tiefgreifenden Krisen lösen sich gewohnte Strukturen auf, es kommt zu Entgrenzung und Individualisierung. Der Sozialwissenschaftler Wilhelm Heitmeyer hat die 2000er Jahre zum Beispiel als das „entsicherte Jahrzehnt“ bezeichnet: Bestimmte Signalereignisse wie die Terrorangriffe von 9/11, die deutsche Hartz IV-Reform oder die Wirtschafts- und Finanzkrise haben die Zukunftssorgen ansteigen lassen. Das befördert die Akzeptanz autoritärer Tendenzen. Auch jetzt erleben wir gerade eine Art Entsicherung, zumal kein Endpunkt in Sicht ist.
MOMENT: Was ist das Besondere an dieser Krise?
Möller: Sie trifft uns alle. Eine Herausforderung in dieser Form hat es seit 1945 wahrscheinlich nicht mehr gegeben. Andererseits trifft uns die Krise aber eben auch nicht alle gleich: Die soziale Ungleichheit zeigt sich gerade für manche in einem existenzbedrohenden Ausmaß. Das Leben verschiebt sich aus dem öffentlichen komplett in den privaten Raum. Das heißt aber nicht, dass Probleme wie Gewalt, Sexismus, oder Rassismus verschwunden sind. Sondern sie existieren im privaten Bereich weiter, verstärken sich tendenziell und entziehen sich mehr oder weniger der öffentlichen Aufmerksamkeit. Und auch der Begriff „Solidarität“ wird anders definiert.
Demokratie ist nicht nur eine Staats-, sondern auch eine Lebensform, die sich durch zivilgesellschaftliches Handeln auszeichnet.
MOMENT: Inwiefern?
Möller: Solidarität bedeutet gerade vor allem Rückzug und Abschottung. Das entspricht eigentlich eher dem Gegenteil von einem demokratischen Selbstverständnis. Die Gefahr ist, dass Solidarität gerade vor allem unter gleichgesinnten oder gleichen sozialen Milieus stattfindet. Solidarität muss aber altruistisch sein, für alle gelten und manchmal auch wehtun. Sie darf beispielsweise die Zustände in den Geflüchtetenlagern in Griechenland nicht ignorieren. Die Gefahr ist, dass wir diejenigen, die eh schon unsichtbar waren, noch schutzloser machen.
MOMENT: Welche demokratiepolitischen Herausforderungen ergeben sich aus dem Ganzen?
Möller: Demokratie ist nicht nur eine Staats-, sondern auch eine Lebensform, die sich durch zivilgesellschaftliches Handeln auszeichnet. Jetzt sind aber grundlegende Freiheitsrechte ausgehebelt – zum Beispiel die Versammlungsfreiheit. Eine starke Demokratie muss gelebt werden, und das ist derzeit nicht möglich. Die Frage, die sich stellt: Kann Demokratiepraxis einfach nur institutionell verwaltet werden? Und wenn, wie lange? Die Herausforderung ist, dass eine Gesellschaft in eine „Anomie“, in das Gefühl der politischen Orientierungsosigkeit und Machtlosigkeit verfallen kann und keine gemeinsame Handlungsmacht mehr spürt.
MOMENT: Wir erwarten von der Politik, dass sie uns aus dieser Krise herausbringt. Befördert das autoritäre Tendenzen?
Möller: Es ist die Frage, wie man autoritär versteht, das ist ein zwiespältiger Begriff. PolitikerInnen wirken aktuell als die durchgreifenden EntscheiderInnen und geben Hoffnung, dass sie bei einer Krise sehr schnell handeln und Entscheidungen treffen können. Gleichzeitig wird dabei aber nicht nur der öffentliche Raum bestimmt, sondern die Entscheidungen greifen bis in den privaten Bereich. Demokratisch findet in Bezug auf autoritäre Tendenzen ein sehr „hegemonialer“ Moment statt: Menschen akzeptieren Herrschaft grundsätzlich in der Not und empfinden sie als legitimiert. Wer dies nicht tut wird womöglich sanktioniert.
MOMENT: Man könnte da einwerfen: Das muss halt alles jetzt sein.
Möller: Natürlich leisten alle diese Maßnahmen etwas. Es werden Leben gerettet. Aber was jetzt als selbstverständlich gilt, darf kein Dauerzustand werden. Die Politik muss auch reflektieren und transparent machen, was sie warum tut.
MOMENT: Hat es auch problematische Aspekte, dass wir gerade alle gebannt zu den Wissenschaftlern blicken? Aktuell werden wir „von Virologen regiert“, hat der Spiegel vor ein paar Tagen geschrieben.
Möller: Wir tun das aktuell zu Recht. Virologen haben Wissen und Erfahrung, die andere nicht haben. WissenschaftlerInnen haben gerade die Rolle einer positiven, professionellen Autorität, im Moment vor allem die MedizinerInnen. „Autorität und Freiheit sind keineswegs Gegensätze“, hat Hannah Arendt geschrieben. Aber Wissenschaft darf nicht zu technokratisch werden, sondern muss im kritischen Diskurs bleiben. Auch WissenschaftlerInnen aus anderen Bereichen müssen sich in die Debatte einbringen.
MOMENT: Was können wir tun, um aus der Krise nicht mit einer beschädigten Demokratie herauszukommen?
Möller: Für mich sind mehrere Dinge entscheidend: Wir dürfen als Zivilgesellschaft nicht in Anomie verfallen, sondern müssen uns Wege zur kollektiven Gestaltung und die Handlungsfähigkeit bewahren. Wir müssen auch in der Krise Transparenz einfordern und über alternative Lösungswege diskutieren. Wir dürfen das Private nicht entpolitisieren: Häusliche Gewalt, die Lage von Menschen mit Beeinträchtigungen, der eventuelle Anstieg der psychischen Erkrankungen, das dürfen wir alles nicht aus dem Blick verlieren. Und wir müssen darüber nachdenken, wie wir die Barrieren, physische wie auch im Kopf, nach der Krise schnell wieder loswerden. Der Zustand der nationalen Abschottung darf in der Zeit nach der Krise nicht fortgeführt werden.