Der Staat hat kein Ausgabenproblem – sondern ein Gerechtigkeitsproblem
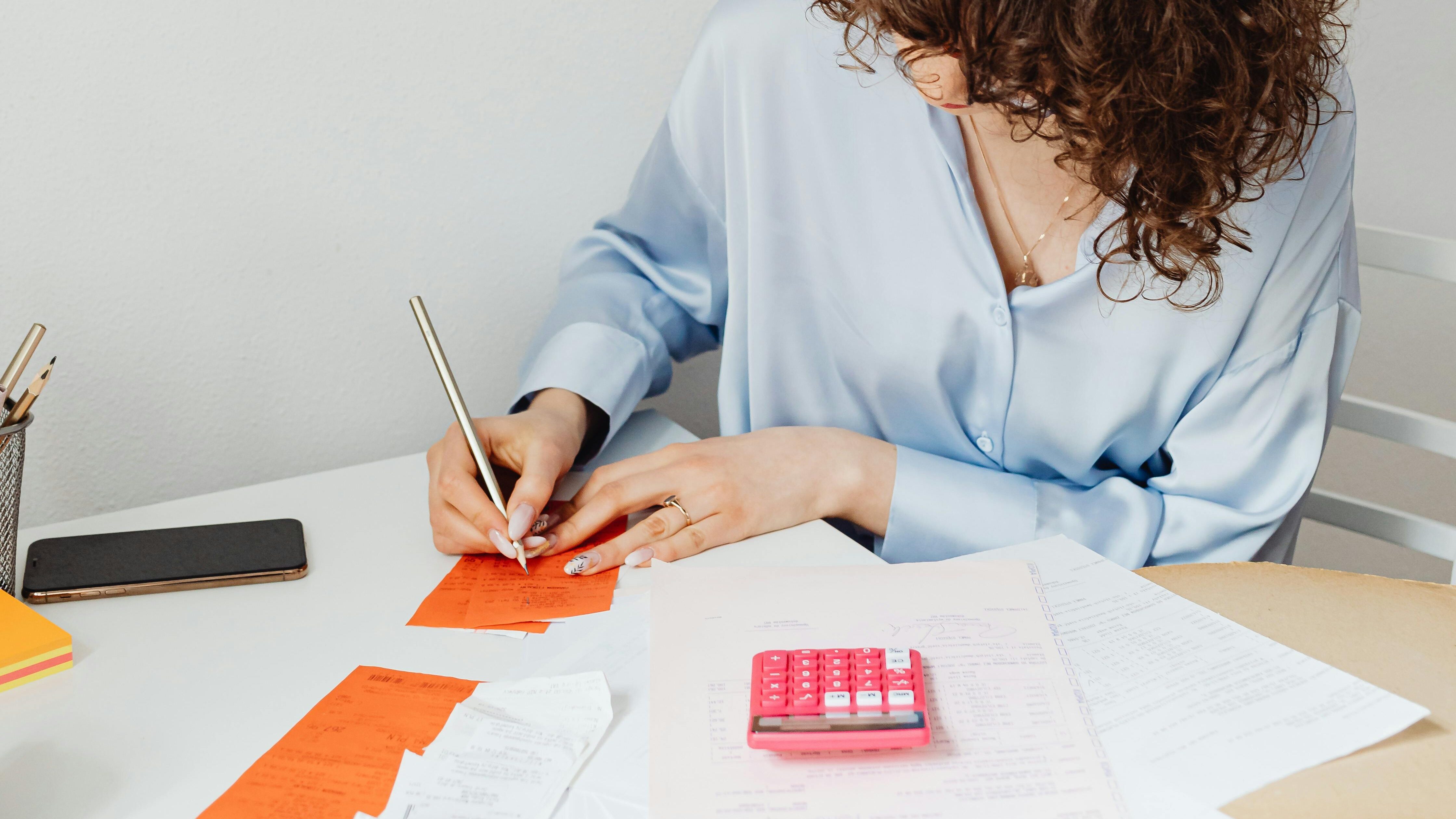
Die Regierung plant ein milliardenschweres Sparpaket: Allein heuer sollen 6,3 Milliarden Euro eingespart werden. In der öffentlichen Debatte ertönt dabei ein altbekanntes Mantra: „Der Staat hat kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem.“ Diese einfache Formel klingt griffig, ist aber irreführend – und gefährlich.
Von wegen „gieriger Staat“ – wofür wir wirklich zahlen
Denn: Von welchen Ausgaben sprechen wir eigentlich? In Österreich geht jeder zweite Euro durch die Hände des Staates. Daraus pinseln Marktradikale gerne ein Zerrbild vom „gierigen Staat“. Der ziehe den Bürger:innen das Geld aus der Tasche und lasse es in einem undurchsichtigen System verschwinden. Aber wenig könnte weiter von der Realität entfernt sein.
Die Steuern und Abgaben finanzieren das, was unsere Gesellschaft am Laufen hält: Krankenhäuser, Schulen, Pflege, Pensionen, Kindergärten, den sozialen Wohnbau, Polizei, Feuerwehr oder den öffentlichen Verkehr. All das sind keine Luxusgüter – es sind öffentliche Güter, die unser aller Leben sichern. Wer nach weniger Staatsausgaben ruft, ruft nach weniger von alldem.
Weniger Staat bedeutet mehr soziale Kälte
Ein schlanker Staat bedeutet nicht, dass das Leben für uns günstiger wird. Im Gegenteil: In Ländern mit schwachen Sozialstaaten kaufen Menschen privat zu, was bei uns staatlich bereitgestellt wird. Das ist oft teurer und weniger effizient.
Wer sich Privatschulen, Spitzenmedizin und private Pensionsvorsorge problemlos leisten kann, kommt auch mit weniger Staat klar. Doch der Großteil der Bevölkerung ist auf ein funktionierendes öffentliches System angewiesen. Bildung, Gesundheit und soziale Absicherung entscheiden über Lebenschancen – gerade für jene, die nicht reich geboren werden.
Ein funktionierender Sozialstaat sichert Stabilität
Österreichs Staatsquote liegt ein wenig über dem EU-Durchschnitt, ja. Aber das liegt nicht an Verschwendung, sondern am gut ausgebauten Sozialstaat.
Reiche und stabile Gesellschaften wie Dänemark oder Schweden zeigen: Ein starker Staat sorgt für Wohlstand und Sicherheit. Länder mit niedriger Staatsquote – Somalia, Haiti, Venezuela – sind geprägt von Armut, Instabilität und Gewalt.
Natürlich kann und muss der Staat seine Ausgaben überprüfen. Aber die Idee, man könne sich aus einer Krise „heraussparen“, ist gefährlich und historisch widerlegt. Mehr noch: Wer soziale Leistungen kürzt, spart sich die Demokratie kaputt. Denn eine gerechte Gesellschaft ist auch eine stabile Gesellschaft.
Das Märchen vom Ausgabenproblem – eine politische Strategie
Die ständige Erzählung vom „Ausgabenproblem“ ist kein Zufall. Sie lenkt gezielt vom eigentlichen Kern der Debatte ab: der ungleichen Verteilung der Staatseinnahmen. Wer immer nur über zu hohe Ausgaben spricht, redet eben nicht darüber, dass Vermögen und Kapital vergleichsweise geschont werden und die Hauptlast der Finanzierung auf Arbeitseinkommen und Konsum liegt.
Doch es steckt noch mehr dahinter: Wer den Staat systematisch als „gieriges Monster“ darstellt, bereitet den Boden für Kürzungen beim Sozialstaat. Denn wenn der Staat als verschwenderisch und ineffizient gilt, lassen sich Einschnitte bei Pensionen, Gesundheit oder Bildung leichter politisch durchsetzen.
Die neoliberale Strategie dahinter ist klar: Ein schwächerer Staat überlässt zentrale Bereiche dem Markt – und damit jenen, die von Privatisierung und Deregulierung profitieren. So wird der Sozialstaat nicht nur abgebaut, sondern auch die Machtverhältnisse verschoben – weg von der Gesellschaft, hin zu großen Vermögen und Konzernen.
Das wahre Problem liegt auf der Einnahmenseite
Tatsächlich hat Österreich ein Einnahmenproblem. Während Arbeitseinkommen und Konsum hoch besteuert werden, bleiben Vermögen und große Unternehmensgewinne verschont. Wer es mit Effizienz und Fairness ernst meint, muss auch die Einnahmenseite neu denken. Es kann nicht sein, dass die breite Masse die staatlichen Leistungen finanziert, während Spitzenvermögen kaum zur Kassa gebeten werden.
Klimakrise, Pflegenotstand, Teuerung: Die Herausforderungen unserer Zeit verlangen einen handlungsfähigen Staat. Wer reflexhaft nur von Ausgabenkürzungen spricht, blendet aus, dass die beste Investition in eine stabile und gerechte Zukunft die Ausgaben sind, die wir als Gesellschaft gemeinsam schultern. Ein gerechter Staat kostet etwas – aber Ungerechtigkeit kommt uns alle viel teurer.









