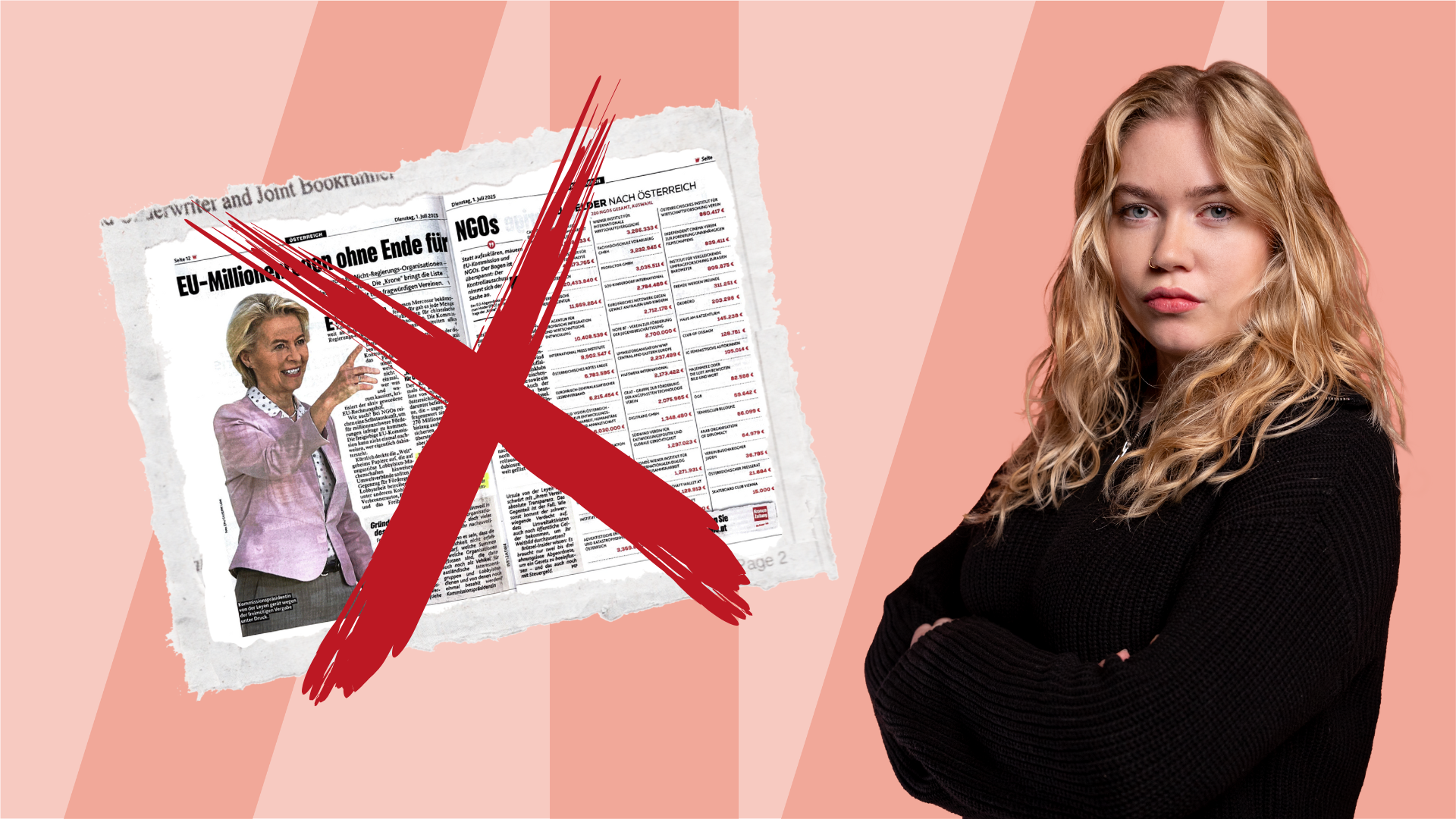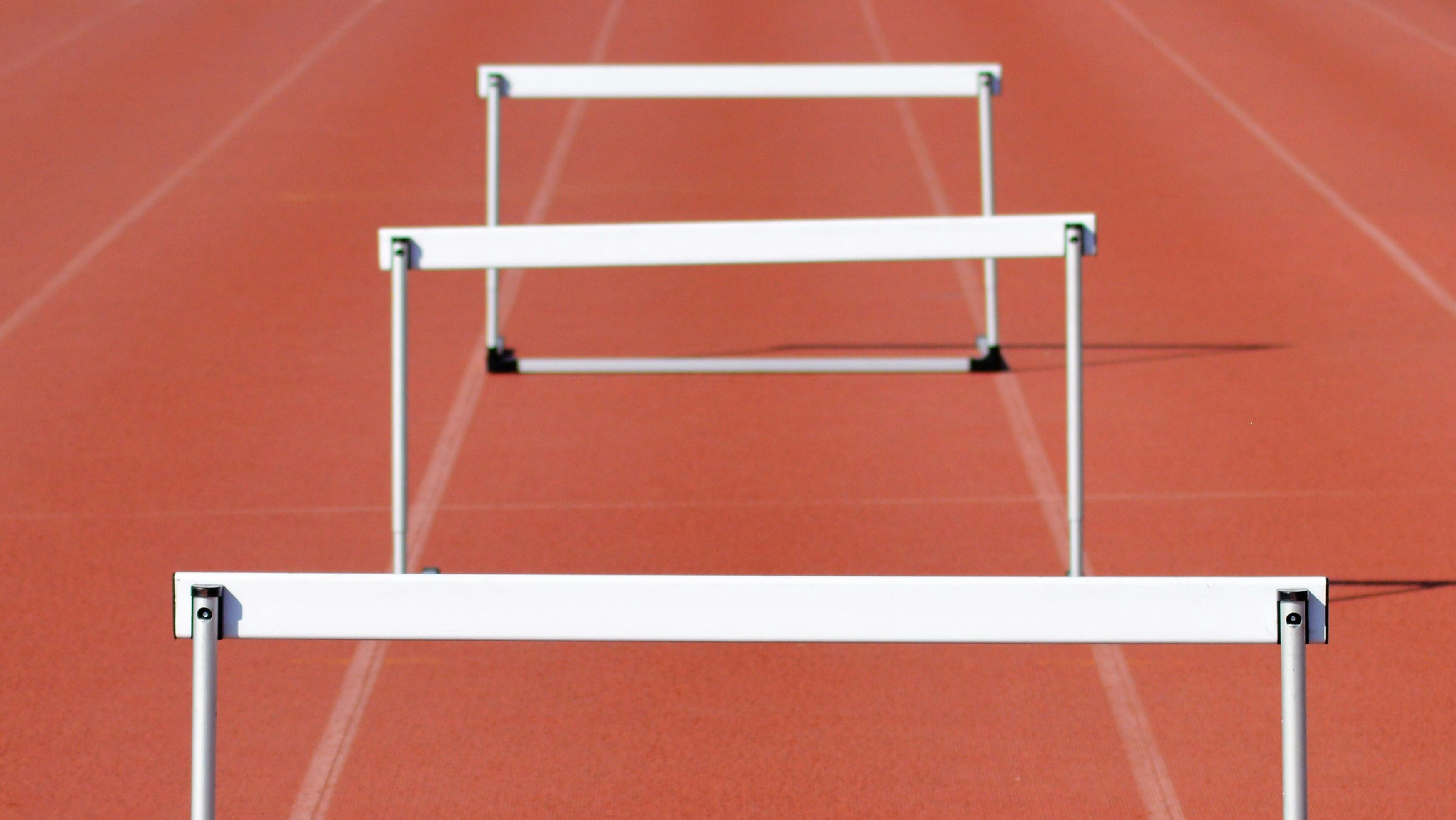Wut statt Verständigung: Ingrid Brodnig über die Verrohung öffentlicher Debatten

MOMENT.at: Ihr Buch verfolgt die These, dass politische Debatten immer roher werden. Was genau bedeutet das? Woran erkennt man diese Verrohung?
Ingrid Brodnig: Verrohung ist ein Spektrum. Die extremste Form sind Angriffe auf Politikerinnen und Politiker. Beispielsweise in Deutschland, als der SPD Politiker Matthias Ecke beim Aufhängen eines Wahlkampfplakats brutal niedergeschlagen wurde. Dann gibt es Beleidigungen, auch in Österreich. In der Politik wird mit einer Härte gesprochen, die für viele Menschen am Arbeitsplatz undenkbar wäre. Drittens werden Debatten schnell zur Entgleisung gebracht. Man landet von harmlosen Vorfällen in den wildesten Debatten.
Ein Beispiel. Vergangenes Jahr hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung überlegt, zu empfehlen, weniger Fleisch zu essen. Die Bild-Zeitung hat prompt getitelt, es solle für Deutsche nur noch eine Currywurst pro Monat geben. Als Nächstes hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder getweetet, ob denn wirklich alles verboten werden muss. Anstatt ernsthaft über eine Empfehlung zu diskutieren, ging es schließlich darum, warum alles verboten wird. Obwohl gar nichts verboten wurde. Man kann schwer diskutieren, wenn man plötzlich in so furchtbar emotionalisierten Schwarz-Weiß-Debatten landet.
MOMENT.at: Politiker:innen haben schon immer bewusst emotionalisiert. Was ist heute anders?
Brodnig: Es gibt zwei Unterschiede. Der erste ist Social Media, die Digitalisierung. Über das Internet kommen Menschen stärker mit Inhalten in Kontakt, die Wut, Ekel, das Gefühl, etwas moralisch Verwerfliches wäre passiert, auslösen. In einer Studie wurde verglichen, wie Menschen in Kontakt mit empörendem Material kommen, je nachdem, über welche Kanäle sie informiert werden. Persönliche Gespräche, etablierte Kanäle wie Print, Radio, TV oder über das Internet. Im Internet steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man sich aufregen muss.
Zweitens leben wir in einer Zeit, in der der Rechtspopulismus und rechtsextreme Argumente sehr sichtbar sind. Das sind Weltanschauungen, die von einer Schwarz-Weiß-Rhetorik profitieren und selbst eine Schwarz-Weiß-Rhetorik nutzen. Rechtspopulismus ist, zu sagen, wir sind die einzige Partei, die das Volk vertritt. Da ist schon die Annahme enthalten, das Volk wäre eine einheitliche Gruppe, in der alle die gleichen Interessen haben. Was eben nicht stimmt. Das ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Also auch diese politische Entwicklung führt zur Verrohung der Debatte.
MOMENT.at: Sie haben das jetzt schon teilweise beantwortet, aber wer befeuert diese Verrohung? Wem nützt das, wenn wir uns nur noch anschreien?
Brodnig: Populismus profitiert eindeutig von Zuspitzung und schlechten Manieren. Es gibt sogar Wissenschaftler, die der Ansicht sind, dass schlechte Manieren ein Wesensmerkmal von populistischer Rhetorik sind. Weil man damit Aufmerksamkeit erregt.
Es wäre aber ein bisschen simpel zu sagen, es sind nur die Populist:innen, die so draufhauen. Man sieht oft auch Politiker:innen aus anderen Lagern, die eine derartige Rhetorik an den Tag legen. Eine kommunikationswissenschaftliche Untersuchung zeigt, dass Politiker:innen, die eine populistische Rhetorik anwenden, besseres Feedback auf Social Media bekommen – auch im Sinne größerer Reichweite. Das galt auch für Personen aus nicht klassisch populistischen Parteien. Dazu tragen klassische Medien bei. Auf Twitter gepostete Provokation werden auch prompt in klassischen Medien zitiert. Provokation und populistische Sprache werden nicht nur auf Social Media, sondern auch in den klassischen Medien mit Reichweite belohnt.
MOMENT.at: Und wer verliert dabei?
Brodnig: Ich glaube, die Sachdebatte verliert, also letztlich wir als Gesellschaft. Zu jeder Zeit – und das gehört zu einer Demokratie dazu – wurde gestritten. Es zeichnet eine Demokratie aus, dass es unterschiedliche Sichtweisen und Meinungen gibt, einen Pluralismus. Dann darf man auch lautstark Argumente austauschen. Aber es gibt eine Grenze, wenn die Lautstärke den Inhalt überdeckt. Gerade wenn Debatten in derartiger Zuspitzung und Überdramatisierung und Schwarz-Weiß-Trennung landen, dass sie eigentlich ein bisschen Scheindebatten werden. Wenn es zum Beispiel heißt, es geht um ein Verbot, obwohl niemand etwas verbieten will.
Es geht dann um Scheindebatten anstatt beispielsweise über die wichtigen Fragen der Klimakrise. Da sollten wir ernsthaft darüber reden – was kann ich machen, was müssen wir wirtschaftlich und politisch umstellen? Wenn dann plötzlich über Verbote geredet wird, die es gar nicht gibt, kommt man weg vom Sachthema. Dann fehlt die Möglichkeit, Kompromisse zu finden.
Wir hätten viele wichtige soziale, politische, gesellschaftliche Fragen zu beantworten.
MOMENT.at: Also könnte man eigentlich sagen, wir verlieren alle dabei?
Brodnig: Genau. Ich glaube interessanterweise auch, dass das über viele Lager hinweg Menschen irritiert. Und ich glaube, wir sind oft selbst Teil des Problems. Weil wir alle so emotionale Wesen sind, und leichter bei Themen reagieren, die aufregen, wo man schnell ja oder nein sagen kann.
Gleichzeitig glaube ich aber, dass das viele Menschen irgendwo merken. Dass viele denken: Eigentlich gefällt es mir, wenn ich mich nüchtern hinsetzte und ganz ruhig darüber nachdenke. Nicht, wenn Debatten in so einer harten Stimmung landen, wo man dann auch wenig bewirken kann. Ich glaube, dass viele Menschen auch in Alltagsbeobachtungen merken, dass sehr viel Wut in politischen Debatten aufkommt. Aber nicht eine Wut, die etwas löst. Eher eine, wo man sich dann unversöhnlich gegenübersteht. Also die Empörung über verrohte Debatten haben, glaube ich, viele schon gespürt.
MOMENT.at: Warum funktioniert Wut jetzt eigentlich so gut, um Aufmerksamkeit zu erregen?
Brodnig: Manche Emotionen sind besonders aktivierend. Wut – das fällt immer wieder in Untersuchungen auf – ist eine stark aktivierende Emotion. Wer Wut schürt, bekommt oft mehr Aufmerksamkeit. Wenn ich es in meinem politischen Lager schaffe, Wut über die andere Seite zu schüren, steigt die Chance, dass Leute auch zur Wahl gehen, mich wählen, mir vielleicht Geld spenden. Wut schüren zahlt sich für politische Akteur:innen aus.
Hinzu kommt, Wut führt oft dazu, dass wir nicht unbedingt Gegenargumente hören wollen, und erst recht auf unserem bestehen. Wer wütend ist, hat vielleicht gerade keinen Nerv, sich die Komplexität mancher Themen durch den Kopf gehen zu lassen. Wütende Menschen machen es sich vielleicht auch argumentativ etwas leichter, werden schlimmstenfalls auch für Falschmeldungen anfälliger.
MOMENT.at: Aber Wut kann auch angebracht sein.
Brodnig: Das ist wichtig. Wut ist nicht unbedingt schlecht. Man kann über tatsächliche Missstände wütend sein. Wären Frauen nicht wütend gewesen, hätten sie sich nie das Wahlrecht erkämpft. Emotionen erfüllen einen Zweck, aber Emotionen sind teilweise auch leicht auslösbar. Wut ist sehr leicht auslösbar, teilweise auch mit zugespitzten oder falschen Behauptungen.
Wir haben auch Antwortmöglichkeiten. Leute können lernen, reflektierter mit der eigenen Wut umzugehen, achtsam wütend zu sein. Indem man sich, wenn man wütend ist, überlegt, ob man wirklich auf etwas antworten will. Ist mir das Thema wichtig? Oder werde ich wieder in eine Debatte hineingejagt, wo ich dann Zeit und Energie mit etwas Unwichtigem verschwende?
MOMENT.at: Kann man mit anderen Emotionen dagegen halten?
Brodnig: Man kann auch gesellschaftlich und politisch andere Emotionen nutzen. Untersuchungen mit Ländervergleichen haben gezeigt, dass es sogar eine breite Palette von Emotionen gibt, die etwa mit einer höheren Anzahl von Shares einhergehen. Darunter waren beispielsweise auch Stolz, Belustigung, oder Kama Muta. Kama Muta ist das Gefühl des Gerührtseins. Wenn man niedliche Tiervideos sieht, kann man gerührt sein. Aber auch politisch können Menschen gerührt sein. Wenn sie sehen, es gibt eine Gefahr oder ein Problem, aber wir können das gemeinsam lösen. Das ist für mich spannend – ich kann auch als Antwort auf die Verrohung schauen, dass wir sehr wohl in einer emotionalen Debatte bleiben. Aber eine emotionale Debatte, in der ich nicht sage, alles ist schlimm oder die da drüben sind schlecht. Sondern in der ich sage, wir gemeinsam lösen jetzt das Problem, und wir lassen uns auch durch dieses Gefühl der Gerührtheit dazu hinreißen, das gemeinsam umzusetzen.
MOMENT.at: Sie haben schon angesprochen, dass Wut teilweise auch eine verständliche und notwendige Reaktion ist. Wie erkennt man dann aber, wenn zu viel emotionalisiert wird?
Brodnig: Manchmal kann man selbst erkennen, ob man so wütend ist, dass man noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen sollte, bevor man reagiert. Die Kommunikationswissenschaftlerinnen Diane Grimes und Whitney Phillips haben Tipps dazu zusammengefasst. Dass man beispielsweise den eigenen Körper scannen kann. Wenn ich ganz verkrampft bin, bei mir ziehen sich alle Muskeln zusammen, ist das vielleicht ein Zeichen, dass ich gerade sehr, sehr wütend bin. So wütend, dass ich mir noch etwas Zeit nehmen sollte, ehe ich etwas poste. Ich kann auch in einem persönlichen Gespräch sagen ‚du, ich merke, das regt mich gerade sehr auf, lass mich das noch ein bisschen bedenken.‘
Die Frage ist auch gesellschaftlich. Wir sollten gesellschaftlich Methoden finden, andere zu belohnen als die, die blinde Wut schüren. Damit meine ich auch, dass Medien nicht nur schauen sollten, ob etwas ein Aufregerthema ist, sondern auch, wem sie wie viel Sichtbarkeit geben. Und, ob wir uns in eine Debatte hineinführen lassen, die inhaltlich wenig Erkenntniswert hat.
Donald Trump nutzt oft Beleidigung, auch persönliche Beleidigungen. Er will damit Sichtbarkeit für sich selbst, aber auch jemand anderen beim eigenen Publikum schlecht reden. Man kann das durchaus aufgreifen. Anstatt es eins zu eins zu wiederholen, sollte man es aber auch einordnen, dass hier ein rhetorischer Trick verwendet wird. Wir werden nicht um alle wütend geführten Debatten herumkommen. Aber wir können sie strategischer führen. Wir können einordnen, warum eine Debatte so wütend geführt wird. Wir können den rhetorischen Trick aufdecken, durch den die Welt mehr durch eine Schwarz-Weiß-Brille gesehen wird und sich schwerer ein Kompromiss finden lässt.
MOMENT.at: Also Sie empfehlen für den Umgang mit derartigen Politikern und Inhalten auf Social Media, dass man einordnet. Spielt nicht schon jede Aufmerksamkeit der verrohenden Rhetorik in die Hände?
Brodnig: Die erste Frage ist tatsächlich immer, ob man das aufgreifen will. Auf Social Media kann man sich anschauen, ob ein Posting wirklich so sichtbar ist, dass man darauf reagieren muss. Wenn ein Post gar keine große Reichweite hat, besteht sogar die Gefahr, dass ich ihn erst durch meine Reaktion groß mache. Aber es wird Debatten geben, die schon groß sind. Da nehme ich mir die Chance der Einordnung, wenn ich nicht darauf reagiere.
Es gibt keine perfekte Antwort. Aber je mehr ich innehalte, um nachzudenken, was eine provokative Stimme in mir auslösen will, desto höher ist die Chance, dass ich nicht bei jedem Unsinn mitdiskutiere. Oder dass ich nicht nur fremdbestimmte Debatten führe, die mich aufregen. Die mir aber nüchtern betrachtet nicht so wichtig sind, oder ich stattdessen Einordnung liefern könnte.
MOMENT.at: Machen die Medien es vielleicht sogar schlimmer?
Brodnig: Im Medienspektrum gibt es zwei große Schwierigkeiten. Erstens sind Social Media Algorithmen auf Krawall gebürstet. Die Plattformen funktionieren unterschiedlich, aber Interaktion ist oft ein wichtiger Wert. Ob Leute auf etwas reagieren, ob sie kommentieren. Man kommentiert oft, wenn man sich über jemanden aufregt. Oder man schaut sich ein Video länger an, gerade weil man den Inhalt für so unsinnig hält. Provokation rentiert sich auf Social Media.
Andererseits haben die klassischen Medien ein zentrales Problem. Es ist verdammt schwierig geworden, guten Journalismus zu finanzieren. Die klassischen Erlösmodelle funktionieren viel schlechter als früher. Gerade in einer Online-Journalismus-Logik ist die Versuchung groß, dass man sehr stark klickgetrieben handelt. Da muss man permanent schauen, erreicht man genug Leute, hat man genug Klicks, ist die Werbung sichtbar genug. Wütend machende Headlines können Klicks schüren. Ich glaube, viele Medien kämpfen täglich darum, eine Balance zu finden zwischen journalistischer Relevanz und dieser Suche nach Klicks.
Im Zweifelsfall ist die Einordnung wichtig. Dass man nicht nur in eine Wut-Debatte hineingeht, sondern mehr liefert als die Aussage, die Leute aufregt. Sondern dass man für das Publikum entlarvt, was da gerade passiert. Rhetorisch zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass das irgendein Medium perfekt macht. Aber es gibt welche, die sich mehr anstrengen.
MOMENT.at: Sie haben jetzt auch schon vom Schwarz-Weiß-Denken geredet, dass teilweise verstärkt oder sogar fabriziert wird. Was kann man tun, um nicht selbst in ein Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen?
Brodnig: Schwarz-Weiß-Denken bedeutet, dass man sich als Eigengruppe im Kontrast zur Fremdgruppe sieht. Wir sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Wir wollen das Klima schützen und die anderen machen es kaputt. Und da gibt es auch die Beobachtung, dass Menschen die andere Gruppe als zu einheitlich wahrnehmen. Man sieht die eigene Gruppe als komplex, die Leute darin als individuell. Und die Leute, die anders denken, eine andere Partei wählen, ein anderes Verhalten zeigen, sieht man als einheitliches Ding. Man versäumt oft, dass die gar nicht alle gleich sind. Dass es zum Beispiel sein kann, dass eine Person eine andere Partei wählt, ihr Klimaschutz aber trotzdem wichtig ist.
Wenn ich so tue, als wären die anderen alle gleich, nehme ich mir die Chance, diejenigen in der anderen Gruppe zu erreichen, die für mich erreichbar wären. Es ist wichtig, auch mit Leuten zu reden, die die Welt nicht exakt gleich sehen. Weil man dazu lernen kann. Warum ist die Person in diese Richtung gegangen? Wo haben wir sogar Gemeinsamkeiten?
In Österreich gibt es eigentlich viel Konsens. Wir haben viel Streit, keine Frage. Aber wenn man zum Beispiel fragt, ob der Klimawandel Sorgen macht, sagt eine Mehrheit der Österreicher:innen tendenziell ja. Das ist etwas, auf dem ich aufbauen kann. Ich würde empfehlen nicht nur in die eigene Blase hinein, quasi sich selbst bestätigend, zu kommunizieren. Nicht nur schauen, wie arg die anderen sind, sondern auch, welche Gemeinsamkeiten es gibt. So wird langsam wieder ein Konsens möglich.
Zur Person: Ingrid Brodnig (1984) ist Journalistin, Kolumnistin beim Standard und Sachbuchautorin. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt auf digitalen Themen, zu denen sie auch Vorträge und Workshops hält. Ihr aktuelles Buch ‚Wider die Verrohung‘ thematisiert Methoden zur Emotionalisierung und Polarisierung öffentlicher Debatten und wie man darauf reagieren kann.