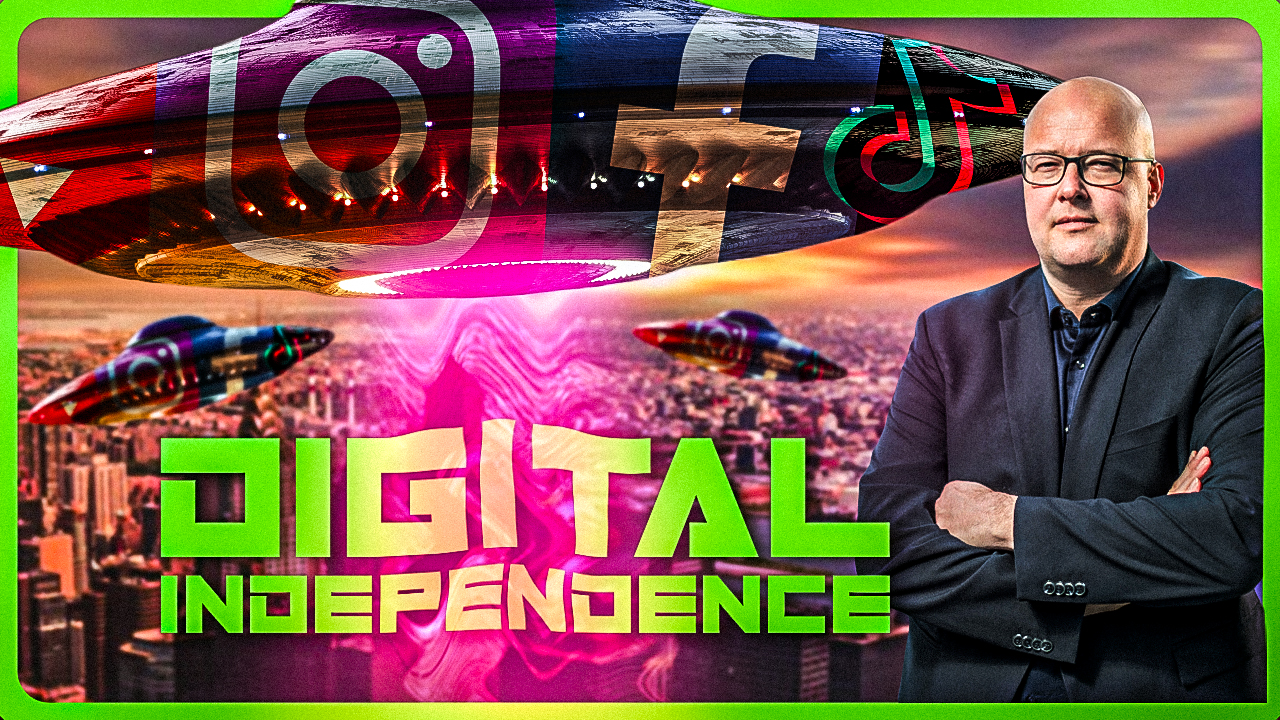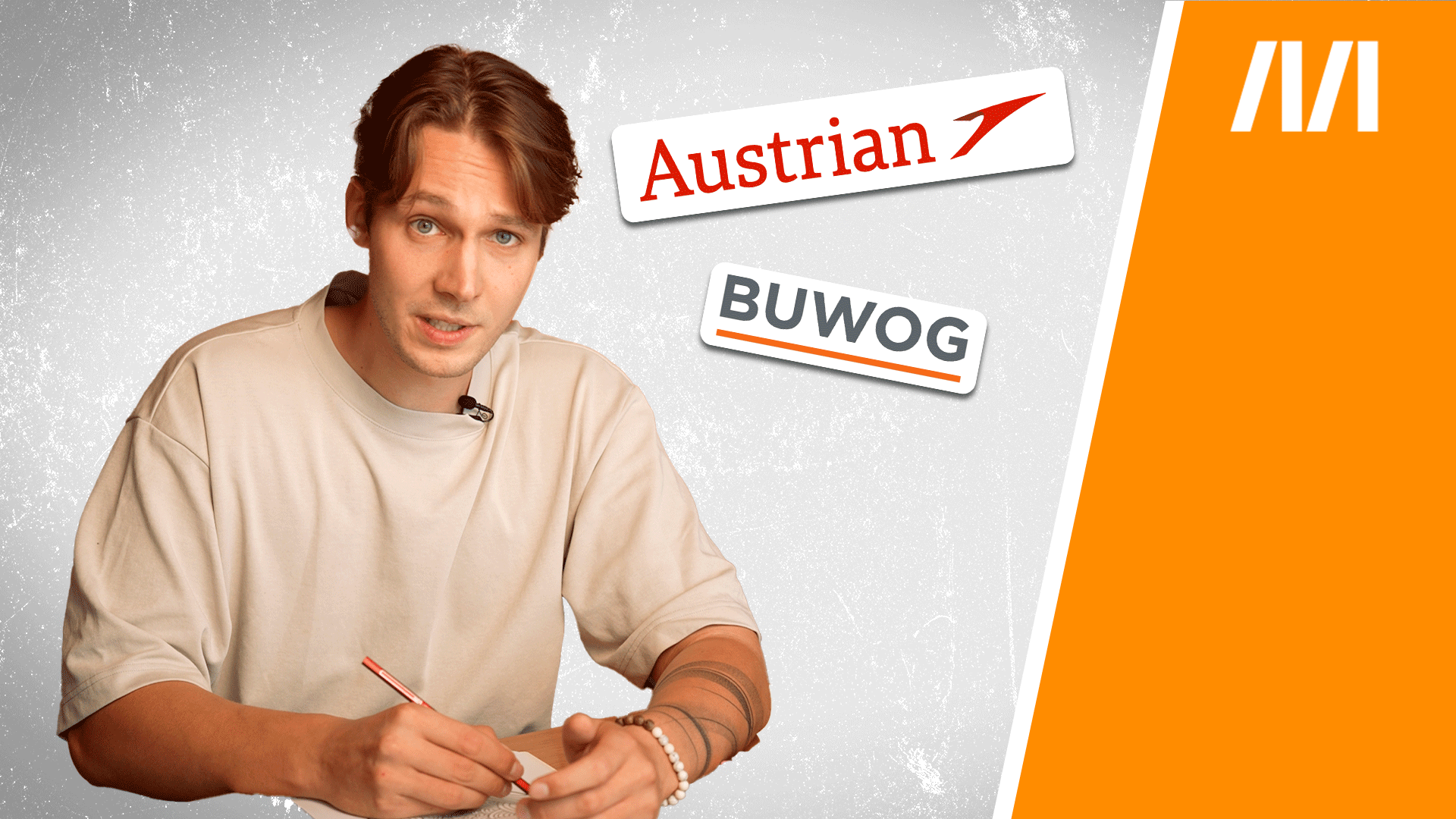Privatstiftungen in Österreich erklärt: Warum alle Reichen eine haben
Wo ist bei der Signa eigentlich noch Vermögen zu holen? Die Insolvenzverwalter:innen von René Benkos diversen Firmen bleiben bei der Suche regelmäßig bei Privatstiftungen hängen. Denn Benko war ja selbst weder Geschäftsführer noch Eigentümer von Signa Prime, Signa Development oder der Signa Holding.
Allgegenwärtig: Die österreichische Privatstiftung
Kontrolliert wurden diese Gesellschaften zum größten Teil von Privatstiftungen wie der “Familie Benko Privatstiftung”, der “Laura Privatstiftung” oder der “Ingbe-Stiftung”, eine nach René Benkos Mutter Ingeborg benannten Stiftung nach liechtensteinischem Recht. Und an diesen Stiftungen haben sie sich die Insolvenzverwalter zumindest bislang die Zähne ausgebissen.
Was ist da eigentlich los? Was sind diese Privatstiftungen? Und warum sind sie bei Menschen so beliebt, die viel mehr Geld haben, als sie zum Leben brauchen? Es gibt kaum jemand auf der Trend-Reichenliste, der nicht Vermögen in einer Privatstiftung geparkt hat.
Österreich hat etwa 3.000 Privatstiftungen
Zu den größten und prominentesten unter den knapp 3.000 Privatstiftungen in Österreich zählen beispielsweise die Karl Wlaschek Privatstiftung des verstorbenen BILLA-Gründers, die Louise Piech Stiftung (Miteigentümer von Porsche und VW) oder die “Fürst Esterhazy’sche Privatstiftung Burg Forchtenstein”.
Was ist jetzt das Besondere an einer Privatstiftung? Im Unterschied zu einer GmbH oder eine Aktiengesellschaft, hat eine Stiftung keine Eigentümer. Sie gehört sich quasi selbst. Das bedeutet auch: Wenn der Stifter stirbt, hat das erst einmal keine Auswirkungen. Es kann also nicht zu Erbstreitigkeiten kommen. (Oder zu lästigen Erbschaftssteuern - falls es denn welche geben würde.)
Das leistungslose Einkommen mit Steuervorteil
Gleichzeitig gibt es in Stiftungen Begünstigte. Sie erhalten die Erträge, die aus dem Stiftungsvermögen kommen. Das können zum Beispiel Mieteinnahmen, Zinsen, Gewinnausschüttungen oder auch Veräußerungsgewinne sein. Diese Begünstigten sind oft enge Familienangehörige. Denen soll das ein stetiges, leistungsloses Einkommen aus Vermögen garantieren.
Außerdem können diese Begünstigten dann, in einem Land ohne Schenkungssteuern, einen kleineren oder größeren Teil weiterschenken. Also nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass der Stifter mit einem komplexen Immobilien-Schneeballsystem Schiffbruch erlitten hat und im Privatkonkurs gelandet ist. Also rein hypothetisch natürlich.
Mythen der Privatstiftung
Aber was macht Privatstiftungen gerade bei überreichen Familien so beliebt? Wenn es nach der Wirtschaftskammer geht, dann hat das jedenfalls nichts mit steuerlicher Bevorzugung von Überreichen zu tun:
“Privatstiftungen genießen keine steuerlichen Vorteile!” schreit die Wirtschaftskammer auf ihrer Webseite ins Internet.
Mehr noch, Privatstiftungen würden sogar schlechter behandelt werden als andere Rechtsformen. Wenn man Vermögen in die Stiftung einbringt, zahlt man darauf eine Steuer von 3,5%. Das beklagt die WKO, denn es sei “in Österreich aktuell die einzige Schenkung, die einer „Schenkungssteuer“ unterliegt.”
Das ist doch ein erstaunlicher Befund. Wer hätte gedacht, dass gerade die allerreichsten Österreicher:innen und Österreicher große Teile ihres Vermögens in einer Rechtsform halten, die mit steuerlichen Nachteilen einhergeht?
Die Wahrheit über Privatstiftungen
Und tatsächlich ist das Quatsch. Natürlich hat der Privatstiftungsboom bei Überreichen auch, ja vor allem, mit steuerlichen Vorteilen zu tun.
Das sagen zum Beispiel Steuerberater der tpa-Gruppe, die zweifelhafte Berühmtheit als Berater von René Benkos Signa-Holding erlangt haben. In einer eigenen Broschüre heißt es: “Stiftungen nach dem österreichischen Privatstiftungsgesetz [bieten] auch einige interessante steuerliche Vorteile”.
Wie ist es jetzt wirklich? Bieten Stiftungen Steuervorteile oder nicht? Einen ersten Hinweis darauf liefert - erstaunlicherweise - wieder die Webseite der Wirtschaftskammer. Denn auf einer anderen Unterseite zum Thema “Die Besteuerung von Privatstiftungen” ist dort durchaus von steuerlichen Vorteilen von Privatstiftungen die Rede:
“Die Zwischenbesteuerung und die zusätzliche Möglichkeit unter bestimmten Voraussetzungen der steuerfreien Übertragung stiller Reserven aus der Veräußerung einer Kapitalbeteiligung … stellen auch die wesentlichen verbliebenen steuerlichen Vorteile der Privatstiftung dar.”
Schauen wir uns also diese “verbliebenen steuerlichen Vorteile der Privatstiftung” ein wenig genauer an. Worin genau dieser steuerliche Vorteil besteht, wird am besten im Vergleich mit einer GmbH erkennbar.
Was bringt die Privatstiftung den Reichen? Ein Rechenbeispiel
Angenommen, eine GmbH verkauft Aktien und macht damit 100.000 Euro Gewinn. Darauf fällt eine Körperschaftssteuer von 23 Prozent an. Werden die verbliebenen 77.000 Euro dann an die Gesellschafter der GmbH ausgeschüttet, werden davon wiederum 27,5 Prozent Kapitalertragssteuer fällig. Es bleibt also ein Ausschüttung in Höhe von 55.825 Euro. Der Gesamtsteuersatz beträgt somit 44,175 Prozent.
Bei einer Privatstiftung ist das anders. Dieselben 100.000 Euro Kursgewinn werden mit einer Zwischensteuer von 27,5 Prozent belegt. Also hier 27.500 Euro. Aber wie der Name “Zwischensteuer” schon vermuten lässt, ist das nur ein Zwischenergebnis.
Denn wird der verbliebene Gewinn nämlich an die Begünstigten ausgeschüttet, wird zwar auch Kapitalertragssteuer fällig. Theoretisch läge die hier bei knapp 20.000 Euro. Aber: die Zwischensteuer kann angerechnet werden. In unserem Beispiel fällt die KESt damit weg. Die Begünstigten der Privatstiftung erhalten 72.500 Euro. Sie zahlen viel weniger Steuern. Nur 27,5% statt 44%. Der Gesamtsteuersatz liegt demnach knapp 17 Prozentpunkte unter jenem bei einer herkömmlichen GmbH - und meilenweit entfernt vom Spitzensteuersatz einer normalen Angestellten.
Geld macht mehr Geld
In den Genuss dieses Steuerprivilegs kommen allerdings nur jene, die über genug Vermögen verfügen, um es in eine Privatstiftung einzubringen. Das dafür notwendige Mindestvermögen beträgt 70.000 Euro. Wirklich lohnen tut es sich erst bei größeren Vermögen - wegen der mit der Einrichtung so einer Stiftung verbundenen Kosten wie dem Notariatsakt etc..
Die Besteuerung von Privatstiftungen folgt so also dem Matthäus-Prinzip: Wer hat, dem wird gegeben. Im Ergebnis ermöglichen es Privatstiftungen denjenigen, die über beträchtliches Kapitalvermögen verfügen, besonders wenig Steuern auf Vermögenszuwächse zu bezahlen. Kein Wunder, dass die Vermögensungleichheit in Österreich nicht nur im europäischen Spitzenfeld liegt, sondern sich die Schere immer weiter auftut. Das Steuersystem ist genau so gebaut.