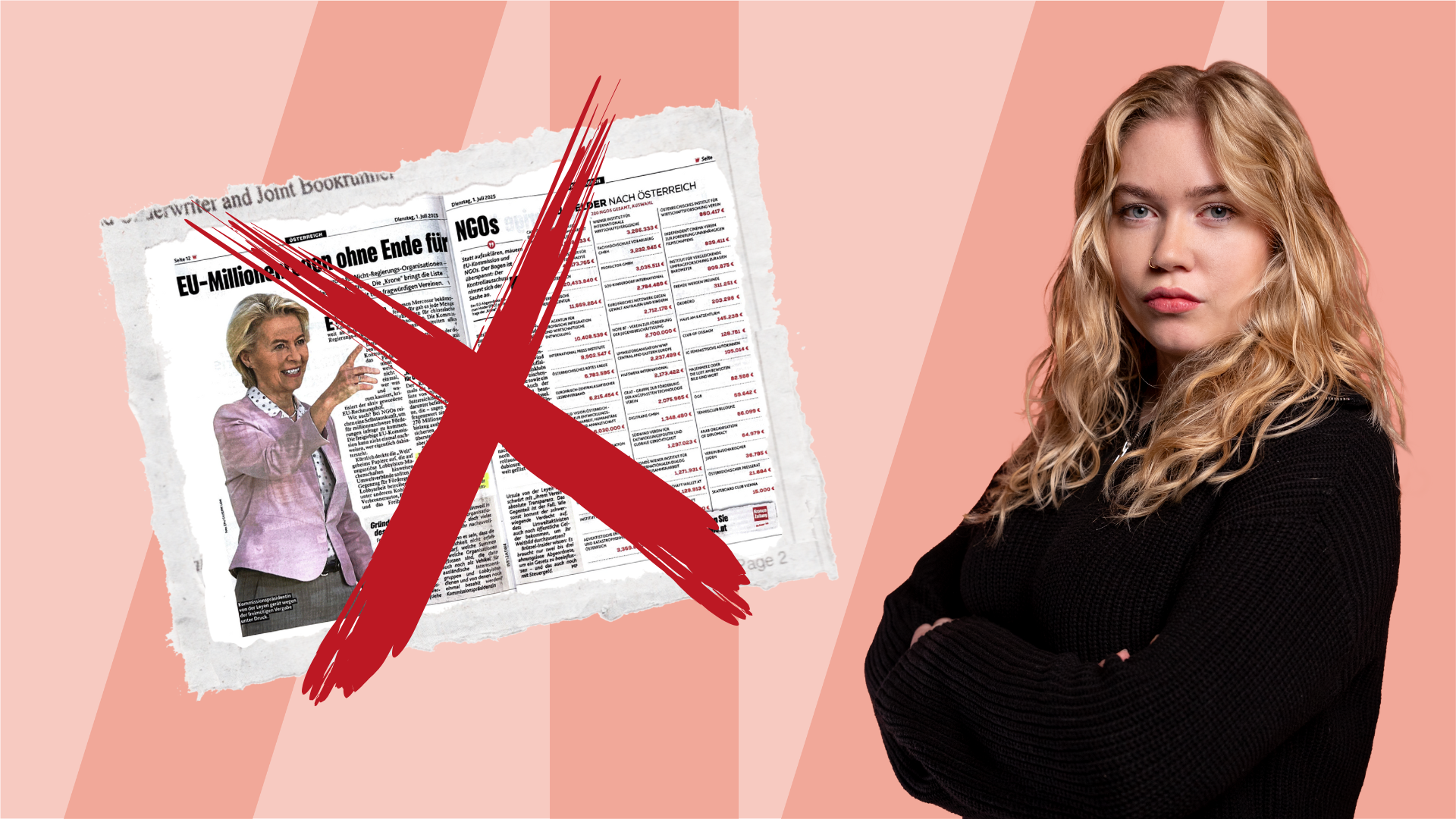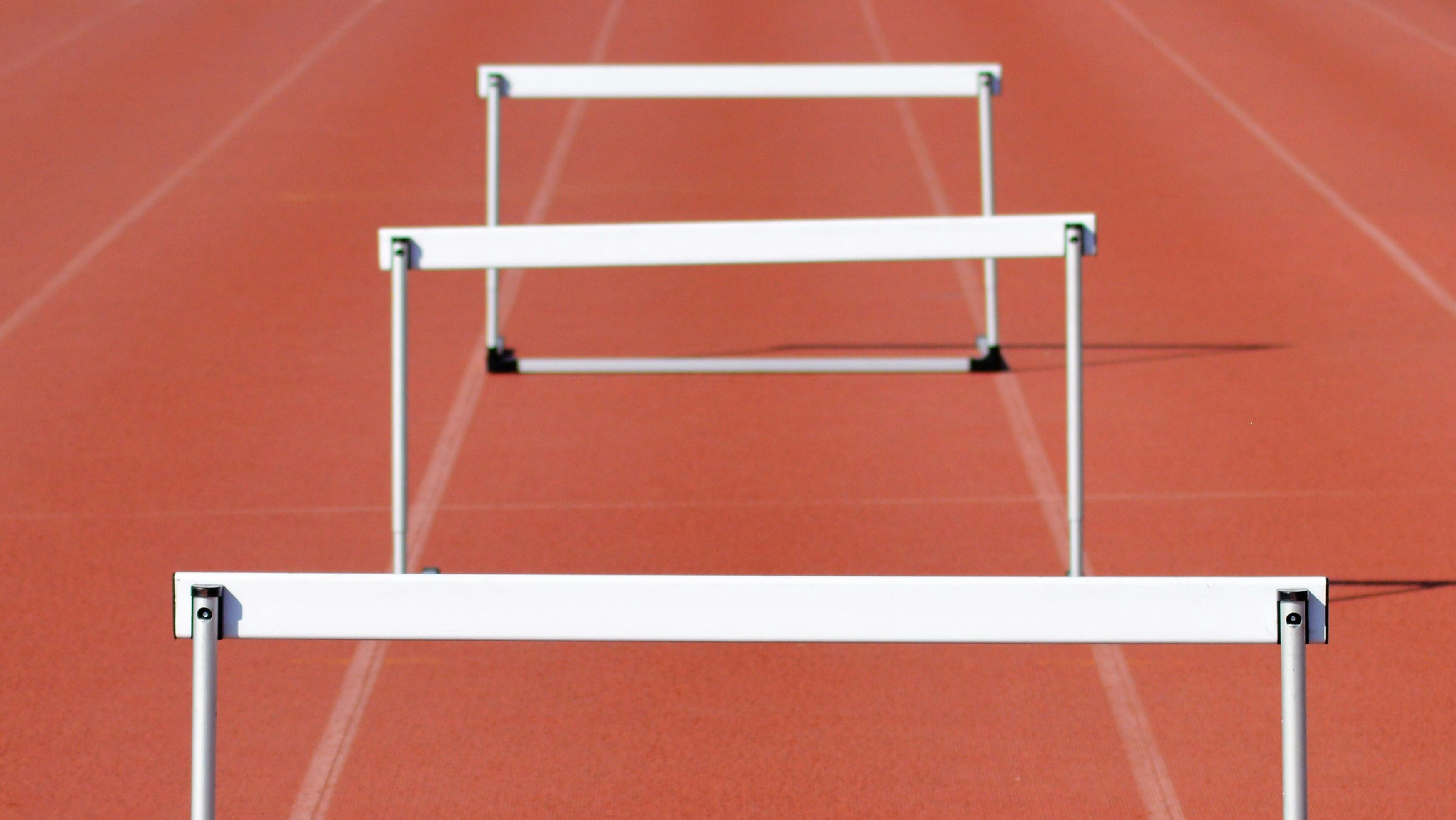Şeyda Kurt: „Ich bin kein Mensch der Hoffnung“

Du beschäftigst dich in deiner Arbeit mit Gefühlen und Politik. Gerade in wissenschaftlichen Kontexten scheinen Gefühle oft keinen Platz zu haben. Wie stehst du zum Neutralitätsanspruch in der Wissenschaft?
Şeyda Kurt: Ich glaube, dass dieser Neutralitätsanspruch ein Versuch ist, die herrschenden Verhältnisse und Analysewerkzeuge der Wissenschaft zu neutralisieren. Man stellt solche Verhältnisse als alternativlos dar. Wenn wir uns die Tradition von Wissenschaft im europäischen Kontext anschauen, sehen wir, dass diese von Macht und Herrschaftsverhältnissen geprägt war.
Dass Körperlichkeit oder Emotionalität abgewertet wurden, war kein Zufallsprodukt. Es ist ein Pfeiler dieser Ideologien, weil so schon immer Besitz- und Herrschaftsverhältnisse gerechtfertigt wurden.
Mir geht es gar nicht darum zu sagen, dass alles Gefühl sein soll. Aber wir brauchen demokratische Grundbedingungen, damit die Vernunft und Emotionalität aller Menschen auf egalitäre Weise anerkannt werden. Das produziert im Zusammenspiel dann Formen von Wissen, die uns jetzt gerade vielleicht noch gar nicht machbar oder existent erscheinen.
In deiner Arbeit entwirfst du eine radikal zärtliche Gesellschaft. Was macht einen radikal zärtlichen Ansatz aus?
Şeyda Kurt: Radikalität fordert politische Praktiken, die Zärtlichkeit und Solidarität möglich machen. Mit Zärtlichkeit verbinde ich zwei Assoziationen. Einerseits geht es um Vulnerabilität. Im Neoliberalismus wird weggeredet, dass alle Menschen als vulnerable Menschen auf die Welt kommen und einander brauchen.
Gleichzeitig steckt in Zärtlichkeit ein sehr großes revolutionäres Potenzial. Was mir in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Gefühlen stark fehlt, ist die Betrachtung von Gefühlen als etwas, das man aktiv tut. Aber wir nehmen Gefühle als naturgegeben an. Damit nimmt man Menschen eine Verantwortung dafür, was sie fühlen.
Radikale Zärtlichkeit ist eine Aufforderung, so etwas schon in der Gegenwart gemeinsam anzugehen. Es ist eine Form von kollektiver Solidarität, die nicht auf eine Utopie wartet.
Wie sieht radikale Zärtlichkeit in alltäglichen Situationen aus?
Şeyda Kurt: Zum Beispiel indem man darüber spricht, wie sich Menschen in romantischen Beziehungen verhalten. Wir können Beziehungsräume schaffen, in denen wir uns als Gleichberechtigte begegnen. Es ist aber sehr schwierig, ein Regelwerk aufzustellen und zu sagen „Wenn du das und das tust, bist du eine radikal zärtliche Partnerin“.
Auf der politischen Ebene sind für mich die radikal zärtlichsten Beziehungen politische Freund*innenschaften, die die Priorisierung von romantischen Beziehungen in der biologischen Kernfamilie angreifen. Sie zeigen, dass eine radikal zärtliche Gesellschaft aus vielfältigen Beziehungen besteht. Für mich sind das auch genossenschaftliche Beziehungen, etwa im gemeinsamen politischen Kampf. Wenn man unter Menschen ist, mit denen man sich nicht über Blutsverwandtschaft oder eine gemeinsame Identität zusammengefunden hat, sondern über eine gemeinsame Vision von der Welt.
In deinem zweiten Buch sprichst du von Hass als transformatives Mittel. Wie gelingt das in einer strukturell diskriminierenden Gesellschaft?
Şeyda Kurt: Ich glaube, die Gesellschaft als großes Ganzes würde das nicht schaffen. Mir geht es um den Hass von sogenannten Gegengemeinschaften.
Es geht um die transformative Kraft des strategischen Hasses, der in progressiven politischen Bewegungen als Mittel der Mobilisierung eingesetzt wird. Er dient aber auch als Erinnerung daran, dass gewisse Verhältnisse wie Kapitalismus, Patriarchat und Kolonialrassismus nicht einfach reformierbar sind. Sie gehören zerstört und abgeschafft. Ich sehe mich sehr stark in abolitionistischen Bewegungen, die ihre Ursprünge im Kampf gegen die Sklaverei haben.
Am Ende des Buches stelle ich die Frage, wie wir in Gesellschaften, die seit Jahrhunderten von Hass geprägt sind, diesen letztendlich transformieren. Der Hass ist für mich nicht ewig. Er ist ein strategisches Moment auf dem Weg in eine radikal zärtliche Gesellschaft.
Der Hass von rassifizierten Menschen und/oder Personen mit Migrationsbiografie ist heute mit rassistischen Stereotypen besetzt. Wie kann es Raum für sicheres Hassen und mehr Zärtlichkeit geben?
Şeyda Kurt: Ich glaube grundsätzlich nicht an sichere Räume. Aber was wir schaffen können, sind Räume mit einer gewissen Offenheit. Dazu gehört auch erstmal theoretische Reflexion. Wir schaffen in der Praxis keine anderen politischen Räume, wenn wir nicht in der Theorie Wahrheiten dekonstruieren. Wenn wir wissen, dass unser Bild von Hass und hassenden rassifizierten Menschen diese entmenschlicht, sind wir bereit, dieses das zu hinterfragen und vielleicht aufzulösen.
Gerade in Zeiten von Rechtsruck und geopolitischen Konflikten scheint so eine Gesellschaft weit entfernt. Hast du Hoffnung auf Alternativen?
Şeyda Kurt: Ich bin kein Mensch der Hoffnung. Das mag manche etwas irritieren. Ich mache das aus Überzeugung und Liebe, aber auch aus Trotz und Hass. Es gibt mir sehr viel Kraft, dass diese radikal zärtliche Welt schon in der Gegenwart an vielen Stellen erprobt wird. Zum Beispiel in Freundschaften, genossenschaftlichen Beziehungen, aber auch im Großen und Ganzen. In Rojava realisiert sich gerade das, was ich mir für die Welt als Ganze auf eine Art und Weise auch vorstelle. Es gibt schon diese revolutionären Orte, die aber alle unter Beschuss stehen. Wenn es immer noch Leute gibt, die an diesen Orten sind und sie verteidigen, wer bin ich, dass ich einfach aufgeben würde, selbst wenn ich hoffnungslos bin?
Zur Person: Şeyda Kurt ist eine bekannte deutsche Journalistin und Autorin. Sie hat mit ihrem Podcast „190220 – Ein Jahr nach Hanau“ den Grimme Online-Award gewonnen, die Bücher „Radikale Zärtlichkeit – Warum Liebe politisch ist.“ (2021) und „Hass. Von der Macht eines widerständigen Gefühls.“ (2023) geschrieben und ist Mit-Herausgeberin von „Spiel*Kritik: Kritische Perspektiven auf Videospiele im Kapitalismus“ (2024). Am Momentum Kongress 2024 in Ossiach hielt sie die Keynote.
Dieses Interview erschien zuerst in der Kongress-Zeitung „Der Moment“. Das Gespräch mit Şeyda Kurt führte Nikola Szirota.