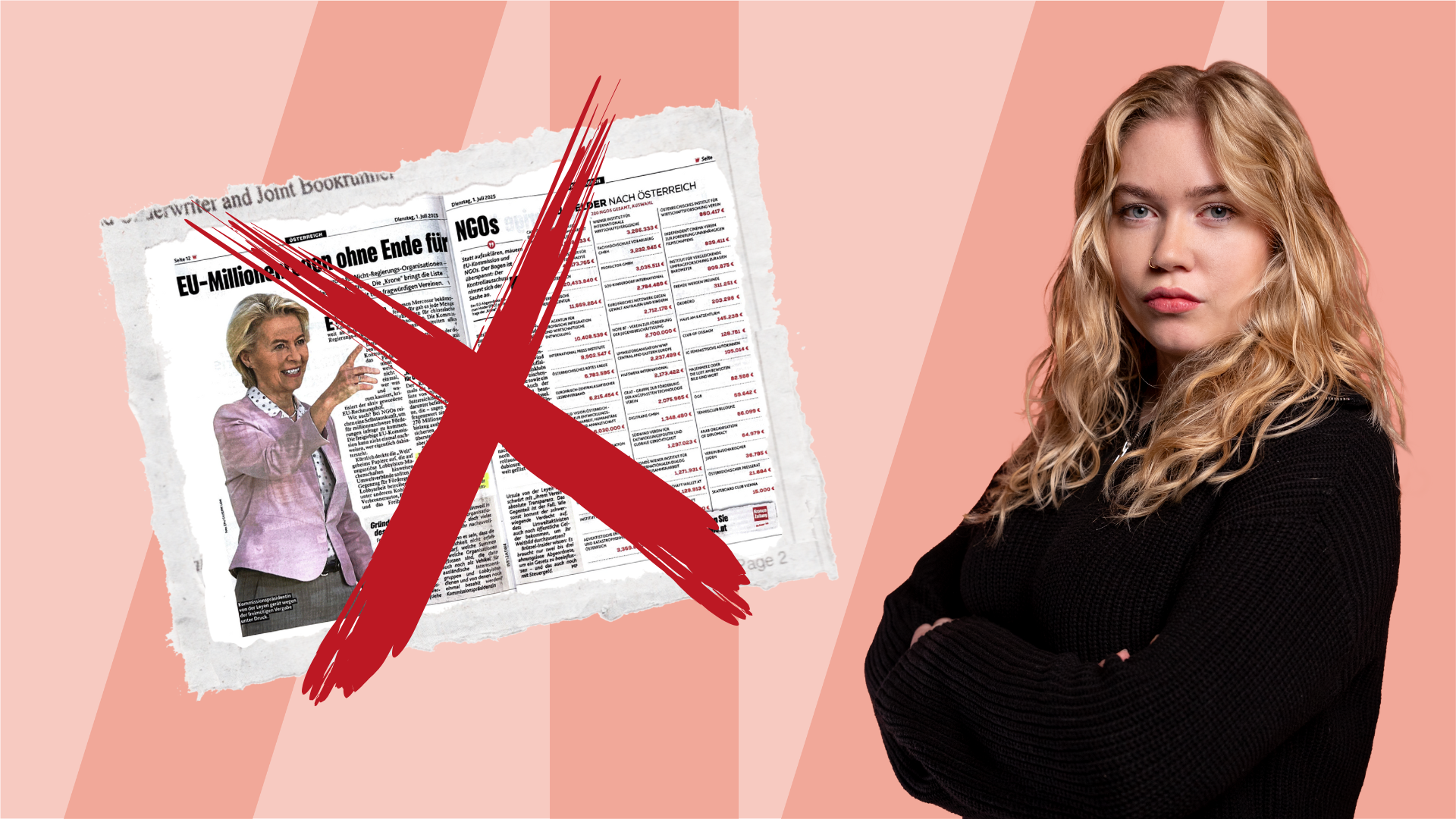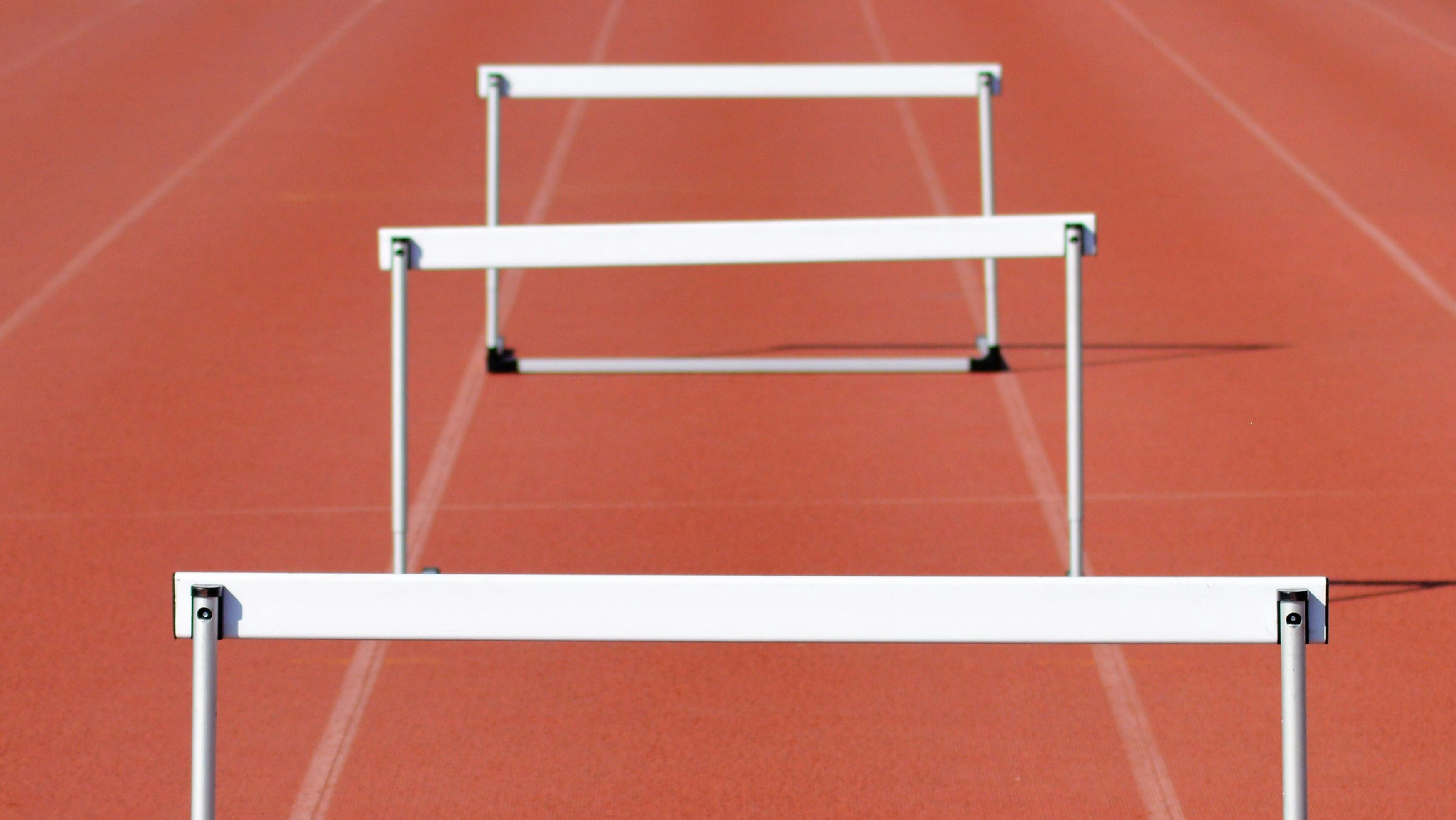So können wir uns die Corona-Krisenbekämpfung leisten

38 Milliarden Euro pumpt die Regierung in die Wirtschaft und viele fragen sich angesichts dieser Zahl: Woher soll das Geld zur Krisenbekämpfung nun kommen, wenn nicht vom Geldbaum, an den Kogler partout nicht glauben will? Aus Steuern? Nein, denn weniger Produktion und mehr Arbeitslosigkeit heißen: Die Menschen haben weniger Geld zum Ausgeben und der Staat hat weniger Steuerbeiträge in der Kasse. Die klügere Antwort: Kredite. Sprich: das in Verruf geratene „Schuldenmachen“. Der Staat verkauft an Banken Anleihen und verspricht ihnen, die geborgte Summe inklusive Zinsen zurückzuzahlen.
Ein Geldbaum namens Notenbank
Woher kommt das geborgte Geld? Die Banken erschaffen es auf Knopfdruck. Aus dem Nichts. Weil hinter ihnen die Zentralbank steht, die ihrerseits mit einem weiteren Knopfdruck den Banken genau jenes Zentralbank-Geld zur Verfügung stellt, das die dafür brauchen. Es gibt diesen Geldbaum also doch, und er braucht statt Jahren nur Minuten, um (Geldschein-)Blätter zu tragen. Er heißt Notenbank und funktioniert in anderen Ländern problemlos. Deswegen kann Japan bei über 200 Prozent staatlicher Verschuldung ein Konjunkturpaket mit knapp 20 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung auflegen – doppelt so hoch wie das österreichische. Deswegen kann der britische Finanzminister die Schulden des britischen Gesundheitssystems NHS streichen, damit dieses ohne finanzielle Altlasten gegen Corona kämpfen kann. Die Euro-Zone mit ihrer Europäischen Zentralbank hatte diese Chancen der Geldschöpfung nach der letzten großen Finanzkrise noch bis 2012 nicht verstanden. Die Folge: Wirtschaftseinbrüche in Südeuropa, ein jahrelang schwaches Wachstum in Österreich und im Rest der Euro-Zone sowie Millionen von Arbeitslosen.
Mittlerweile hat ein Großteil der europäischen Führung verstanden: Die Aufgabe einer Zentralbank ist, genügend Futter für Investitionen in und nach der Krise bereitzustellen – für den nächsten Aufschwung. Doch der Bock muss das Futter auch fressen, das ihm die Zentralbank hinlegt.
Ideologen blockieren
Eine Clique mächtiger, spar-radikaler Finanzpolitiker vor allem aus Österreich, Deutschland und den Niederlanden will das nicht. Aus rein ideologischen Gründen: Kürzungen, schleichende Privatisierungen und das religiöse Dogma vom „schlanken“ Staat lassen sich politisch nicht durchsetzen, wenn die Bevölkerung verstanden hat, dass Geld für den Staat nicht grundsätzlich knapp ist.
Finanzminister Blümel will nach einem schnellen Konjunkturpaket zehn Jahre lang per Sparstift regieren. Mit viel Glück spüren wir davon nichts, wenn die Wirtschaft wächst. Doch die Wirtschaft wächst nicht von selbst. Nach Corona werden verschuldete Unternehmen wenig investieren. Viel Arbeitslosigkeit heißt wenig Konsum und weil wir nicht alleine mit Corona sind, wird auch weniger exportiert.
Das Wirtschaftswachstum wird wesentlich von staatlichen Investitionen und Ausgaben abhängen: wir können es uns schlicht nicht mehr leisten, weite Teile des Gemeinwesens unterzufinanzieren. Eine ausgehungerte Justiz, ein wenig einsatzfähiges Heer, ein unterfinanzierter Pflege- und Betreuungsbereich, der auf der Ausbeutung osteuropäischer Frauen beruht: all das ist kein Naturgesetz. Eine andere Politik würde nicht nur mehr öffentliche Leistungsfähigkeit sicherstellen, sie würde auch volkswirtschaftliche Impulse setzen.
Günstige Zins-Aussicht
Nach der letzten Krise hat die Politik lange auf magisches Wachstum im Privatsektor gewartet. Es kam erst nach sieben Jahren und knapp 500.000 Arbeitslosen. Ein Argument der Spar-Fetischisten gegen Kredite: “Jetzt sind Schulden kein Problem, aber später werden sie eines.” Das trifft aber nur zu, wenn die Zinsen enorm steigen. Kreisky musste zwei Wirtschaftskrisen 1974 und 1979 bekämpfen und hat sie mit viel weniger Arbeitslosigkeit als seine internationalen Partner gemeistert. Aber er musste seine Politik danach aufgeben, weil die Notenbanken Anfang der 1980er die Zinsen massiv angehoben haben. Heute, 40 Jahre später, ist Finanzminister Blümel in einer völlig anderen Situation: Eine Zinserhöhung der Zentralbank ist wegen der Corona-Krise für die nächsten Jahre de facto ausgeschlossen. Große Euroländer wie Italien und Spanien sind genug gebeutelt.
Und selbst wenn: Höhere Zinsen wären heute weit weniger gefährlich als zu Kreiskys Zeit: Europäische Zentralbanken kaufen seit 2015 staatliche Anleihen von Banken und privaten Anlegern auf. Die Österreichische Nationalbank besitzt mittlerweile rund ein Fünftel der staatlichen Anleihen. Somit zahlen wir einen Teil der Zinsen auf unsere Staatsschuld indirekt an uns selbst. Denn die österreichische Nationalbank ist im Besitz des Bundes und zahlt ihren (Zins-)Gewinn auf die aufgekauften Anleihen wieder zurück an den Staat.
Wir zahlen weniger zurück, als wir ausborgen
Der Anteil der von der Notenbank gehaltenen Anleihen wird 2020 noch steigen. Die EZB hat ein Pandemie-Kaufprogramm angekündigt, mit dem drei Viertel der geplanten Neuverschuldung „in der Familie“ behalten wird. Für die übrigen Anleihen muss der Staat Zinsen an den Privatsektor zahlen, die historisch niedrig sind, oft sogar negativ. Das heißt: Wir zahlen weniger Geld zurück, als wir uns ausborgen.
Ökonomisch gibt es daher keinen vernünftigen Grund mehr, warum der Spar-Kult jede Diskussion zum Wirtschaftsaufschwung dominieren muss. Besser könnten die Bedingungen nicht sein, um mit Krediten den Kampf gegen Corona, Klimakrise und Rekord-Arbeitslosigkeit zu führen. Alle Euro-Länder sollten diesen Mechanismus nützen.
Die Lösung
Heißt das, dass Ausgaben auch nach dem Aufschwung grundsätzlich schuldenfinanziert sein sollten? Nein. Bei Vollbeschäftigung oder wenn die Firmen ihre Produktion nicht mehr ausweiten können, würde das in die Inflation führen – Konsumgüter werden teurer. An dieser Stelle kommen Steuern ins Spiel. Sie nehmen aus dem Wirtschaftskreislauf überschüssiges Geld heraus, das die Banken und Zentralbanken hineinpumpen. Schon vor der Krise war das Fehlen von Reichensteuern spürbar: übermäßiger Reichtum ist in “Betongold” gewandert. Wohnungen und Häuser wurden zu Anlageobjekten und für normale Familien rasant teurer – zu teuer. Vermeintlich “überschüssiges Geld” wandert in Aktien, Anleihen und Immobilien, während die Löhne und die Preise für Konsumgüter niedrig bleiben.
Die Lösung: Höhere Steuern für Reiche. Das verhindert Inflation und soziale Verwerfungen. Die Verteilungsdebatte, die Vizekanzler Kogler kürzlich mit seiner Forderung nach Erbschaftssteuern eröffnet hat, ist also dringend nötig. Die Alternative dazu ist: eine Politik des Sparstiftes, die auch bei Spitalsbetten nicht halt machen wird, dafür im Gegenzug niedrige Steuern für Vermögende garantiert, damit die mit ihrer fünften Luxusyacht in der Adria “die Wirtschaft ankurbeln”.
Dieser Kommentar ist zuerst in PRESSE erschienen.