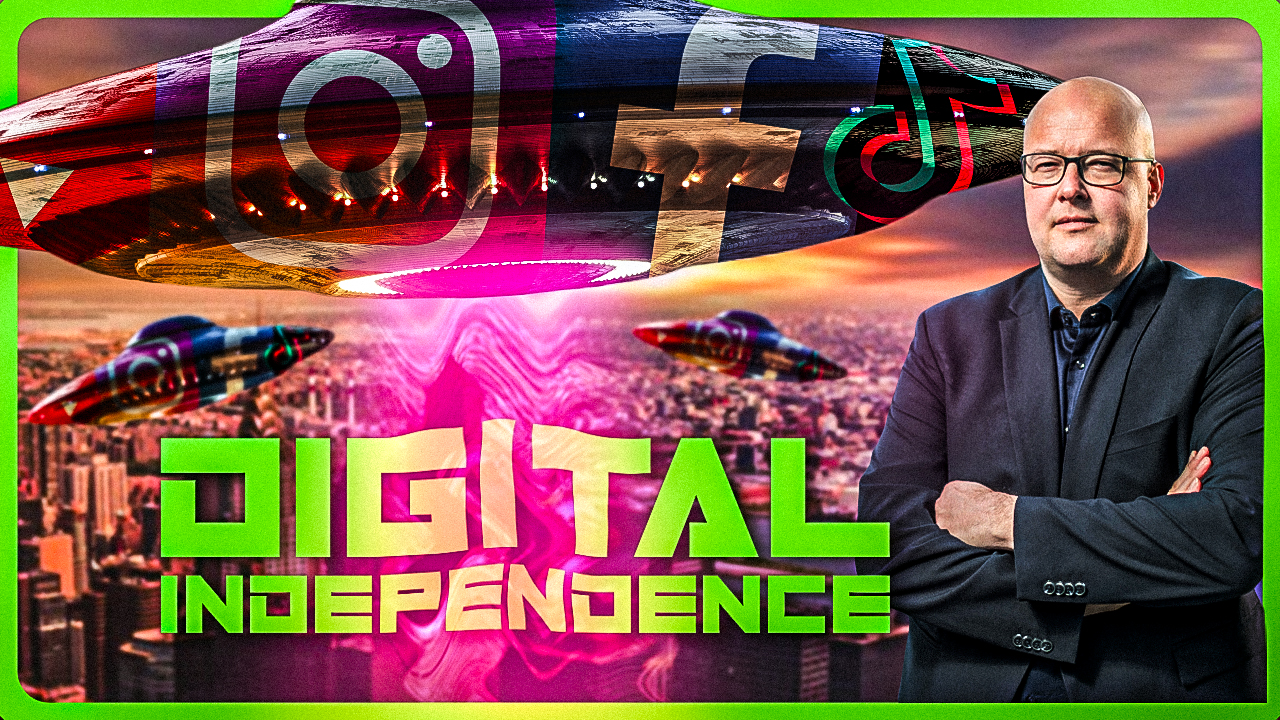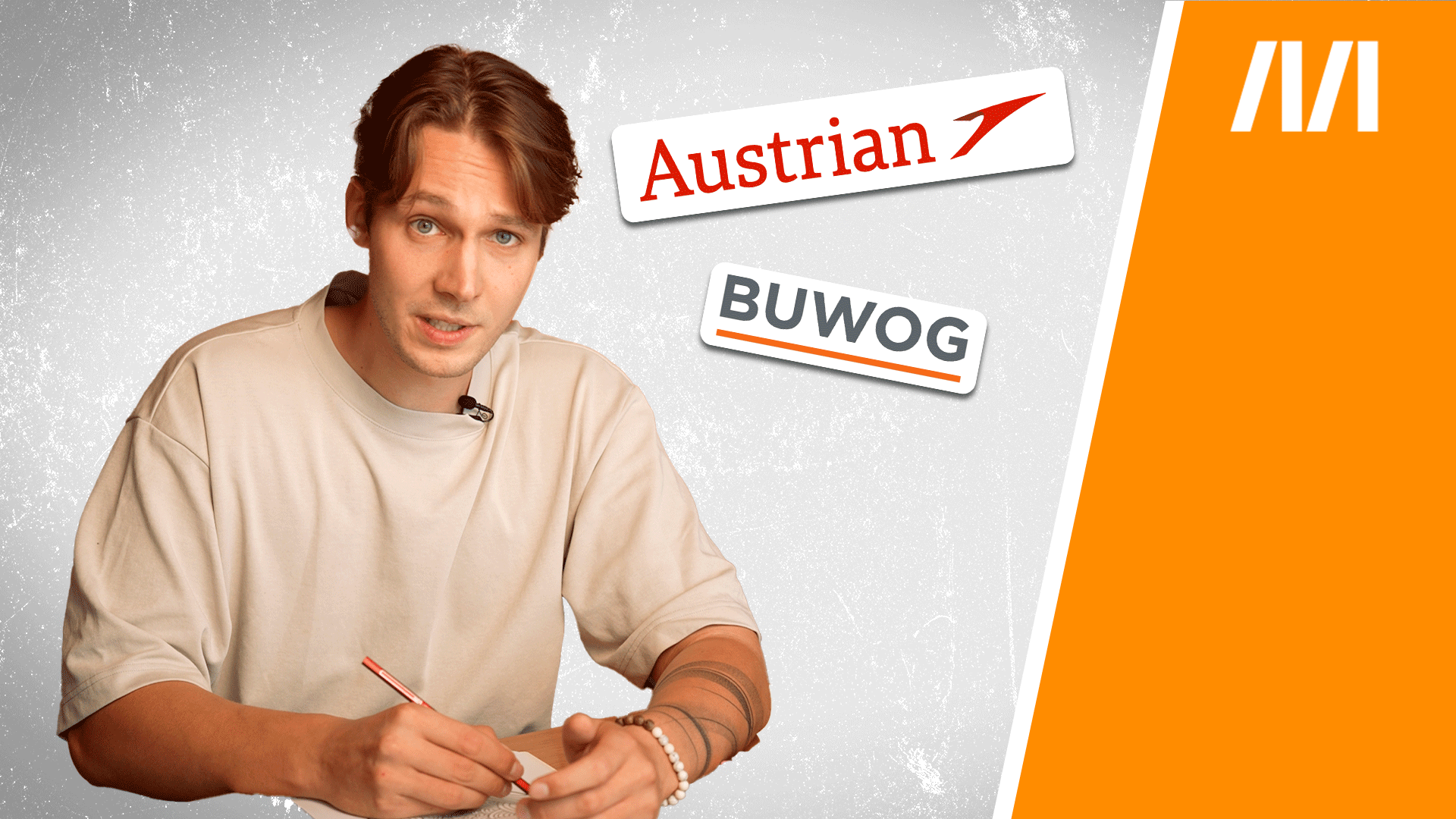Sparkurs: Woher der Staat sein Geld nimmt und woher er es nehmen sollte
Österreich spart: schon wieder. Und wieder bei jenen, die sich nicht wehren können. Die Regierung hat ja bereits ein Sparpaket beschlossen, das in Summe über sieben Milliarden Euro bringen soll. Bezahlt wird das vor allem von privaten Haushalten, also von uns allen, nicht von großen Konzernen, nicht von Vermögenden.
Jetzt stellt sich heraus: Das reicht immer noch nicht, im Budget fehlen ja noch einmal rund eine Milliarde Euro. Und anstatt endlich über Einnahmen zu reden, werden die nächsten Kürzungen vorbereitet: diesmal bei Pensionist:innen und bei allen Leuten, die im öffentlichen Dienst arbeiten, der Lehrer, die Polizistin, die Justizwachebeamtin. Das kann man natürlich machen. Man sollte aber nicht so tun, als wäre das “alternativlos”.
Österreich „muss sparen“, heißt es. Also werden Leistungen gekürzt, Projekte gestoppt, Entlastungen vertagt: Klimabonus weg, Strompreisbremse weg, Anpassung der Familien- und Sozialleistungen an die Teuerung: Verschoben.
Österreich fährt einen der härtesten Sparkurse in Europa. Das aktuelle Budget setzt vor allem auf Einsparungen. Rund sieben Milliarden werden 2025 defensiv gekürzt, aber nur rund 600 Millionen kommen als gezielte Impulse zurück in die Wirtschaft. Das bremst Wachstum und Beschäftigung.
In einer Flaute ist das gefährlich, weil Kürzungen die Nachfrage weiter drücken. Wenn Haushalte und Unternehmen alle auf der Bremse stehen und immer weniger ausgeben, müsste eigentlich die öffentliche Hand einspringen und mit kräftigen Investitionen das Schiff wieder stabilisieren. Beginnen wir mit dem Offensichtlichen: Wenn der Staat Ausgaben zurücknimmt, trifft das zuerst jene Bereiche, die direkt Nachfrage erzeugen: Kindergärten, Bau, Pflege, Bildungs- und Klimaprojekte. Diese Nachfrage fällt weg. Unternehmen investieren dann weniger, Beschäftigte verdienen weniger, die Steuereinnahmen sinken. Im Ergebnis spart der Staat Geld an einer Stelle und verliert es an einer anderen.
Wenn die Konjunktur wieder trägt, wäre der deutlich bessere Zeitpunkt für Einsparungen. Genau das zeigen auch die Erfahrungen anderer Länder: Sparen in schlechten Zeiten stabilisiert die Schuldenquote nicht zuverlässig. Gut, das geht aber nicht, sagt der Finanzminister. Wir müssen das Budget rasch wieder in Ordnung bekommen, auf die besseren wirtschaftlichen Zeiten können wir nicht warten.
Will man trotz wirtschaftlicher Schwäche ein Budget sanieren, dann ist man gut beraten, genau aufzupassen: Kürze ich bei Pensionen oder der Familienbeihilfe heißt das erstmal weniger im Geldbörsel der Pensionist:innen und der Familien. Kürzen wir vor allem bei den Ausgaben, dann dämpft das die Nachfrage - die wir ja brauchen, um wieder Schwung in die Wirtschaft zu bekommen - weiter.
Wir reden nur über das Eine
Und trotzdem, das ist ja interessant: Wir diskutieren seit Monaten übers Budget - aber die Debatte kreist fast nur um Ausgaben. Bei den Einnahmen: Dröhnendes Schweigen. Dabei ist das Defizit eine einfache Rechnung: Einnahmen minus Ausgaben. Kürzt man nur, schadet man der Wirtschaft doppelt: Menschen haben weniger Geld in der Tasche, Unternehmen weniger Aufträge, der Staat nimmt durch die dann noch schwächere Wirtschaft am Ende sogar weniger ein.
Wer dagegen die Einnahmeseite stärkt, konsolidiert nachhaltiger. Österreich verzichtet seit Jahren auf stabile Einnahmequellen: Wir haben die Gewinnsteuer für große Konzerne gesenkt, die Lohnnebenkosten gesenkt, die kalte Progression weitgehend abgeschafft, Vermögen besteuern wir kaum, Erbschaften gleich gar nicht. All diese politischen Entscheidungen haben Löcher in die Kasse gerissen. Heute werden sie mit Kürzungen bei Familien, Gesundheit, Klima und Bildung gegenfinanziert. Das ist eine Schieflage.
Und was dieser Sparkurs heißt
Aber wir lernen: Es reicht ja immer noch nicht. Es muss noch einmal eine Milliarde her. Und wir folgen wieder dem alten Muster: Dann müssen eben die Ausgaben runter.
Und das heißt diesmal: Pensionserhöhung unter der Inflation.
Und: Die Gehälter im öffentlichen Dienst sollen mit der Teuerung auch nicht Schritt halten. Das wird gerade noch verhandelt.
Beide Maßnahmen heißen: Die Leute haben noch weniger Geld im Börsel. Und sie kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Inflation immer noch überdurchschnittlich hoch ist. Wenn hunderttausende Haushalte real weniger ausgeben können, ist das ein ökonomischer Bremsklotz. Jeder Euro, der an Pension oder Lohn fehlt, ist ein Euro weniger Nachfrage im Supermarkt, im Handwerk, im Tourismus.
Warum eigentlich?
Da stellt sich doch die Frage: Warum beginnen wir ausgerechnet dort reinzuschneiden, wo die Kaufkraft schnell in der realen Wirtschaft fehlt - und bei Leuten, die ohnehin mit den hohen Preisen bei Essen, Energie und Wohnen zu kämpfen haben?
Es ist erstaunlich, wie konsequent die Einnahmenseite in Österreich aus der politischen Debatte herausgehalten wird. Kaum jemand fragt: Welche Einnahmen haben wir uns in den letzten Jahren abgewöhnt? Welche können wir zurückholen, ohne die Konjunktur zu bremsen? Wo die Zahlungsfähigkeit am größten ist, dort sollte der Beitrag höher sein. Das ist das ganze Geheimnis einer fairen Konsolidierung.
6 Ideen für eine gerechte Budgetsanierung:
- Erbschafts- und Schenkungssteuer mit hohen Freibeträgen: Zwanzig EU-Länder besteuern Erbschaften. Österreich nicht. Das Volumen der Erbschaften wird sich bis 2050 ungefähr verdoppeln. Ohne Erbschaftsteuer werden Hunderte Milliarden steuerfrei übertragen und die Vermögenskonzentration steigt weiter - denn es erben vor allem jene, die ohnehin bereits über Vermögen verfügen. Die Hälfte aller Erbschaften geht an die obersten 5 Prozent. Wer Sanierung ernst meint, kommt an einer sozial gestalteten Erbschaftssteuer nicht vorbei: hohe Freibeträge für das selbst genutzte Eigenheim, klare Übergangsregeln für Betriebe. Das trifft die breite Mitte nicht. Es trifft sehr große Vermögen, die bisher kaum beitragen.
- Grundsteuer-Reform: Bis heute basiert die Bemessung der Grundsteuer auf uralten Werten. Eine Aktualisierung mit Bodenwert-Komponente und Schutzmechanismen für Eigenheime bringt verlässliche Mittel für Gemeinden, die das Geld für Betreuung, Bildung, Pflege und Infrastruktur brauchen.
- Körperschaftsteuer (KöSt) auf Gewinne wieder anheben: Nicht der Umsatz, der Gewinn wird besteuert. Die jüngsten Senkungen kosten das Budget jedes Jahr über eine Milliarde. Eine Rücknahme bringt diesen Betrag zurück ohne die Binnenkaufkraft zu treffen.
- Kapitalertragsteuer (KESt) auf Finanz-Erträge moderat erhöhen und kleine Erträge schonen: Zinsen, Dividenden, Kursgewinne: dort liegt eine Einnahmequelle, die wir bisher gekonnt ignorieren.
- Übergewinnabgaben dort, wo außergewöhnliche Gewinne anfallen: Etwa im Bankensektor bei außergewöhnlichen Zinsmargen. Das kann man befristet und transparent gestalten.
- Klimaschädliche Subventionen abbauen und zweckwidmen: Milliarden fließen in Steuervorteile für fossile Energien. Wer diese Mittel schrittweise abbaut und in Gebäudesanierung, Öffis, heimische Erneuerbare lenkt, verbessert das Budget und die Lebensverhältnisse der Leute gleichzeitig.
Diese Hebel zusammen bringen deutlich mehr als das, was jetzt bei Pensionen und beim öffentlichen Dienst noch zusätzlich herausgepresst werden soll. Vor allem: Sie belasten nicht die Nachfrage, nicht die Mitte, sondern holen die Einnahmen dort, wo die Zahlungsfähigkeit am größten ist.
Wer nur bei Ausgaben ansetzt, landet bei Kürzungen, die die Mitte treffen, die Wirtschaft bremsen und am Ende die Konsolidierung erschweren. Wer die Einnahmenseite ernst nimmt, verlagert den Schwerpunkt dorthin, wo er hingehört: zu großen Gewinnen, großen Vermögen und großen Erbschaften. Holen wir das Geld dort, wo es liegt. Und hören wir auf, dort zu sparen, wo es am meisten wehtut und am wenigsten bringt.