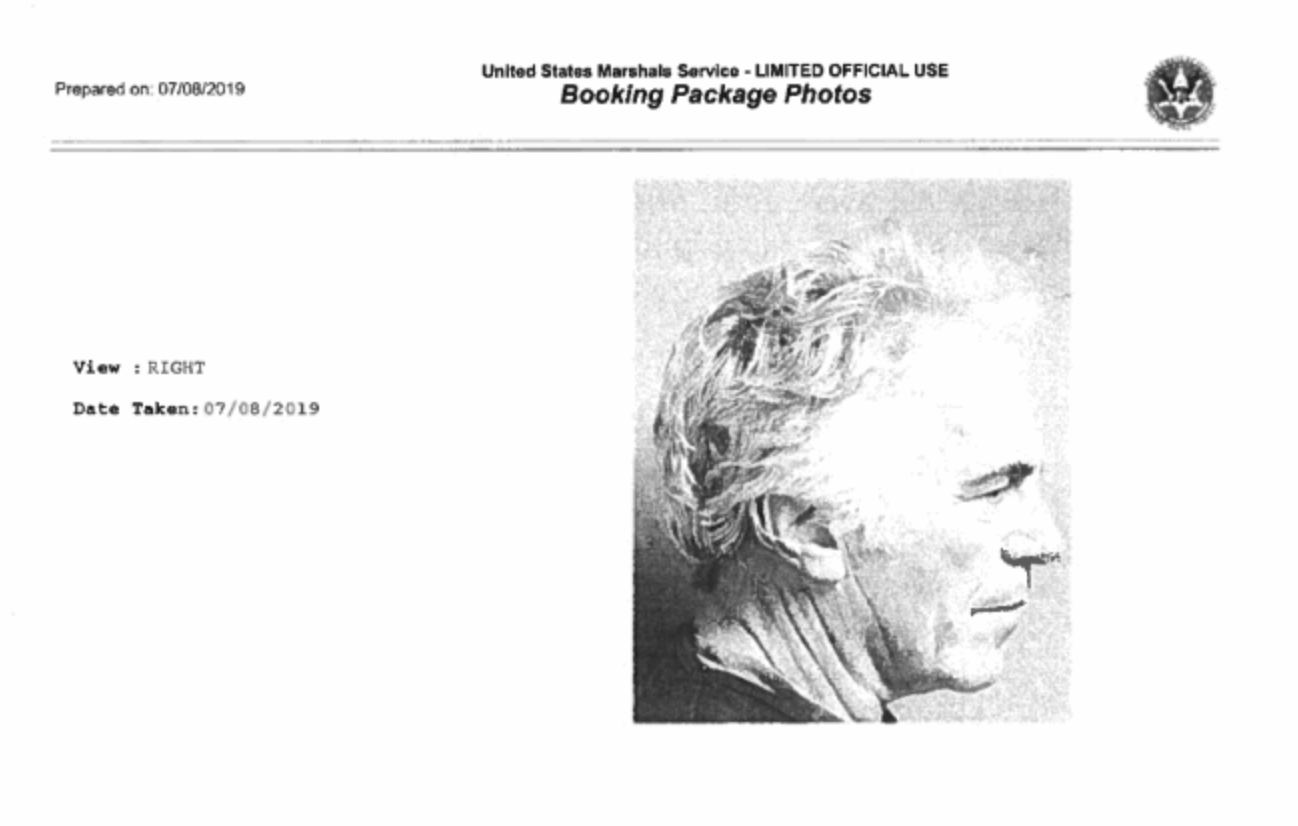Bildung: Wo das System die Arbeiterkinder stolpern lässt
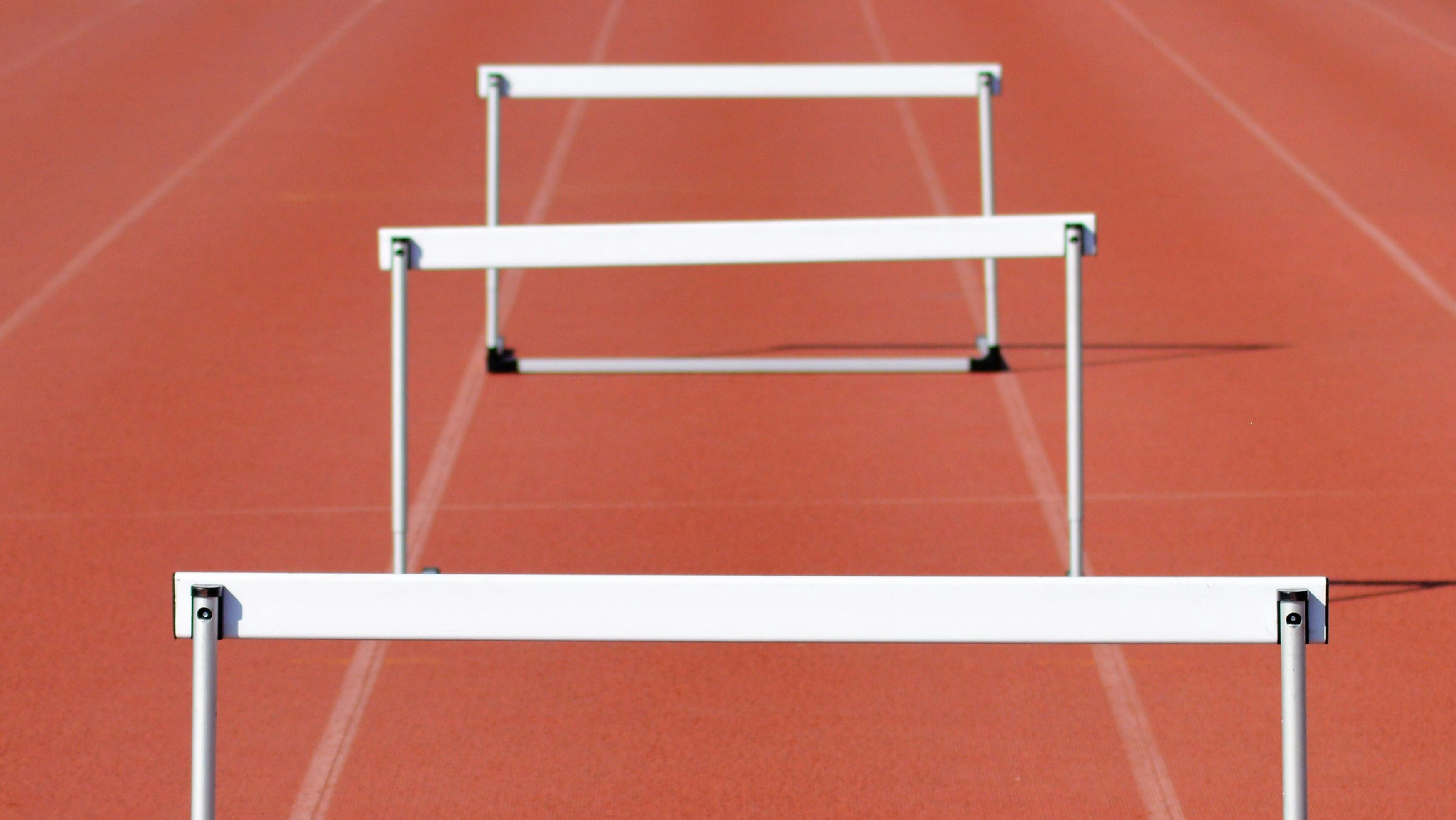
Gerade haben wieder Tausende Jugendliche in Österreich die Matura gemacht. Im Herbst werden viele davon ein Studium beginnen. Arbeiterkinder sind dabei viel weniger vertreten. Das liegt aber nicht nur an der Matura und den Unis selbst.
Die Chancen werden vererbt, vieles entscheidet sich schon am Tag der Zeugung. Kinder kommen nicht mit denselben Möglichkeiten für ihre Bildung zur Welt. Zu unterschiedlich sind durch die unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten die Rahmenbedingungen, die wir aus dem Elternhaus oft mitbekommen.
Unterschiede im Kleinen wie im Großen
Kinder merken das. Am Offensichtlichsten zeigt es sich oft nicht einmal beim Lernen selbst. Meine Eltern waren selbst Lehrer:innen, ich hatte also bei weitem nicht die schlechtesten Chancen. Aber im Kontakt mit reicheren Schüler:innen spürte ich die Unterschiede zwischen uns oft trotzdem: Ich trug die Kleidung meines älteren Bruders, während andere mit Polo Ralph Lauren gekleidet waren. Ich trank später Dosenbier, sie den Champagner ihres Vaters. Beim Ausgehen hatte ich 15 Euro, andere einen Hunderter.
Man merkt, dass man nicht ganz dazu gehört. Aber all das steht für nur noch wichtigere Unterschiede, die andere noch viel stärker benachteiligen. Manches Kind hat sein eigenes Zimmer zum ruhigen Lernen und bezahlte Nachhilfe, ein anderes vielleicht nur einen Küchentisch rund um den beim Aufgaben machen noch zwei Geschwister turnen. Mancher hat den ersten Ferienjob in einem Lager, der andere lernt in der Kanzlei des Vaters ein bisschen die Welt der Juristerei kennen.
Das Ergebnis ist: Die Wege von Akademikerkindern sind oft vorgezeichnet – sie werden Ärzt:innen, Jurist:innen oder etwas ähnlich „Standesgemäßes“. Viele andere Kinder haben kein sicheres Netz, kein gut gefülltes Bankkonto mit dem man ein bisserl was riskieren und ausprobieren kann und keine super Kontakte im Hintergrund.
“Viele Dinge, die schön im Lebenslauf sind, waren für mich nie wirklich eine Option: wie unbezahlte Praktika oder Auslandssemester.” - Anna zu MOMENT.at
Nicht nur ein Gefühl
Die gesellschaftliche Schieflage ist an den Daten ablesbar.
Laut Momentum Institut machen von 100 Kindern mit zumindest einem studierten Elternteil 81 die Matura, und 67 beginnen ein Bachelorstudium. Von 100 Arbeiterkindern hingegen schaffen nur 37 die Matura, und lediglich 22 starten ein Studium.
Auch die Statistik Austria bestätigt diese Unterschiede. Nur 21,5 Prozent der Erwachsenen, deren Eltern maximal einen Pflichtschulabschluss haben, erreichen selbst Matura oder Hochschulabschluss. Kinder von Akademiker:innen schaffen das hingegen zu 82,5 Prozent. Sie verdienen später auch deutlich mehr.
Der Trend verschärft sich
Die jüngsten Ergebnisse der PISA-Studie zeigen, dass sich die Leistungsunterschiede zwischen den sozialen Schichten deshalb weiter vergrößern. Kinder mit weniger guten Startbedingungen schneiden zunehmend schlechter ab, während jene aus privilegierten Verhältnissen konstant gut bleiben.
In Österreich lassen sich rund 20 Prozent der Unterschiede in Mathematik auf den sozialen Hintergrund zurückführen – mehr als im OECD-Durchschnitt (15 Prozent). Nur acht Prozent der Kinder aus benachteiligten Verhältnissen schaffen es hierzulande in die Spitzengruppe – in anderen Ländern sind es immerhin zehn Prozent. Wobei man sich da an Ländern misst, die besser sind, aber auch noch lange nicht perfekt.
Der Trend zeigt klar: Bildungserfolg ist in Österreich noch immer eine Frage der Herkunft. Und der soziale Aufstieg ist extrem schwer. Etwa 5 bis 6 Generationen dauert es, bis eine Familie von niedrigsten zu den durchschnittlichen Einkommen aufsteigt.
Was tun die Schulen dagegen?
Für die Zeit bis zur Matura sind die Bildungsdirektionen zuständig. Alle wurden kontaktiert, doch nur Wien, das Burgenland und Kärnten haben geantwortet.Auch im eher ländlichen Burgenland sieht man, dass die soziale Herkunft bei der Ausbildungswahl nach wie vor eine große Rolle spielt. Die Lehre erscheint zudem oft als schnellere Möglichkeit, Geld zu verdienen. Schließlich muss sich eine Familie das Studieren erst einmal leisten können, und häufig fehlen Vorbilder im eigenen Umfeld.
In Kärnten verweist man auf die PISA-Ergebnisse – besonders Kinder mit Migrationshintergrund hätten Schwierigkeiten im Bildungssystem. Das hat freilich oft auch mit der sozialen Herkunft zu tun. Denn besonders in der Arbeiterschicht haben viele Familien sowohl weniger Geld als auch eine Migrationsgeschichte..
Wien zeigt sich selbstkritisch. Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs sagt: “Um die soziale Vielfalt an Hochschulen zu erhöhen, braucht es gezielte Maßnahmen entlang der gesamten Bildungslaufbahn.”
Die Stolpersteine im Bildungssystem
Diese Bildungslaufbahn macht es den Kindern nicht leicht. Das österreichische Bildungssystem kennt viele Schwellen: Die Trennung in Mittelschule und Gymnasium mit zehn Jahren ist eine erste Hürde, das Ende der Schulpflicht mit 15 eine weitere.
Fuchs schlägt einen Chancenindex vor, durch den Schulen mit besonderen Herausforderungen mehr Ressourcen, zusätzliche Förderangebote und bessere Infrastruktur erhalten könnten. Expert:innen weisen seit langem darauf hin, dass eine Schule noch lange nicht gerecht ist, nur weil sie alle gleich behandelt. Die unterschiedlichen Startbedingungen würden es erfordern, dass man manche auch mehr fördert.
Ziel müsse es sein, von Anfang an für gerechtere Chancen zu sorgen. Auch das Bildungsministerium betont, dass schulische Leistungen, institutionelle Rahmenbedingungen und familiäre Vorstellungen gemeinsam über Bildungswege entscheiden.
Gleiche Leistung – ungleiche Entscheidungen
Denn Familien wägen für Entscheidungen über die Bildung oft Kosten und Nutzen ab. Wenn die Eltern Akademiker:innen sind, geht es vermehrt Richtung Studium; bei anderen Familien ist das mitunter gar keine Option.
Der nationale Bildungsbericht zeigt aber auch: Nur ein Viertel der Unterschiede beim Übergang in die Mittelschule lässt sich durch Leistung erklären. Selbst bei gleichen Kompetenzen treffen Eltern aus verschiedenen sozialen Gruppen unterschiedliche Entscheidungen für ihre Kinder – und viele verzichten auf den Weg in eine höhere Schule.
Laut einer IHS-Studie im Auftrag des Bildungsministeriums stagniert diese Entwicklung seit Jahren. In der Corona-Zeit hat sie sich sogar weiter verschlechtert.
Was unternehmen die Universitäten?
Die Entscheidung, ob man die Matura macht oder an eine Uni gehen kann, fällt also meist nicht erst mit 18, sondern in vielen Fällen schon früher. Dass es dann eine Zentralmatura gibt, ist für Bildungspsychologin Christiane Spiel dann zwar ein Fortschritt. Es ist für diese Frage aber nicht mehr so bedeutend.
Trotzdem gibt es auch am Übergang zur Hochschule noch einmal Hürden. Ob eine Familie ihren Kindern Erfahrung mit dem Unibesuch vermitteln kann oder diese auf sich allein gestellt sind, ist nicht egal. An den Universitäten ist man sich des Ungleichgewichts längst bewusst. Auch deshalb setzen Universitäten zunehmend auf Programme, um Chancengleichheit zu fördern.
Die WU Wien berichtet, dass 40 bis 50 Prozent der Bachelorstudierenden sogenannte First-Generation-Students sind – also Menschen, die als Erste in ihrer Familie studieren. Dafür gibt es gezielte Angebote schon zum Studienstart.
Die Uni Graz verfolgt seit 2018 das Konzept einer „AntiBias-Universität“. Lehrende werden in Workshops für Privilegien und Vielfalt sensibilisiert.
In Innsbruck gibt es mit dem Projekt talentescout-tirol und einer eigenen Diversitätsstrategie weitere Versuche, Studierende aus nicht-akademischem Milieu zu erreichen.
Die BOKU setzt auf niederschwellige Angebote, etwa durch Schulbesuche von Forschenden oder Kooperationen mit Büchereien.
Die JKU Linz betont ein umfassendes Paket aus Nachteilsausgleichen, Bildungsinformationen, finanzieller Unterstützung, Mentoringprogrammen und Lerncoaches. Dazu kommen sichtbare Role Models aus dem Arbeiter:innenmilieu und die Sensibilisierung von Lehramtsstudierenden für die Lebensrealitäten ihrer zukünftigen Schüler:innen.
Was sagt die Bildungspsychologie?
Bildungspsychologin Spiel nennt die frühe Trennung im Schulsystem einen strukturellen Fehler, „aber nicht den einzigen. Entscheidend ist auch, wie Klassen zusammengesetzt sind. Wenn viele Kinder mit ähnlichen Schwierigkeiten – etwa sprachlichen – gemeinsam unterrichtet werden, verstärken sich die Nachteile gegenseitig.“ Auch wie viele Kinder in der Klasse sind, beeinflusst den Lernerfolg.
Am Ende machen sich soziale Probleme - wie die Aufteilung oder Verdichtung von Arm und Reich in gewissen Stadtteilen oder Bezirken - auch in den Schulen bemerkbar.
Auch Medien gefordert
Auch die Medien stehen für Spiel in der Verantwortung: „Lehrer:innen an Mittelschulen müssten mehr Anerkennung erhalten – und es müsse klar benannt werden, wo politische Fehler liegen.“ Sie kritisiert, dass Erfolgsgeschichten oft in der täglichen Nachrichtenflut verschwinden. Medien fokussieren stattdessen oft auf Skandale und Negativschlagzeilen. Es braucht mehr Sichtbarkeit für gute Praxis, ehrliche Zahlen und Mut machende Beispiele.“
Betroffene verstehen, was die Benachteiligung für sie bedeutet. Aber Spiel warnt und fragt: „Was bedeutet es, wenn so und so viele Kinder mit Potenzial nicht ins Gymnasium gehen?“ Die Benachteiligung hat gesamtgesellschaftliche Folgen, das müsse man allen verdeutlichen: „Vor kurzem ergab eine internationale Studie, dass 30 Prozent der Erwachsenen in Österreich nicht sinnerfassend lesen können.“
Was kann die Politik tun?
Neben dem umfangreichen Kampf gegen soziale Schieflagen und Ungerechtigkeiten hat die Politik auch kurzfristige Handlungsmöglichkeiten. Spiel fasst diese so zusammen: "Lehrer:innen aus Gymnasien sollten regelmäßig in Volksschulen hospitieren – und umgekehrt.“ Auch "die Trennung der Lehramtsausbildung nach Schultyp muss überdacht werden."
Sie fordert eine Systemreform, sieht auch frischen Reformwillen durch neues Personal in der Politik, gibt aber zu bedenken: "Wer ein selektives Bildungssystem jahrelang verteidigt hat, tut sich schwer, eine Kehrtwende zu machen, ohne das Gesicht zu verlieren." Die Rechnung dafür dürfen aber nicht die Kinder zahlen, die in für sie entscheidenden Jahren auf Reformen warten müssen.Am Ende geht es um Zugehörigkeit
Ein großes Problem sieht sie im fehlenden Vertrauen: "Lehrer:innen fühlen sich oft nicht ernst genommen. Die Verwaltung wiederum misstraut den Schulen. In einem solchen Klima kann sich Bildung nicht nachhaltig weiterentwickeln."
Ich selbst wünsche mir, dass sich künftig jede und jeder in unserem Bildungssystem angenommen fühlt – unabhängig davon, ob die Eltern das nötige Wissen oder Geld mitbringen.