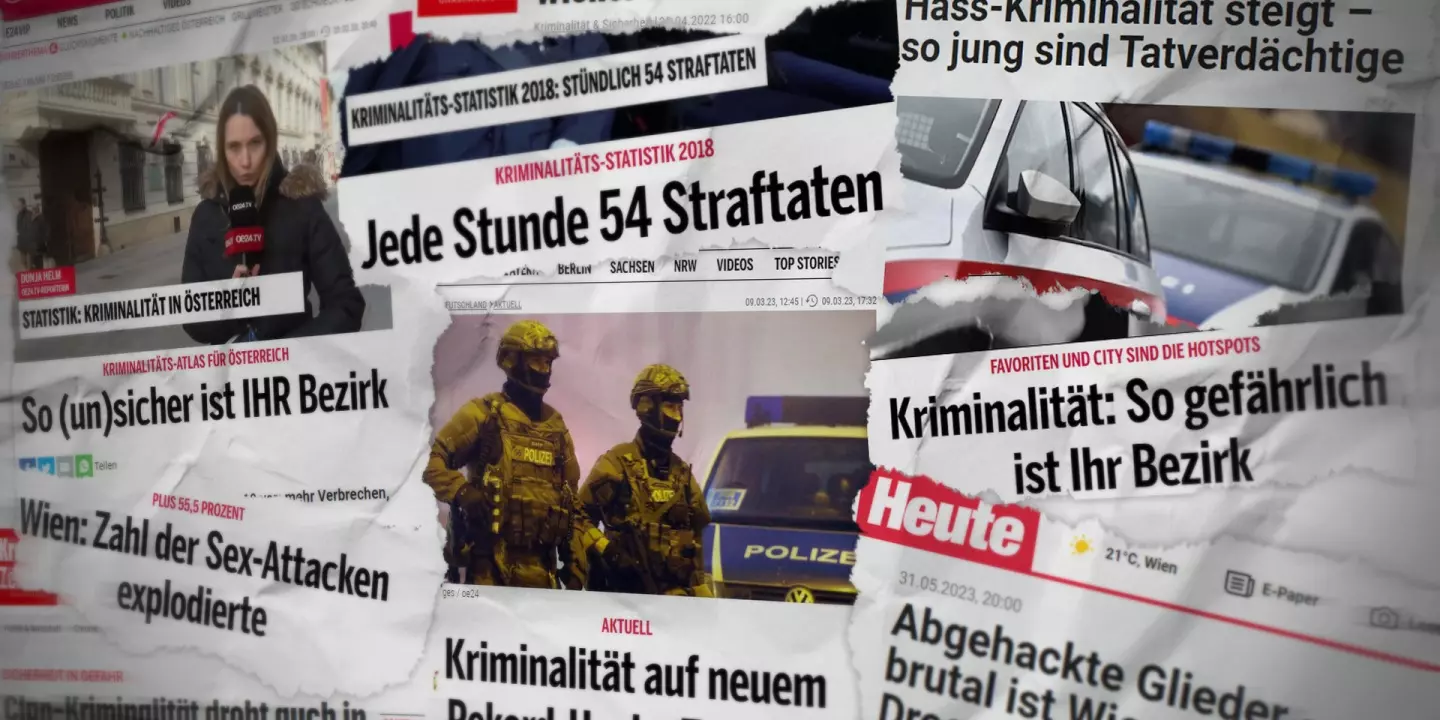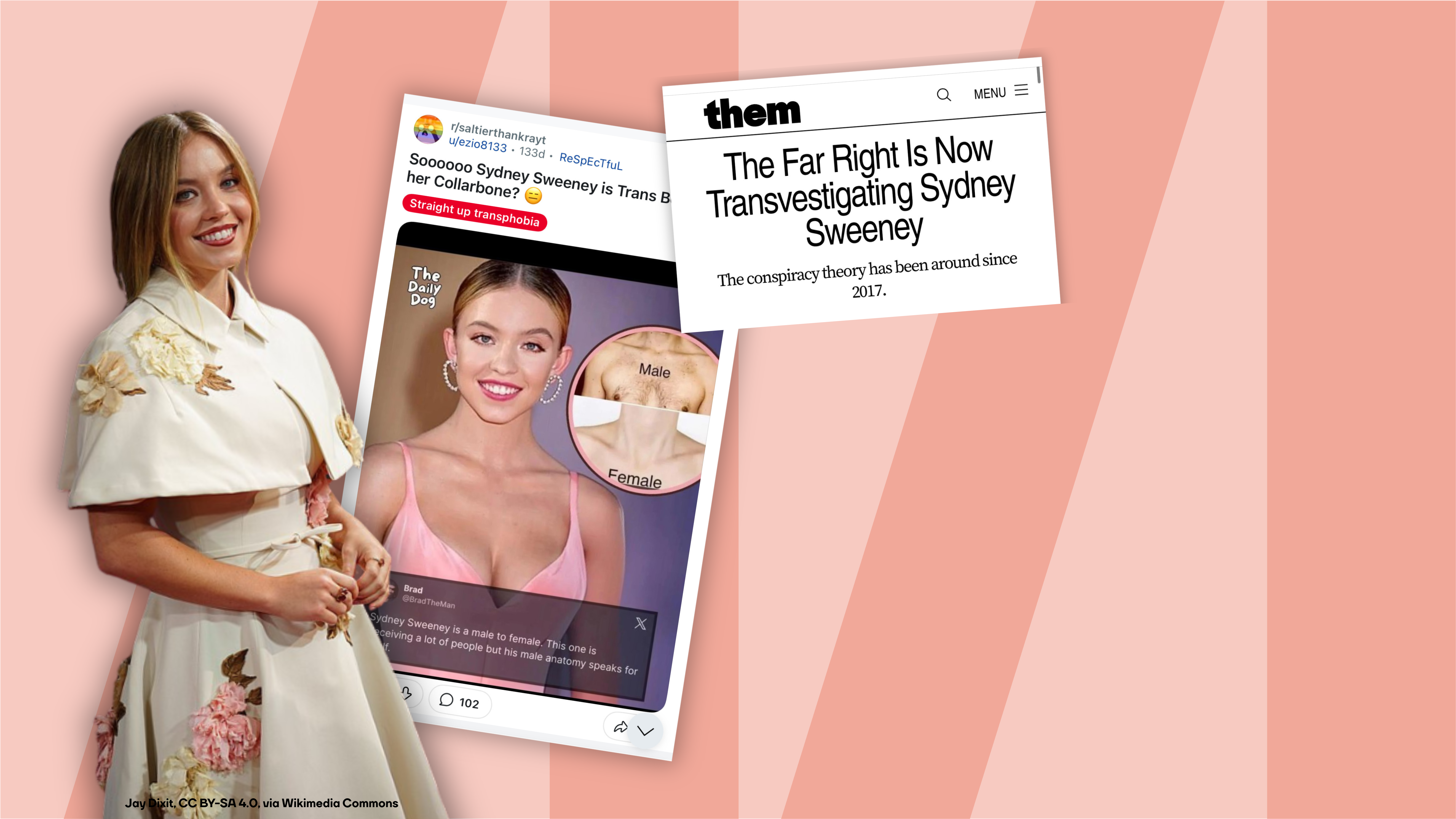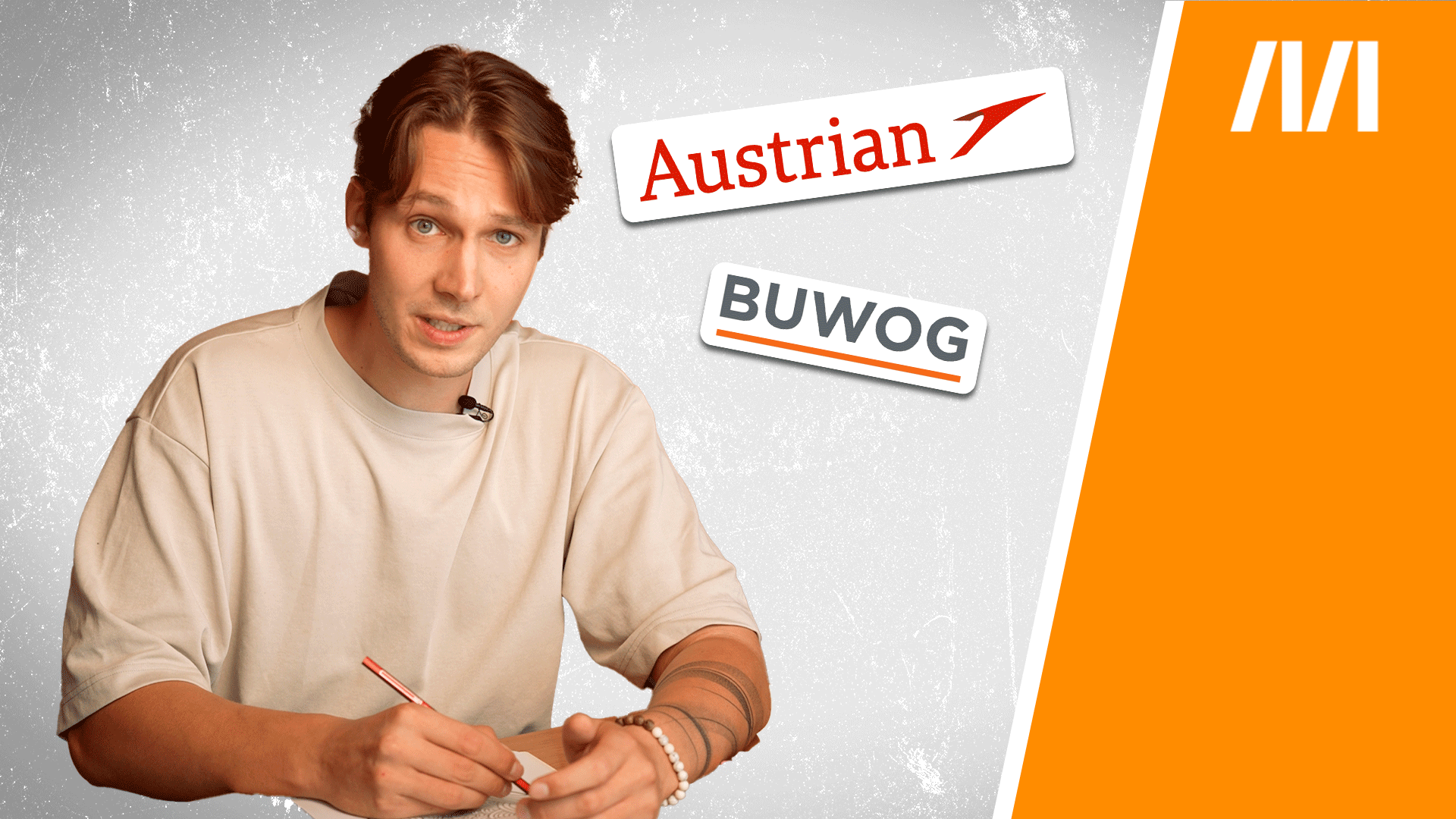Als Flüchtling geboren und ein ganzes Leben auf der Flucht
Mo und seine Freund:innen sitzen an einem warmen Nachmittag auf der Pilgramterrasse in Wien. Sie trinken ein kaltes Getränk und tauschen sich aus. Er hat schon wieder eine Job-Absage bekommen, erzählt er. Das mache ihn traurig. Aber auch wenn er hier unter Freund:innen ist, nicht alle verstehen ihn. Manche sind der Meinung, dass er sich doch nur genug anstrengen muss. Wenn er wirklich einen Job braucht, dann findet er schon einen.
Von dieser Reaktion ist Mo verwirrt. Sich so unverstanden zu fühlen, entsetzt ihn. Mo unterscheidet etwas von seinen Freund:innen, das seine Chancen schlechter macht. Er musste schon mehrfach in seinem Leben fliehen. Er heißt nicht Moritz, sondern Mohamed. Er ist kein Österreicher, sondern Afghane. Wie kann nicht klar sein, was für einen Unterschied das macht? Und das nicht nur bei der Jobsuche in Österreich.
Kein Zuhause, kein Ankommen
Schon dass Mo "aus Afghanistan" kommt, ist gar nicht so einfach. Denn geboren wurde er im Iran. “Ich wurde eigentlich als Flüchtling geboren”, sagt er. Seine Familie kommt ursprünglich aus Afghanistan - einem Land, das in seiner jüngeren Geschichte mehrere lange Kriege, viel Gewalt und autoritäre Machthaber hat. Spätestens seit Ende der 1970er-Jahre befindet sich Afghanistan fast ständig im Krieg oder leidet unter extremistischen Herrschern. Fast 5 Jahrzehnte lang.
Mo ist heute 30. Als er sechs Jahre alt ist, beschließt die Familie dennoch, in ihre afghanische Heimat zurückzukehren. Das mag auf den ersten Blick seltsam wirken, ist aber erklärbar. Denn so schwierig die Situation dort auch ist, im Iran haben Afghan:innen auch keine Zukunft. Mo darf etwa die Schule im Iran nicht besuchen.
Es ist nur eine von vielen Diskriminierungen, die er, seine Familie und die anderen Geflüchteten erleben. Noushin kennt die Situation gut. Die ehemalige Sozialarbeiterin betreute viele Afghan:innen, die aus dem Iran nach Österreich flohen. Sie kommt selbst ursprünglich aus dem Iran und will gerade deshalb darüber zu reden, wie diese Menschen im Iran behandelt werden: “Nehmen wir an, es entsteht eine Schlange vor der Bäckerei und irgendwann geht das Brot aus. Dann wird gesagt: Afghan:innen aus der Schlange raus!" Sie und ihre Bedürfnisse - selbst Grundbedürfnisse wie Essen - sind einfach weniger wert. "Manche Ärzt:innen nehmen Afghan:innen nicht als Patient:innen auf. Ein Leben dort absolut nicht zumutbar”, sagt Noushin.
Ankunft und Panik
Mo ist also als Sechsjähriger zum ersten Mal in der Heimat seiner Eltern, lebt in einem Land, das er nicht kennt und in dem Gewalt alltäglich ist. “2016 floh ich zurück in den Iran, in der Hoffnung auf ein besseres Leben und Veränderung.” Dort geht man aber auch zu diesem Zeitpunkt und bis heute immer noch schlecht mit Afghan:innen um. Obwohl mehr als 3,5 Millionen Afghan:innen im Iran seit Generationen leben, werden sie sowohl vom iranischen Regime als auch der Zivilbevölkerung als Menschen zweiter Klasse behandelt. Sie sind unerwünscht. In den vergangenen sechs Monaten wurden insgesamt 1,2 Millionen Afghan:innen wieder in das Land der Taliban abgeschoben. Darunter auch sehr viele anerkannte Flüchtlinge. Weitere Abschiebungen sind geplant.
Diesem Schicksal wollte Mo entgehen. "Nach einem Jahr musste ich weiter in die Türkei", erzählt er. Erwünscht sind Geflüchtete auch dort nicht: "Dort bekam ich kein Recht, legal zu arbeiten. Irgendwann hatte ich nicht mehr genug Geld, um selbst das Nötigste zu finanzieren.“ Deshalb floh Mo 2019 nach Griechenland, Lesbos. Mo beschreibt es einen Ort, „an dem ich nicht überleben konnte“. Für ihn und viele andere war Griechenland nur eine Zwischenstation auf der Flucht. Die Jobsuche erwies sich als aussichtslos. Unangenehme Zusammenstöße mit der Polizei gehörten zum Alltag. Mo ist klar, dass seine Flucht weitergehen muss. Nach einiger Zeit bekommt er von den griechischen Behörden ein "Travel Document". Es erlaubt ihm, sich innerhalb der Europäischen Union frei zu bewegen. Damit macht er sich 2022 auf den Weg nach Österreich. Unsicher, ob sich die Schwierigkeiten seines bisherigen Weges wiederholen würden.
"Ich habe Österreich mit großer Angst betreten. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich wollte auf keinen Fall zurück nach Afghanistan abgeschoben werden", erzählt Mo. Die Angst verschärft sich. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl habe die griechischen Dokumente nicht anerkannt, sagt er. Man habe nicht nachvollziehen können, warum er nach Österreich geflohen ist, obwohl er bereits Papiere hat. Dass Mo in Griechenland keine Chance auf ein Leben hatte, habe niemanden interessiert. Nach seinem ersten Interview warnt ihn der Dolmetscher auf Farsi: "Du wirst sicher in ein Camp kommen und danach abgeschoben." Kurz darauf sperren die Beamt:innen Mo fünf Stunden lang in eine Zelle. Der Umgang mit ihm sei, wie er sagt, "einfach respektlos“ gewesen.
Schon wieder ein Flüchtlingsheim
Von der Zelle bringen sie Mo nach Traiskirchen, das größte Flüchtlingsheim Österreichs, das als zentrale Erstaufnahmestelle für Asylsuchende dient. Mo versteht nicht, was passiert und weiß nicht, ob er nun nach so vielen Jahren auf der Flucht endlich in Sicherheit und am Beginn eines neuen Lebens ist. Als er in Traiskirchen ankommt, schockieren ihn auch hier die Lebensumstände. Er berichtet von überfüllten Schlafräumen und unhygienischen Zuständen. Alles passiert viel zu schnell.
Er bekommt Flashbacks an die Camps in Griechenland. Alte Bilder und Erinnerungen brechen auf. Die Angst, abgeschoben zu werden, begleitet ihn die ganze Zeit. Das ist belastend. Hilfe zu finden ist in Traiskirchen fast unmöglich, erklärt mir Mo. Ärzt:innen seien oft überlastet gewesen, das Personal habe willkürlich unpassende Medikamente wie Paracetamol an Flüchtlinge verteilt. “Der Zugang zu Therapeut:innen, Sozialarbeiter:innen oder Anwält:innen ist dort fast unmöglich“, erklärt er.
Flucht vs. Gesundheit
Menschen mit mehrfacher Fluchterfahrung werden mit ihren Ängsten und vielen erlittenen Traumata allein gelassen - auch nachdem sie die Aufnahmezentren verlassen haben. Was Mo erlebt ist kein Einzelschicksal. Laut einem WHO-Bericht haben Geflüchtete ein erhöhtes Risiko für körperliche und psychische Erkrankungen. Sie sind vor und während der belastenden Flucht zahlreichen Risikofaktoren ausgesetzt: Krieg, Gewalt, Folter, Hunger, der Verlust von Angehörigen und Trennung von der Familie. Auch nach der Ankunft kommen neue Belastungen hinzu - Isolation, Unsicherheit über den Aufenthaltsstatus und Diskriminierung. Die Folgen sind häufig Depressionen, Angststörungen und posttraumatische Belastungen.
Trotz all dieser besonderen Belastungen bekommen Geflüchtete sogar seltener psychotherapeutische Hilfe. Denn der Zugang zu medizinischer Versorgung ist oft erschwert: Sprachbarrieren, fehlende Dolmetscher:innen, finanzielle Hürden und Stigmatisierung verhindern eine ausreichende Behandlung. Besonders geflüchtete Frauen sind gesundheitlich stark belastet.
Raus aus Traiskirchen
Auch für Mo ist diese Hilfe erst einmal unerreichbar. Sein Glück ist, dass er bereits Freund:innen in Wien kannte. Mit ihrer Hilfe verließ er schnell das Heim und zog in eine private Wohnung. Viele Geflüchtete haben diese Chance nicht, weil ihnen die Kontakte fehlen.
Auch Noushins Klient:innen hatten große Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche: “In Wien ist es für Leute mit Subsidiärschutz meistens erst nach einer Asylanerkennung möglich, eine Gemeindewohnung zu bekommen.” Diese Anerkennung dauert oft viele Jahre. “Auf dem privaten Markt ist es auch nicht einfach. Diskriminierung und fehlendes Einkommen machen die Wohnungssuche richtig schwer”, erklärt sie.
Schon Menschen mit ausländisch klingenden Namen und Akzent werden bei der Wohnungssuche stark benachteiligt. Sie bekommen nur etwa halb so oft sofort Zusagen für Besichtigungstermine wie Personen mit österreichischem Namen. Für Geflüchtete während des Asylverfahrens mit Sprachbarrieren und sehr wenig verfügbarem Einkommen ist es noch viel schwieriger.
Am Arbeitsmarkt ist es ähnlich
Mit ähnlichen Problemen fühlt sich Mo am Arbeitsmarkt konfrontiert. Erst seit diesem Jahr darf er legal arbeiten. Er hat subsidiären Schutz erhalten hat. Dieser Status erlaubt abgelehnten Asylwerber:innen einen Aufenthalt in Österreich, wenn ihnen im Herkunftsland Folter, Todesstrafe oder Krieg drohen. Sie gelten damit jedoch nicht als anerkannte Flüchtlinge nach der Genfer Konvention. Der Schutz ist nur befristet und muss danach verlängert werden.
Auch nach 30 Jahren im Krieg und auf der Flucht, hat Mo damit keine langfristige Sicherheit. Aber er versucht, sich etwas aufzubauen. Mo bewirbt sich für viele Jobs, etwa bei Supermärkten, wo Unternehmen seit Jahren über Personalmangel klagen - oder bei der Post. “Ich habe mich bei allen Hofer-Filialen beworben und dachte: ‘Irgendwer wird mich schon nehmen’”. Doch stattdessen kam Absage um Absage. Er wurde zu keinem einzigen Bewerbungsgespräch eingeladen.
Schlechte Chancen auf Arbeit
Dass Menschen mit Migrationsgeschichte es schwerer haben, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden als Österreicher:innen, ist keine Neuigkeit. Eine Studie der Johannes Kepler Universität Linz zeigt: Bewerber:innen mit Migrationshintergrund haben schlechtere Chancen. Mit deutschem Namen lag die Einladungsquote bei 19 %, mit türkischem Namen bei 13 %. Trug die Bewerberin zudem ein Kopftuch, sank die Quote sogar auf nur 4 %.
Menschen wie Mo haben es jedoch oftmals noch schwerer. Trotz eines Aufenthaltsstatus sind die Hürden groß. Für viele Jobs braucht man eine passende Ausbildung oder gute Deutschkenntnisse. Dazu kommt, dass sie auf der Flucht und während des Asylverfahrens in den Jahren davor nicht arbeiten konnten und durften: In Österreich dürfen Unternehmen Asylwerber:innen nur dann einstellen, wenn keine Person mit österreichischer oder europäischer Staatsbürgerschaft für die Stelle infrage kommt.
“Menschen nehmen an, dass wir die gleichen Chancen”, sagt Mo zur eingangs erwähnten Diskussion mit Freund:innen. Das ist ein Ausdruck von fehlendem Verständnis für seine schwierige Situation. Er fühlt sich dadurch auch ausgegrenzt. “Selbst wenn manche mehr Verständnis zeigen, fällt es mir schwer, mich in eine geschlossene Gesellschaft einzugliedern.” Davon auszugehen, alle hätten die gleichen Voraussetzungen, ist objektiv falsch. Aber nicht nur das. Es ist auch befremdlich und verletzend für Betroffene. “Ich spüre ständig die von oben herab gerichteten Blicke. Ich stehe dabei immer unten.”