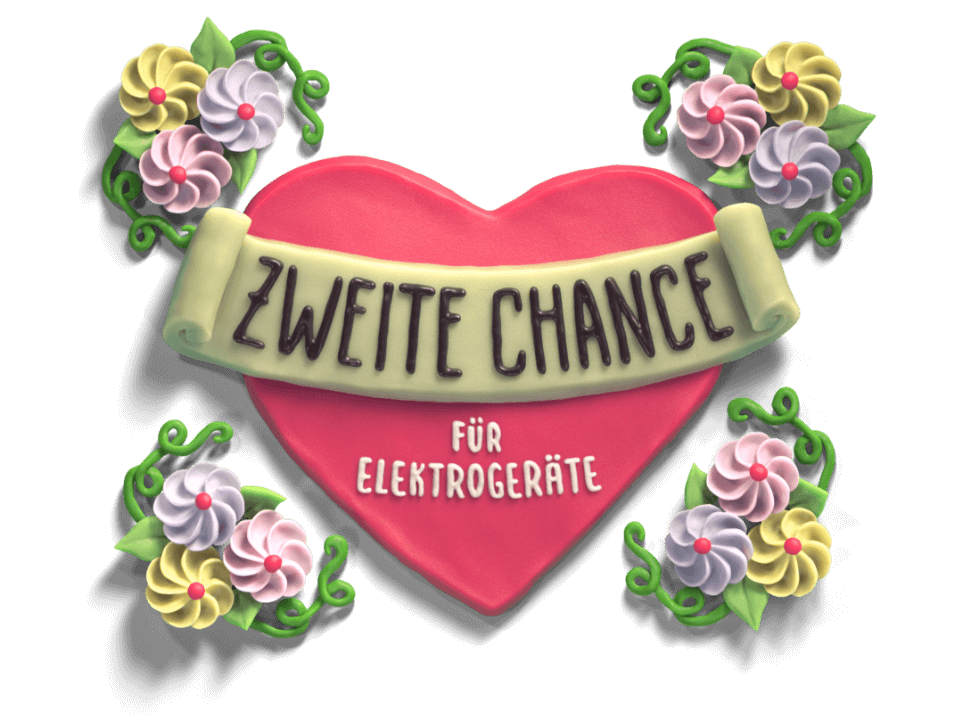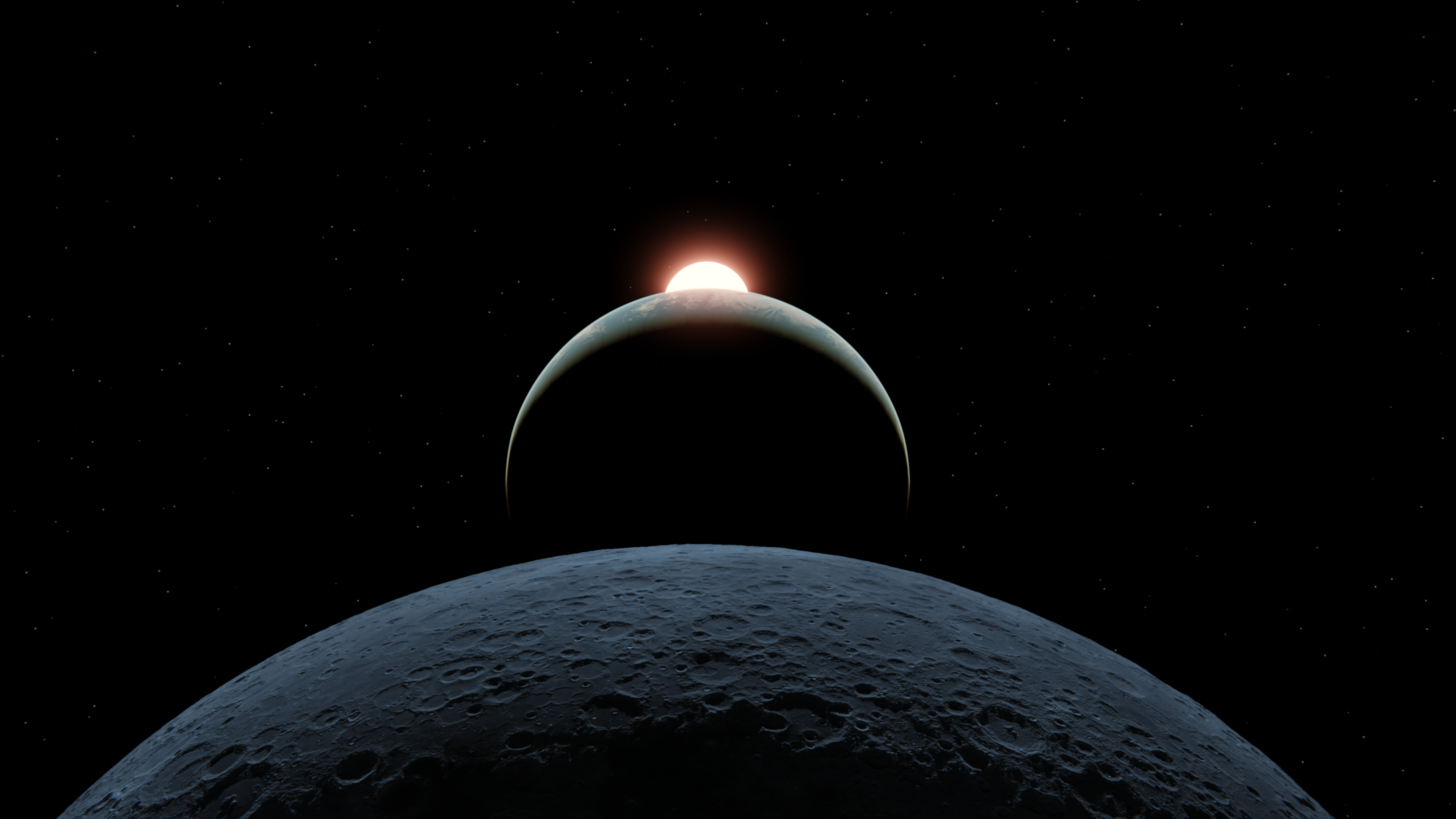Enshittification oder: Es wird wirklich alles immer schlechter

Früher war alles besser. Also: zumindest das Internet und soziale Medien. In meiner Jugend (die jetzt auch noch nicht sooo lange her ist) sah man auf Facebook, was Freunde und Bekannte so trieben, Youtube lief ohne Unterbrechung nebenbei.
Mittlerweile hat sich bei vielen Menschen Frustration breit gemacht. Der Tenor des Grantelns klingt etwa so: Werbung trotz Abos, Passwort teilen geht nicht mehr, Social Media ist ein hasserfülltes Moloch voller Werbung geworden, und Plattformen wie AirBnB, Uber oder Amazon machen Produkte irgendwie auch weder besser noch billiger.
Dieses Gefühl ist weder eingebildet noch subjektiv. Das Phänomen existiert tatsächlich, und es hat auch einen Namen: Enshittification.
Wie aus gut beschissen wird
Der vulgär klingende Begriff ist bewusst provozierend. Das Wort „Enshittification” wurde vom kanadischen Autor und Internetaktivisten Cory Doctorow geprägt. Ursprünglich wurde es für soziale Netzwerke verwendet, mittlerweile auch für Plattformen und digitale Produkte. Enshittification beschreibt den schleichenden Verfall digitaler Dienste und Produkte: Zuerst sind sie toll. Dann werden sie schlechter. Und irgendwann sind sie komplett im Eimer – nur leider sind wir bis dahin oft schon komplett abhängig von ihnen.
Doctorows Theorie ist, dass Plattformen am Anfang gut funktionieren, weil sie Nutzer:innen anlocken wollen. Alles ist gratis oder günstig, übersichtlich, nützlich. Dann, sobald genug Menschen sie nutzen, wird die Plattform langsam zu einem Ort, an dem zuerst die Nutzer:innen ausgenommen werden (mehr Werbung, weniger Kontrolle), dann die Anbieter:innen oder Verkäufer:innen (höhere Gebühren, schlechtere Sichtbarkeit), und am Ende wird alles dem ultimativen Ziel untergeordnet, Investor:innen und Shareholder:innen glücklich zu machen.
Der technische Ausdruck dafür wäre vielleicht „monetarisierungsgetriebene Degradierung digitaler Systeme”. Aber Enshittification trifft das Problem und das Gefühl einfach besser.
Soziale Netzwerke: Von Community zu Kommerz
Soziale Netzwerke sind das beste Beispiel für Enshittification in Action. Früher waren sie ein Ort, um mit Freund:innen in Kontakt zu bleiben, Memes zu teilen, vielleicht einen peinlichen Status zu posten. Heute fühlen sie sich an wie eine Mischung aus Teleshopping-Kanal und Trollfabrik.
Auf Instagram sieht man kaum noch, was Freund:innen posten – stattdessen Reels von Fremden, die einem irgendwas andrehen wollen. Wer seine Reichweite behalten will, muss ständig mit dem Algorithmus tanzen oder zahlen.
TikTok? Anfangs überraschend kreativ, heute voll mit Werbung, seichtem Content und einer Blackbox-Logik, in der niemand so genau weiß, warum welches Video durch die Decke geht oder eben nicht. Von extremistischen und radikalen Inhalten noch gar nicht zu reden.
Facebook hat sich längst von der Jugend verabschiedet und ist jetzt das digitale Pendant zu einem Einkaufszentrum in der Vorstadt: überfüllt, laut, unübersichtlich und irgendwie deprimierend.
Kurz gesagt: Aus sozialen Netzwerken wurden Werbenetzwerke und Datenkraken. Orte, wo wir als Nutzer:innen für unsere Daten nicht bezahlt werden, sondern im Gegenteil mit unserer Aufmerksamkeit, unseren Daten und unserer Geduld zahlen.
Abo statt Besitz - alles nur noch geliehen
Auch abseits von Social Media zieht sich die Enshittification durch unseren digitalen Alltag – besonders deutlich wird das beim Thema Eigentum. Oder besser gesagt: Nicht-Eigentum. Denn besitzen tun wir dank der ausgeklügelten Systeme, Abos und Plattformen kaum mehr digitale Produkte oder Inhalte.
Früher kaufte man eine CD, eine Software oder ein Spiel – und besaß es dann für immer, konnte es teilen oder weiterverkaufen. Heute mieten wir eigentlich alles: Serien bei Netflix, Musik bei Spotify, Bildbearbeitung bei Adobe, Office-Programme bei Microsoft. Monat für Monat zahlen wir brav, doch wirklich besitzen tun wir nichts. Wird das Abo gekündigt oder die Plattform stellt Inhalte offline, ist alles weg – inklusive Zugriff auf das, was wir vielleicht schon jahrelang genutzt oder sogar kreativ damit erschaffen haben.
Auch beim Gaming wird das Prinzip durchgezogen. Spiele wie FIFA oder Die Sims sind nicht mehr Produkte, sondern Services, abhängig von Servern, Updates und Mikrotransaktionen. Wer einen alten Titel nochmal spielen will, kann Pech haben: abgeschaltet, unbrauchbar oder für immer aus dem Store gelöscht.
Noch absurder wird es, wenn Plattformen nachträglich Inhalte verändern oder Funktionen einschränken. Amazon etwa hat schon gekaufte E-Books von Kindles gelöscht– auch wenn man dafür bezahlt hat.
Das alles ist kein Zufall, sondern Teil des Systems. Besitz gibt Nutzer:innen Kontrolle. Abos machen sie abhängig – und leichter monetarisierbar.
Kaum gekauft, schon kaputt
Natürlich macht die Enshittification auch vor physischen Produkten nicht halt. Den Begriff „geplante Obsoleszenz” - also „geplante Alterung”, „geplanter Verschleiß” - gibt es schon länger. Er beschreibt die abnehmende Lebensdauer von Hardware oder Haushaltsgeräten und klingt zwar auf den ersten Blick wie eine Verschwörungstheorie, ist aber in Wahrheit ein schon seit vielen Jahren eiskalt kalkuliertes Geschäftsmodell. Warum ein langlebiges Produkt bauen, wenn man auch alle zwei Jahre ein neues verkaufen kann? Dass Omas Bügeleisen so viel länger hält als meines, liegt also tatsächlich nicht daran, dass Technologie und Materialien seitdem schlechter geworden sind.
Nun fallen diese Produkte zusätzlich auch noch der Enshittification zum Opfer. Denn längst braucht man auch für Drucker, Staubsauger oder Geschirrspüler Software, Apps und Abos.
Auch Akkus von Geräten lassen sich kaum noch von den Nutzer:innen selbst austauschen, Ersatzteile sind teuer oder gar nicht erhältlich, und nach wenigen Jahren bieten Hersteller keine Software-Updates mehr an. Deshalb werden Geräte frühzeitig entsorgt, obwohl sie technisch noch bestens funktionieren. Schließlich wartet bereits das Nachfolgemodell auf Käufer:innen.
Ein absurdes Beispiel: Landwirt:innen können moderne Traktoren von John Deere zwar kaufen,aber nicht mehr selbst reparieren. Warum nicht? Weil die Software gesperrt ist – Reparaturen sind nur mit autorisierten Tools und über Partnerfirmen erlaubt (zu erheblichen Kosten, versteht sich). Wer die Reparatur trotzdem selbst wagt, riskiert Garantieverlust und Fehlermeldungen.
Gegenbewegungen wie das „Right to Repair“, das Recht auf Reparatur, gewinnen langsam an Fahrt. Doch große Hersteller wehren sich dagegen. Denn reparierbare, langlebige Geräte sind schlecht für Quartalszahlen und Investor:innen.
Alles ist enshittified - und was tun wir jetzt?
Social Media, Streaming-Plattformen, Apps, Geräte und Dienste haben im digitalen Alltag eines gemeinsam: Sie funktionieren immer nach dem gleichen wirtschaftlichen Muster. Der Fachbegriff dafür ist Surveillance Capitalism, also Überwachungs-Kapitalismus. Damit ist ein Geschäftsmodell gemeint, das auf der systematischen Sammlung und Verwertung von Nutzerdaten basiert.
Digitale Plattformen und Marktplätze sind meist privat finanziert, also ihren Investor:innen gegenüber zu Rechenschaft verpflichtet und nicht den Nutzer:innen. Und Investor:innen wollen vor allem eines: Wachstum und Rendite. Das führt dazu, dass selbst gut gemeinte Produkte früher oder später „optimiert“ werden, also zur Profitmaximierung ausgeschlachtet werden..Das Muster ist hierbei immer dasselbe: Erst werden die Nutzer:innen angelockt (alles ist gratis, einfach, cool), dann die Anbieter:innen (z. B. Creator:innen oder Verkäufer:innen); dann, sobald der Marktanteil groß genug ist, werden alle gemeinsam abgezockt.
Was für Verbraucher:innen oft wie ein zufälliger Einzelfall wirkt, etwa die Werbung auf Netflix, der verschwundene Like-Button auf Instagram oder die absurde Preisgestaltung bei Adobe-Produkten, ist in Wahrheit ein strukturelles Problem. Plattformen haben keinen Anreiz, langfristig fair oder nachhaltig zu agieren, solange ihre Marktmacht ungebrochen bleibt und keine Konkurrenz existiert. Und durch Netzwerk- und Lock-in-Effekte wird diese Macht immer größer.
Die Folge: Wir verlieren Kontrolle, Rechte, Besitz und Transparenz über unsere Produkte und Daten. Zuerst in kleinen, einzelnen Schritten, dann oft merkbar immer schneller. Bis wir irgendwann merken, dass wir nur noch zahlende Gäste in einer Welt sind, die uns benutzt, anstatt von uns benutzt zu werden.
Aber es muss nicht so bleiben. Enshittification ist nicht unvermeidbar, Widerstand ist möglich – und dringend notwendig.
Es braucht Wut und Mut
Was können wir als Nutzer:innen und Bürger:innen also tun?
Es beginnt mit digitaler Souveränität. Wir können Dienste nutzen, die auf Datenschutz und Dezentralität setzen, zum Beispiel Signal statt WhatsApp, Mastodon statt X oder LibreOffice statt Microsoft 365. Überall dort, wo es möglich ist, lohnt es sich, zu kaufen, statt zu mieten – besonders bei Software, Medien oder Geräten. Denn Besitz bedeutet Kontrolle und schützt vor willkürlichem Zugriff oder plötzlichem Entzug.
Auch im Umgang mit Hardware und Geräten können wir aktiv gegensteuern: Reparieren statt wegwerfen sollte nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch sinnvoll sein. Die Regierung muss die Weichen für ein echtes Right to Repair stellen.
Jede:r Einzelne kann Druck auf die Politik ausüben und fordern, dass sie die Plattformen reguliert, das Kartellrecht verschärft, Open-Source-Alternativen fördert und eine gerechtere Steuerpolitik umsetzt. All das sind grundlegende Voraussetzungen für eine digitale Welt, die nicht ausschließlich Konzernen dient.
Jede:r Einzelne kann auch Wissen weitergeben. Egal ob im Freundeskreis, am Arbeitsplatz oder in der Schule, es braucht mehr Menschen, die Debatten über Problem und Alternativen anstoßen. Digitale Aufklärung ist schon lange kein Nerd-Thema mehr, sondern Teil des täglichen Lebens und auch von zivilgesellschaftlichen Debatten. Je mehr Menschen verstehen, welche Prozesse sich abspielen und warum, desto größer wird die Chance, Alternativen zu schaffen.
Und nicht zuletzt: Den Mut nicht verlieren. Denn dass Enshittification kein Naturgesetz ist, sondern bewusst designt und hergestellt, bedeutet auch: sie kann wieder zurückgedrängt werden. Vielleicht nicht überall, vielleicht nicht sofort. Aber Veränderung beginnt immer damit, Dinge beim Namen zu nennen. Deshalb: Nein, ihr bildet euch das nicht ein. Die Dinge werden schlechter – nicht zufällig, sondern weil es sich rechnet. Das nennt sich Enshittification. Und es hört erst auf, wenn wir anfangen, uns zu wehren.