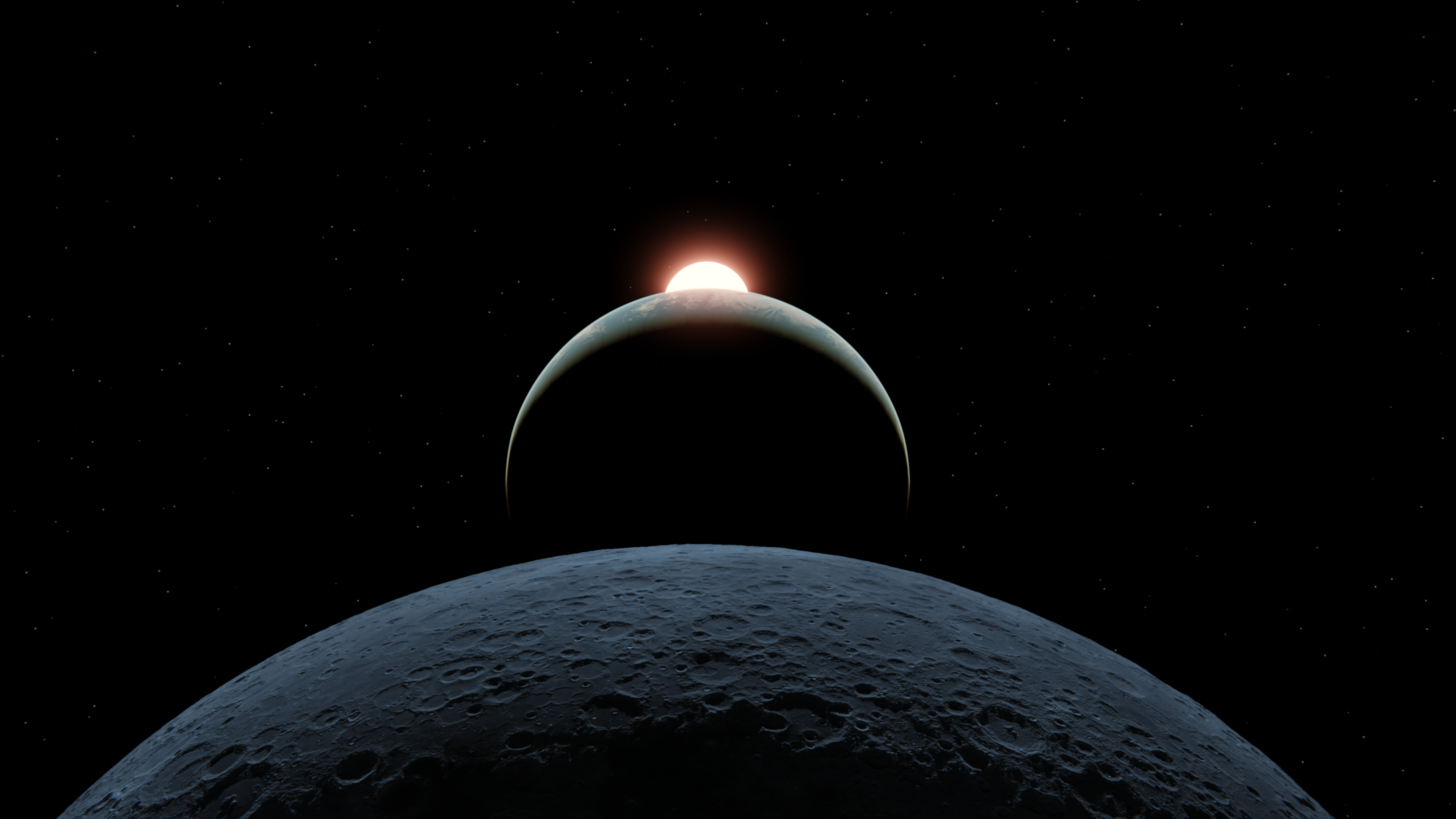Fressen, gefressen werden und Geld verbrennen - wie Essenslieferdienste wirtschaften

Wäre ich nur auf die Lieferdienste angewiesen, dann ginge sich das nicht aus
Pizzeria-Chef in Wien
Das sei natürlich besser als gar kein Geschäft zu haben. Aber: „Vorher habe ich das nie wirklich durchgerechnet“, sagt er. „Jetzt sehe ich: Wäre ich nur auf die Lieferdienste angewiesen, dann ginge sich das nicht aus.“ Nur in Kombination mit dem normalen Restaurantbetrieb „ist es okay“.
Mjam und Lieferando bekommen ein Drittel der Pizza
Der Lokalbesitzer möchte lieber anonym bleiben. Er hat Bedenken, seinen Namen in Medien zu lesen, während er offen über die Online-Essenslieferanten spricht und was sie von ihm kassieren. „Sonst sperren die vielleicht meinen Zugang zur Plattform“, sagt er. Wer bei ihm für 15 Euro online ein Essen bestellt und es sich liefern lässt, zahlt reell nur 9,50 Euro in die Kasse der Pizzeria.
Den Rest streifen die Lieferdienste ein. „Ich zahle 30 Prozent Provision pro Bestellung“, sagt der gebürtige Italiener, der mittlerweile seit zehn Jahren in Wien lebt. „Dazu kommt noch pauschal ein Euro für jede Auslieferung.“ Versteuern muss er die Provisionen übrigens auch noch.
Ein nettes Sümmchen kommt da zusammen für die beiden Platzhirsche: Die Mjam GmbH und Lieferando.at, teilen sich den österreichischen Markt unter sich auf. Dafür, dass sie nur die Bestell-Plattform bereitstellen und das Essen ausliefern ist es sogar recht viel Geld.
Fahrrad und Diensthandy bringt ihr bitte selber mit!
Ihre LieferantInnen, die mit klobigen Warmhalteboxen auf dem Rücken durch die Stadt düsen, sind fast ausschließlich prekär beschäftigt. Sie sollen ihr für den Job unabdingbares Fahrrad am besten selbst mitbringen. Das ebenfalls obligatorische Smartphone ist ausnahmslos das private der FahrerInnen.
Lieferando leistet sich gar den Luxus, in Österreich nur eine Adresse in der Wiener Operngasse anzugeben. Dazu stehen im Impressum eine Faxnummer und eine E-Mail-Adresse. Das Geschäft hierzulande ist für das Unternehmen offenbar so leicht zu organisieren, dass es sogar behaupten kann, in Österreich gar keinen Betrieb zu unterhalten. Lieferando Österreich sei nur eine Zweigniederlassung der deutschen Abteilung von Lieferando.
So konnte das Unternehmen im vergangenen Jahr auch einschreiten, als die MitarbeiterInnen einen Betriebsrat gründen wollten. Wo kein Betrieb, da kein Betriebsrat, ist doch logisch.
So etwas wie ein Betriebsrat passt nicht ins Business-Modell, hat die Firma uns gesagt.
Adele Siegl, Ausfahrerin bei Mjam
Unter der Belegschaft der Essenslieferdienste herrscht ein großes Kommen und Gehen: Wer gestern noch da war, ist morgen vielleicht schon wieder weg. "Das nimmt das Unternehmen auch gern in Kauf", sagt die Wienerin Adele Siegl, die für Mjam Essen ausfährt zu MOMENT.
"Erstens kommt sie das billiger und zweitens organisieren sich die FahrerInnen schwerer, wenn sie den Job eh nicht lange machen wollen." Als die MitarbeiterInnen von Mjam sich 2017 organisierten, war die Firma irritiert. "So etwas wie ein Betriebsrat passt nicht in das Business-Modell, haben sie zu uns gesagt", erinnert sich Siegl.
Mehr Rechte für MitarbeiterInnen? Dann sperren wir zu
In Kanada sperrte Foodora, ein Schwesterunternehmen von Mjam, vor ein paar Tagen den Laden zu. Zuvor hatten die AuslieferInnen erfolgreich dafür gestritten, nicht nur Selbständige zu sein, sondern "abhängige AuftragnehmerInnen" des Unternehmens. Außerdem konnten sie nun einer Gewerkschaft beitreten.
Für Foodora war das offenbar zu viel. Es meldete Insolvenz an. Die ehemaligen MitarbeiterInnen werden von ihren noch offenen Gehaltsansprüchen wohl nicht allzu viel sehen. Gleichzeitig vermeldete Delivery Hero SE, Mutterkonzern von Mjam und Foodora, für das erste Quartal dieses Jahres einen neuen Umsatzrekord.
In Österreich gilt seit dem 1. Jänner dieses Jahres ein von der Gewerkschaft Vida lange geforderter Kollektivvertrag für Fahrradboten. Angestellt sind die MitarbeiterInnen der Essenslieferdienste aber nur im Ausnahmefall. Bei Mjam sind es derzeit nur 10 Prozent - der Rest sind freie DienstnehmerInnen. Acht Euro pro Stunde „garantiertes Gehalt“ ruft Mjam derzeit in Jobanzeigen auf.
Zu unseren Umsatzzahlen darf ich leider keine Angaben machen.
Charlotte Noir, Sprecherin Mjam
Die Lieferdienste zwacken einen großen Teil der Einnahmen der Lokale ab. Ihre FahrerInnen erhalten Löhne am ganz unteren Ende der Verdienstskala und müssen dafür ordentlich schwitzen. De facto nur zwei große Unternehmen sind in Österreich unterwegs. Und dennoch: Die Online-Essenslieferdienste schreiben Jahr für Jahr Verluste an.
Wie es in Österreich aussieht? "Zu unseren internen Daten sowie Bestell- und Umsatzzahlen darf ich leider keine Angaben machen", sagt Mjam-Sprecherin Charlotte Noir zu MOMENT. Lieferando reagierte erst gar nicht auf unsere Anfrage.
Mit jeder ausgelieferten Pizza 60 Cent Verlust
Die deutsche Mjam-Mutter Delivery Hero gab dagegen im Februar offen zu: Mit jeder ausgelieferten Pizza verliere sie 60 Cent. Es klingt absurd: Jede Bestellung mehr und jeder Neukunde vergrößert das Minus. Und doch ist das die Strategie: Mehr KundInnen, mehr Bestellungen, mehr Mehr, Verluste egal. Eine konservativ rechnende Buchhalterin würde da die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
Der Lieferando-Eigner Takeaway.com BV mit Sitz in den Niederlanden feuert in seiner Konzernbilanz eine ganze Batterie an imposant klingenden Zahlen ab. In hübsch aufbereiteten Grafiken steht dort, wie viel mehr KundInnen im vergangenen Jahr auf den Bestellen-Button klickten und wie viele Restaurants sich der Lieferkette neu angeschlossen haben. Es steht dort, wie viel Umsatz und wie viel mehr an Umsatz damit erzielt wurde.
Was fehlt ist aber, wie viel Gewinn oder Verlust Takeaway.com im vergangenen Jahr erwirtschaftet hat. Darüber informiert das Unternehmen erst auf Seite 195 des Jahresberichts. In einer schnöden Tabelle und sehr kleiner Schrift aufgelistet steht da: Knapp 120 Millionen Euro verlor Takeaway.com im vergangenen Jahr, bei einem Umsatz von 427 Millionen Euro.
So viel Geld zum Verbrennen muss man erstmal haben
Der große Konkurrent Delivery Hero spielt da schon in einer anderen Liga: Was Takeaway.com an Umsatz machte, fuhren die Deutschen im vergangenen Jahr allein an Verlusten ein. Ein Loch von 432 Millionen Euro tat sich 2019 in der Kassa von Delivery Hero auf, bei 1,46 Milliarden Euro Umsatz.
Die Berliner gehören zur Startup-Schmiede Rocket Internet SE der Samwer-Brüder. Sie sind bekannt dafür, in wohl so ziemlich jedes Irgendwas-mit-Internet-Geschäftsmodell schon einmal investiert zu haben. Insgesamt machte Delivery Hero seit der Gründung 2013 laut Geschäftsberichten einen operativen Verlust von mehr als einer Milliarde Euro.
Wir werden die Gewinnschwelle knacken, wenn wir groß genug sind
Niklas Östberg, Geschäftsführer Delivery Hero
So viel Geld zum Verbrennen muss man erstmal haben. Die Essenslieferdienste brauchen Investoren, die permanent sogenanntes Wagniskapital zuschießen. Doch wer soll ein defizitäres Geschäft finanzieren, von dem bezweifelt werden kann und wird, ob es jemals Gewinne erzielt?
Der Trick, wenn man es so nennen möchte: Delivery Hero, Takeaway.com und Co. bieten das Versprechen auf eine goldene Zukunft. Das Mantra lautet seit Jahren: Ist man groß genug, dann gibt es den großen Reibach. "Wir werden die Gewinnschwelle knacken, wenn wir groß genug sind", sagt Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg im April.
Delivery Hero übernimmt pro Jahr zwei Konkurrenten
Wer so lange nicht warten möchte, kann seine Anteile auch verkaufen. Mit etwas Glück um ein Vielfaches von dem, was man bezahlt hat. Beispiel: Östbergs Unternehmen übernahm zuletzt den südkoreanischen Lieferdienstes Woowa Brothers. Delivery Hero hat damit in seiner jungen Firmengeschichte bereits 15 Konkurrenten geschluckt, das sind im Schnitt zwei pro Jahr.
Umgerechnet 3,6 Milliarden Euro – weit mehr als das Doppelte des Jahresumsatz der Firma – soll der Kauf kosten. Und die zahlt Delivery Hero an die vormaligen InvestorInnen von Woowa Brothers. Unter anderem die Investmentbank Goldman Sachs und der Staatsfonds GIC aus Singapur saßen mit im Boot. Da wie dort werden wohl ein paar Sektkorken geknallt haben.
Es geht um Steigerung des Unternehmenswertes. Von dem sehen die ArbeiterInnen jedoch sehr wenig.
Adele Siegl, Ausfahrerin bei Mjam
Das Geschäft klingt nach Mega Deal, ist aber nur eines von vielen in der Branche. Im Februar dieses Jahres übernahm Takeaway.com mit dem britischen Konkurrenten Just Eat. Davor gab es eine monatelange Bieterschlacht - sehr zur Freude der Aktionäre von Just Eat.
Am Ende legte Takeaway.com noch ein paar Pence mehr pro Aktie drauf, die Eigner stimmten zu und konnten so ihren vorher gemachten Einsatz vergolden. Umgerechnet 7 Milliarden Euro beträgt das Volumen der komplizierten Transaktion.
Solche Übernahmeschlachten gibt es im Monatstakt. Wer am stärksten wächst, schluckt diejenigen, deren Umsatz nicht in Windeseile zulegt. Ein rentables Geschäftsmodell erscheint da nebensächlich, glaubt Ausfahrerin Adele Siegl. "Es geht um möglichst schnelles Wachstum und die Steigerung des Unternehmenswertes", sagt sie und fügt an: "Von dem sehen die ArbeiterInnen jedoch sehr wenig."
Die eine große Player besitzt einen Gutteil des zweiten
Weil sie permanent andere Firmen übernehmen, mit Konkurrenten Aktien tauschen oder bestimmte Märkte unter sich aufteilen, sind beinahe alle Essenslieferdienste irgendwie geschäftlich miteinander verbunden. So verkaufte Delivery Hero ausgerechnet sein Geschäft im heimischen Deutschland vor zwei Jahren um 930 Millionen Euro an Takeaway.com.
Da kaum jemand mal so eben ein Vielfaches seines eigenen Jahresumsatzes investieren kann, trat die Mutter von Lieferando dem Besitzer von Mjam entsprechend Anteile an der eigenen Firma ab. Das Ergebnis: Der eine große Player am österreichischen Markt besitzt jetzt einen Gutteil des zweiten. Der Markt konzentriert sich immer weiter. Im vergangenen Jahr strich Uber Eats in Österreich die Segel. Mjam übernahm den Betrieb von Foodora.
Je weniger Anbieter am Markt, desto schwieriger wird es für uns Restaurants.
Pizzeria-Besitzer in Wien
Das bekommen jetzt die Restaurants zu spüren: „Als Uber noch da war, musste ich nur 27 Prozent Provision abgeben“, sagt der Pizzeria-Chef in Wien Neubau. Jetzt, wo nur noch Mjam und Lieferando da sind, verlangen die mehr von ihm. "Die lassen nicht mit sich reden”, sagt er und fügt an: “Je weniger Anbieter am Markt sind, desto schwieriger wird es für uns Restaurants“.
Einfach austeigen geht nicht, die KundInnen wollen es
Einen eigenen Service anbieten, das sei illusorisch. Denn bei aller Kritik an den App-Anbietern mit angeschlossenem Fahrradkurier-Service, sagt er: „Ich muss mich um nichts kümmern, die machen das alles.“ Einfach aussteigen, das könnte sich sein Restaurant schwer leisten. Ein Drittel mache das Online-Geschäft bei ihm inzwischen aus.
Die hungrigen KundInnen lassen sich einfach zu gern das Essen ins Büro oder an die Wohnungstür liefern. Während des Gesprächs in seinem Lokal zur besten Mittagszeit sitzen draußen vor der Tür einige Gäste. Drinnen ist kein einziger Tisch besetzt.