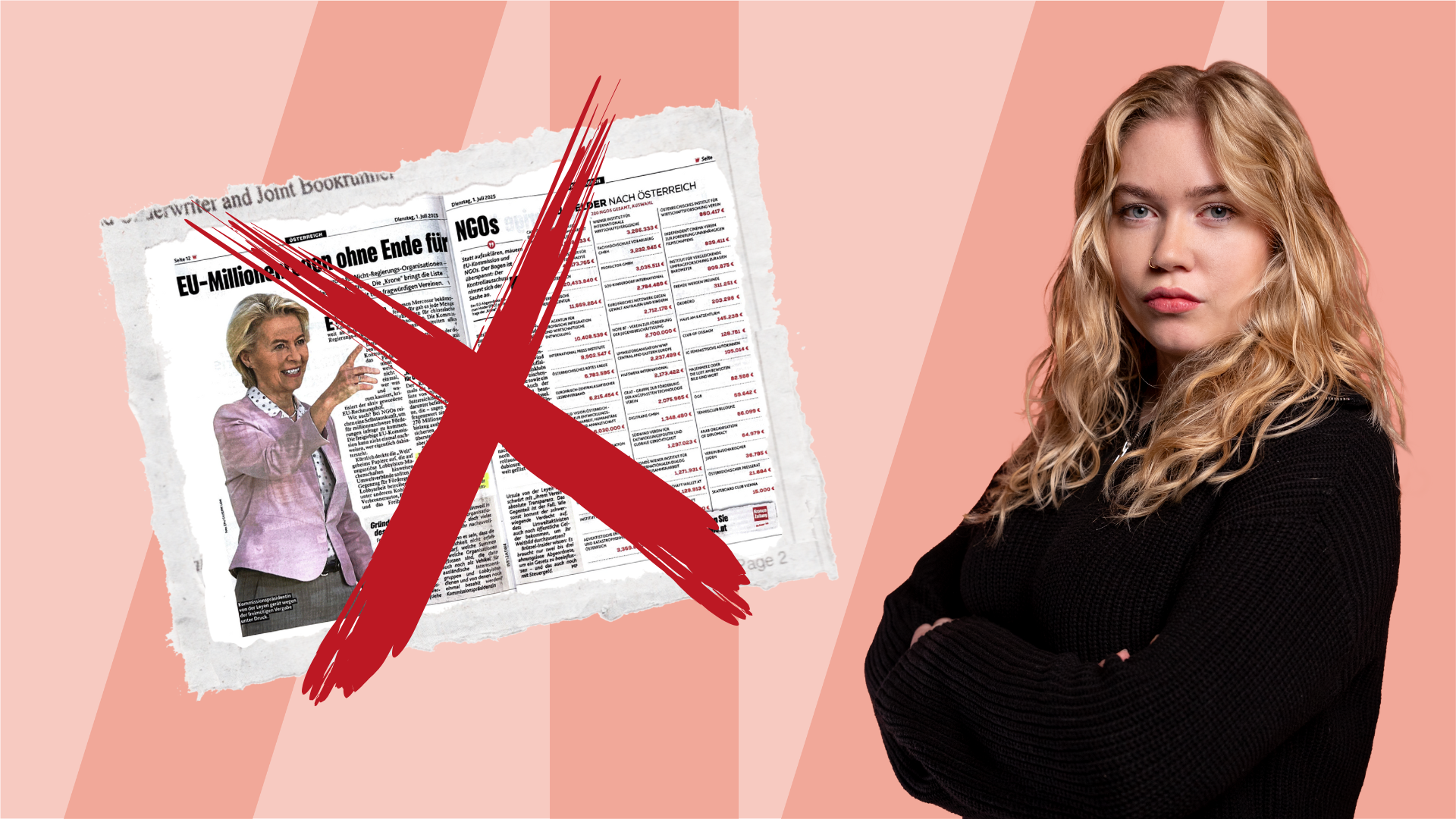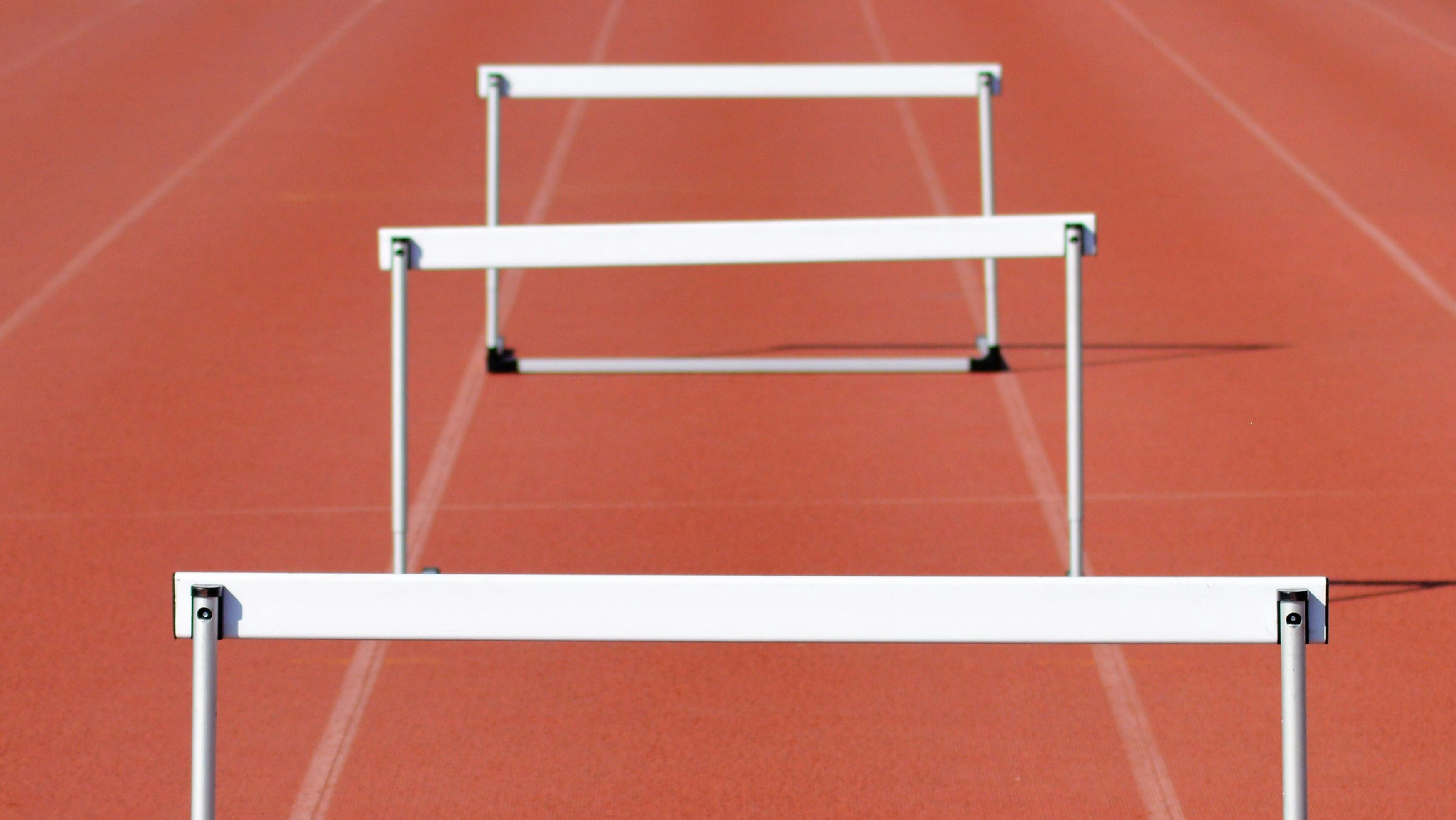Jugendliche Straftäter:innen: „Das Gefängnis ist keine Lösung und macht nichts besser“

Eine Reihe an aufsehenerregenden Straftaten von Jugendlichen prägten das, worauf sich die veröffentlichte Meinung im Sommer stürzte. Messerstechereien, Syrer gegen Tschetschenen – Boulevard und manche Regierungs- und Oppositionspolitiker:innen waren schnell mit dem Urteil: Wenn das alles immer schlimmer wird, dann muss man Kinder eben schon mit zwölf Jahren einsperren. Aber werden die Jugendlichen in Österreich überhaupt wirklich krimineller?
Beim letzten Mittel ist es immer zu spät
Zunächst ist eine Sache enorm wichtig festzuhalten: Eine Freiheitsstrafe ist das allerletzte Mittel des Staates. Denn wenn die Jugendlichen vor Richter:innen stehen, „bin ich zu spät dran. Das Gefängnis ist keine Lösung und macht nichts besser.“ Das sagt Daniel Schmitzberger. Er ist Richter in Wien und Vorsitzender der Fachgruppe Jugendstrafrecht der Richtervereinigung.
Im Gefängnis lernen perspektivlose, verurteilte Jugendliche vor allem, wie sie noch mehr Straftaten ‚richtig‘ begehen. Nicht wenige kriminelle Karrieren haben mit einer Verurteilung in jungen Jahren erst so richtig begonnen. Eine von politischen Parteien geforderte Herabsetzung der Strafmündigkeit von 14 auf 12 Jahre wird das nicht ändern.
“Es ist populistisch, immer nach härterer Strafe zu rufen. Das bewirkt nichts” sagt auch Romeo Bissuti. Der Psychotherapeut und unter anderem Leiter des Männergesundheitszentrums MEN sagt: “Niemand denkt im Moment, in dem er Scheiße baut, daran, ob er drei oder fünf Jahre ins Gefängnis muss.”
„Mehr Gewalt“ ist ein Mythos
Aber gibt es nun mehr Gewalt? „Langfristig wird Kriminalität nicht mehr, sondern weniger. Wir tendieren dazu, aus persönlichen Eindrücken generelle Ergebnisse abzuleiten“, sagt dazu Schmitzberger. „Das ist auch gefährlich. Man braucht belastbare Zahlen und eine richtige Interpretation.“
Wenn sich der Richter die Anzeigen- und Verurteilungsstatisik ansieht, registriert er schon einen Anstieg bei den Anzeigen. Aber das muss man sich genauer ansehen. Nur weil etwas angezeigt wird, muss es keine Straftat sein.
Ein Beispiel: Es gibt immer mehr kleine Wertgegenstände wie Handys oder Smartwatches, die auch versichert sind. Kommen diese abhanden, braucht es eine Diebstahl- oder Verlustmeldung bei der Polizei – sonst zahlt die Versicherung nichts.
Mehr Sensibilität für Anzeigen
“Es wird auch grundsätzlich mehr angezeigt”, meint er weiter. Auch Vorfälle, die vor 20, 30 Jahren kein Mensch angezeigt hätte. Manches wirkt da vielleicht übertrieben, etwa “wenn der eine 5-Jährige einen anderen beim Spielen im Kindergarten verletzt. Die Staatsanwaltschaft stellt das sofort ein, aber es gilt als eine Anzeige.”
Außerdem ist die Gesellschaft in vielen Bereichen viel sensibler und zeigt zum Beispiel Gewalt gegen Kinder oder sexualisierte Übergriffe eher an. Dass da besser aufgepasst wird, ist eine gute Entwicklung. Aber es heißt eben nicht unbedingt, dass etwas das mehr angezeigt wird auch wirklich öfter als früher vorkommt.
(Junge) Männer üben vermehrt Straftaten aus
“Wenn es eine Zeit gegeben hätte, wo viel mehr schwere Straftaten erfolgt wären, gebe es entsprechende Verurteilungen”, sagt Schmitzberger. Aber die Verurteilungsstatistik bei Gewalt gehe seit 40 Jahren zurück: “Für mich gibt es keinen Nachweis, dass mehr schwere Gewalttaten verübt werden.”
Mehr als vier von fünf verurteilten Straftäter:innen sind männlich. Der Anteil der jungen Erwachsenen an der strafmündigen Bevölkerung betrug 3,5 Prozent, der Anteil der Jugendlichen 4,4 Prozent. Damit waren insbesondere junge Erwachsene bei den Verurteilten deutlich überrepräsentiert.
Befragungen zeigen laut Schmitzberger beispielsweise, dass 90 bis 95 Prozent von Männern Mitte 20 angeben, schon einmal eine Straftat begangen zu haben. Aber: das beginnt hierzulande beim Mitgehenlassen eines Packerls Kaugummi. Sich als Erklärung hier nun einen einzelnen Punkt herauszupicken, ist demzufolge „verkürzend und gefährlich“, meint Bissuti.
Die Medien blasen auf
Es gibt also insgesamt nicht auffällig mehr Gewalt. Straffällig werden insbesondere Männer. Bissuti registriert, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird: „Je nach Herkunft wird man eher verdächtigt oder erwischt.” Auch so füllten sich Statistiken auf.
In weiterer Folge ist das ein gefundenes Fressen für Medien und (rechte) Parteien. Er beschreibt es so: “Manche politische Strömungen wollen diese Krisenzustände und die Skandalisierung, um ihr Stammpublikum zu bedienen.”
“Jugendliche sind von Natur aus grenzüberschreitend angelegt. Man kann nicht sagen, dass ein bestimmter Schlag kriminell wird”, berichtet dazu noch der Richter. All das heißt aus der Sicht der beiden Experten aber nicht, dass man die Hände in den Schoß legen sollte. Bissuti: „Man soll nicht den Fehler machen, sich Risikobereiche nicht anzusehen.“
Patriarchale Männlichkeitsbilder spielen eine Rolle
Eine Untersuchung von Tätern bei Femiziden hat beispielsweise keine Auffälligkeiten gezeigt. Bei Gewalt spielen für Bissuti vor allem Männlichkeitsbilder eine große Rolle. Sie führen dazu, dass Männer sich in ihrer Welt im Recht oder sogar gezwungen sehen, auch Gewalttaten zu begehen.
Ein Mann „darf“ schneller zuschlagen, wenn er beleidigt wird; „muss sich verteidigen“, wenn er gemobbt wird; oder erachtet „Frauen als Besitz“. Solche Einstellungen gibt es letztlich unabhängig davon, wo jemand herkommt.
Psychische Erkrankungen und Perspektivlosigkeit als Faktoren
Eine wichtige Rutsche in die Kriminalität ist auch Sucht. Aber die fällt nicht vom Himmel – wie kommt es überhaupt dazu? Oft liegt eine Erkrankung vor. „Bei Schulabbrechern haben rund die Hälfte eine klinisch relevante Diagnose gehabt. Dann geraten sie in den Suchtbereich, um die Erkrankung zu “bekämpfen” und der Strudel geht los“, erklärt Bissuti. Hier könnte präventiv viel mehr erreicht werden. Beide Experten kritisieren, dass die psychotherapeutische Versorgung nicht gut genug ist.
Schmitzberger hat ein Beispiel dafür, wie schief gerade dieser Teil der Debatte geführt werde. „Wenn irgendwo einer abgestochen wird, geht es wochen- und monatelang darum, ob man Kinder einsperren kann.” Aber als die Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie im Vorjahr Alarm schlug, weil sich bei ihnen die Zahl der Jugendlichen verdreifacht hat, die Suizidversuche hinter sich hätten „war das eine kleine Schlagzeile, dann war es wieder wurscht.“
Kinder sind zuerst Opfer
Wer eine gute Perspektive für das eigene Leben hat, werde er eher nicht straffällig. Dann gibt es viel zu verlieren, weiß Bissuti.
Oft wird auch vergessen, dass Kinder und Jugendliche zunächst Opfer von Gewalt sind, bevor sie zu Täter:innen werden. Das Ziel muss sein, die Jugendlichen von der Kriminalität abzubringen, wenn sie sich abzeichnet. Und nicht nur auf einen möglichst frühen Zeitpunkt warten, bis man sie wegsperren kann.
Schmitzberger bringt es auf den Punkt: “Man braucht Maßnahmen ohne Justiz und Gefängnis. Man muss verhindern, dass sie überhaupt auf die Idee kommen, mit einem Messer im Park zu stehen und wen abzustechen.”
Es braucht mehr von den richtigen Mitteln
In der Vorbeugung funktioniert allem zum Trotz schon einiges ganz gut, etwa aufsuchende und absichtslose Jugendarbeit durch Streetwork oder in Jugendzentren.
Schmitzberger fasst zusammen: „Wir als Gesellschaft müssen einen Weg finden, Jugendliche schadensfrei in das Erwachsenenleben zu bringen, damit sie gemeinsam mit uns eine gute und glückliche Gesellschaft schaffen. Wir sind gut aufgestellt, müssen aber darauf schauen, dass es weiterhin so bleibt und positive Akzente setzen, ohne Schuldzuweisungen.“
Damit das gelingt, benötigt es letztlich keine reißerischen Schlagzeilen und markigen Statements, die schweren Kerker fordern – sondern mehr Geld für Psychotherapieangebote, Pädagog:innen, Sozialarbeit und Kinder- und Jugendhilfe.