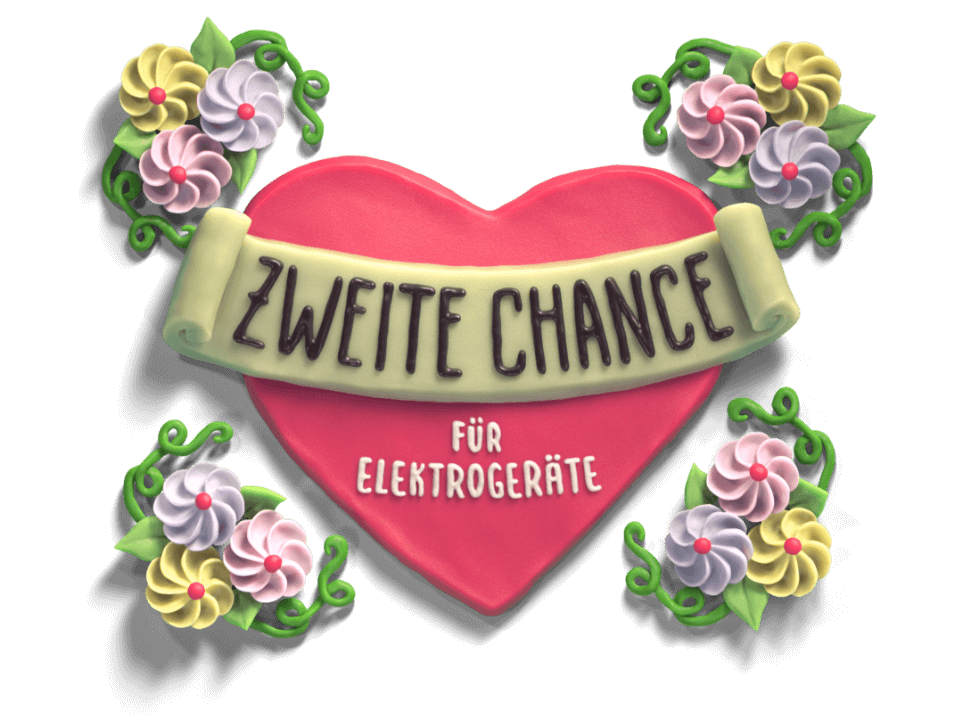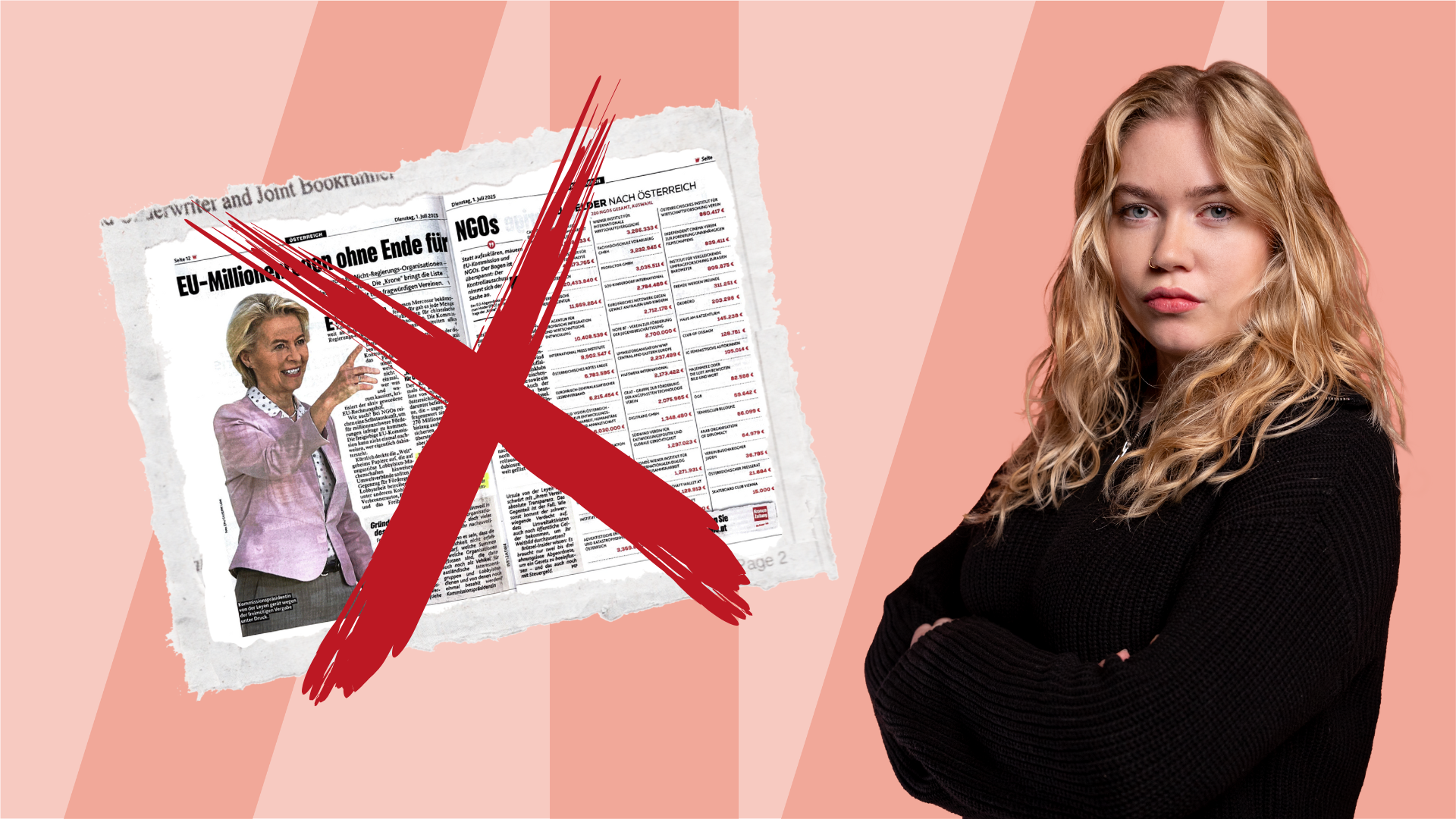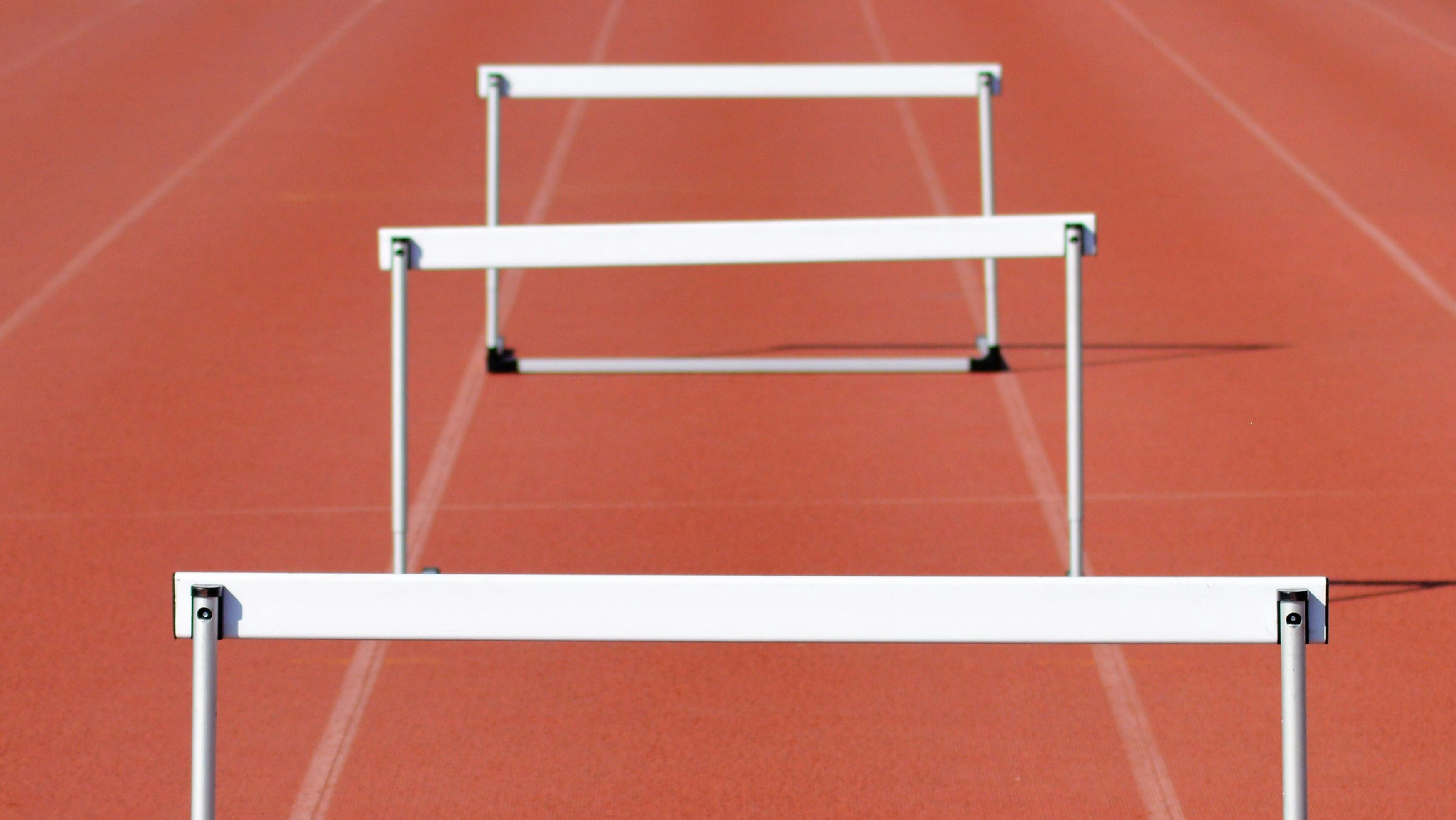Experte Nauschnigg: Staat soll Krisenfirmen übernehmen – und damit Gewinn machen

MOMENT: Diese Krise könnte laut Stephan Schulmeister das Ende des Neoliberalismus einläuten. Es zeige sich in der Coronakrise, wie sehr der Staat doch gebraucht wird. Würden Sie dem recht geben?
Franz Nauschnigg: Es sollte jetzt auch dem Dümmsten klar geworden sein, dass es rein marktwirtschaftlich nicht geht. Man benötigt in verschiedenen Situationen die starke Hand des Staates. Ich war schon nach der Wirtschaftskrise 2008 überzeugt, dass der Neoliberalismus verlieren wird. Aber das war nur ein kurzzeitiger Einschnitt. Danach ging es weiter wie zuvor.
MOMENT: In der Finanzkrise 2008 und 2009 sprang der Staat, also wir alle, ein und half Banken und Unternehmen. Vom Aufschwung profitierten aber vor allem Unternehmen und deren Eigentümer. Was können wir tun, damit es nicht so kommt?
Nauschnigg: In der Finanzkrise hat der Staat die Banken gerettet. Deren Verluste wurden verstaatlicht. Als die Banken dann wieder gute Gewinne machten, verdienten daran die Aktionäre wegen der steigenden Kurse. Und die Bankmanager erhielten bald wieder Millionengagen wie zuvor.
Um so etwas zu verhindern, kann man etwas machen, was wir schon einmal hatten in Österreich: die sogenannte Gesellschaft des Bundes für industriepolitische Maßnahmen (GBI), auch Pleiteholding genannt. Diese hat in der 1980er und 90er Jahren bankrotte Firmen übernommen, saniert und später teilweise privatisiert.
Damit wurden tausende Arbeitsplätze ohne Kosten für den Staat gerettet. Denn das Geld, das man hineingesteckt hat, hat man durch die Verkäufe wieder eingenommen.
Unter Schwarz-Blau wurden gerettete Unternehmen billig an gut vernetzte Unternehmer verkauft. Das war nicht im Sinne des Erfinders.
MOMENT: Wo wurde das zum Beispiel gemacht?
Nauschnigg: Bei den ATB Motorenwerken in Spielberg. Das war mir persönlich wichtig, weil ich damals im Aufsichtsrat der GBI war. Das Unternehmen war größter Arbeitgeber der Region. Wir haben es aufgefangen und saniert.
Anfang der 2000er Jahre wurden unter Schwarz-Blau solche Unternehmen billig an gut vernetzte Unternehmer verkauft, in diesem Fall an Mirko Kovats. Der hat das dann nach einigen Jahren mit riesigem Gewinn nach China weiterverkauft. Das war nicht im Sinne des Erfinders.
MOMENT: Aber die Arbeitsplätze konnte die staatliche GBI auch nicht alle retten.
Nauschnigg: Das stimmt, sie konnte nicht immer alle Arbeitsplätze retten. Es ist auch zu einem Abbau gekommen. Aber nachdem die Firmen saniert waren, haben sie in der Wachstumsphase danach wieder zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen.
MOMENT: Davon, Unternehmen zu verstaatlichen, ist in dieser Krise in Österreich noch nicht einmal die Rede, in anderen Ländern schon. Wie ist Österreich davon abgekommen?
Nauschnigg: Die ÖVP hat die Pleiteholding aufgelöst und sich immer geweigert, sie wieder einzurichten. Aber es gibt ein Gegenmodell zum neoliberalen System, das der Bund verfolgt: und das ist das Land Wien. Hier gibt es staatliche Eingriffe wie den Gemeindebau oder öffentliche Dienstleistungen wie Wasserversorgung und Elektrizität.
Bis 2000 hatten wir auch auf Ebene des Bundes eine eher keynesianische Politik unter SPÖ-Dominanz. “Mehr Staat, weniger Markt” war das Rezept nach dem Zweiten Weltkrieg: Der Finanzsektor wurde vom Staat reguliert, hohe Einkommen höher besteuert.
Das neoliberale System hat dieses sogenannte Bretton-Woods-System später abgelöst. Wenn man beide einmal vergleicht: Die Wirtschaft wuchs damals stärker. Die Ungleichheit sank, während sie im Neoliberalismus bei Einkommen und Vermögen zunimmt.
Rettungsgelder dürfen nicht von der Interessenvereinigung der Unternehmen an die Unternehmen verteilt werden.
MOMENT: Jetzt greift der Staat ein. Er hat ein 38 Milliarden Euro schweres Hilfspaket für die Wirtschaft geschnürt. Die richtige Maßnahme?
Nauschnigg: Wir haben jetzt dieses Paket, aber wir sind damit später dran als die meisten anderen EU-Länder. Länder wie Schweden haben das schon früher gemacht. Und Deutschland hat nicht nur ein Paket für die Coronakrise geschnürt, sondern eines für die Zeit danach. Das ist bei uns bisher leider nicht passiert.
MOMENT: Ausgehend von dem, was bisher darüber bekannt ist: Wie bewerten Sie dieses Hilfspaket?
Nauschnigg: Es muss verbessert werden. Es ist zunächst einmal problematisch, dass die Wirtschaftskammer das abwickeln soll. Die Rettungsgelder dürfen nicht von der Interessenvereinigung der Unternehmen an die Unternehmen verteilt werden. Denn die vertreten ihre Klientel und deren Ziel ist es, möglichst viel Geld zu bekommen.
Das ist aber nicht unbedingt im Interesse der Steuerzahler. Und die bezahlen es ja am Ende. Die Wirtschaftskammer dafür zuständig zu machen, ist ungefähr so, wie wenn sie den ÖGB beauftragen würden, die Arbeitslosengelder auszuzahlen.
MOMENT: Wie lässt sich dann erklären, dass die schwarz-grüne Regierung das so eingerichtet hat?
Nauschnigg: Das ist wohl ein klassischer Fall von Dankbarkeit. Sie müssten dazu wohl Sebastian Kurz fragen, ob seine Spender mit ihm darüber gesprochen haben. Und sie müssten die Grünen fragen, warum sie da zugestimmt haben. Vizekanzler Werner Kogler hat ja auch vor kurzem in der Debatte um die Klimaschutzmilliarde noch gesagt: Das Geld wächst nicht auf den Bäumen.
Rettungsgelder dürfen nicht an Unternehmen gehen, die sich durch eigene Schuld selbst geschwächt haben.
MOMENT: Die Zahl der Arbeitslosen schnellt jetzt in die Höhe. Wie kann die Regierung verhindern, dass Unternehmen jetzt noch mehr ArbeitnehmerInnen entlassen?
Nauschnigg: Indem sie sagt: Jene, die Leute entlassen haben, bekommen entsprechend geringere Unterstützung. Was auch wichtig ist: Es darf nicht vorkommen, dass die Rettungsgelder an jene Unternehmen gehen, die sich durch eigene Schuld selbst geschwächt haben. Etwa indem in hohem Maße Gewinne entnommen wurden, deshalb schlecht dastehen und Hilfe vom Staat verlangen. Diese Hilfe uneingeschränkt zu leisten, wäre kontraproduktiv.
MOMENT: Was könnte die Regierung tun, damit das nicht passiert?
Nauschnigg: Indem sie geringere Hilfen an diejenigen Unternehmen gibt, in denen die Eigentümer innerhalb der vergangenen drei Jahre mehr als 50 Prozent der Gewinne aus dem Unternehmen entnommen haben.
Oder dort, wo die Managergehälter sehr hoch sind. Alles an Bezahlung, was über 500.000 Euro hinausgeht, könnte von den Hilfen abgezogen werden. Hilfen könnten an die Auflage gebunden werden, dass Manager nicht mehr als 500.000 Euro im Jahr bekommen und innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre keinerlei Ausschüttungen.
MOMENT: Abseits der Hilfspakete: Wie kann man jetzt konkret verhindern, dass noch mehr Menschen arbeitslos werden?
Nauschnigg: Man sollte sich überlegen, einen zweiten Arbeitsmarkt zu schaffen. Statt Milizsoldaten einzuberufen, wäre es viel nützlicher, die von der von Türkis-Blau abgeschaffte Aktion 20.000 wiederzubeleben. So könnte man Arbeitslosen jetzt Beschäftigung im öffentlichen Sektor geben.
Wir sollten das machen, was Kreisky schon gesagt hat: Wir sollten Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren. Nicht im Rahmen einer verstaatlichten Industrie, sondern in Form eines zweiten Arbeitsmarktes für Tätigkeiten, die die Gesellschaft notwendig braucht, wie Pflege oder öffentliche Infrastruktur. Der Bedarf hier ist riesig.
MOMENT: Die Pflege wird jetzt im großen Maße privatwirtschaftlich geregelt. Sollte der Staat abgesehen von Zuschüssen hier aktiver sein?
Nauschnigg: Man könnte sich das burgenländische Modell anschauen. Dort greift das Land stark ein. Nicht ausländische Pflegekräfte werden hereingeholt, sondern die lokalen Pflegekräfte stark unterstützt, um ihre Angehörigen zu pflegen.
Jetzt in der Coronakrise zeigt sich, wie wichtig ein staatlich finanziertes Gesundheitssystem ist. Hier ist die Reform unter Türkis-Blau in die falsche Richtung gegangen. Sie haben die Mittel für das öffentliche System gekürzt und privaten Anbietern mehr Geld gegeben. Das ging ein wenig in Richtung des nicht sehr effizienten US-Gesundheitssystems.
Zudem ist die neue Verwaltung ein Wahnsinn: Die Arbeitnehmer finanzieren mit ihren Lohnnebenkosten das System. Aber die Arbeitgeber, die nicht im System sind, bestimmen jetzt darüber. Das ist eigentlich nicht erklärbar. Und die eine Milliarde Euro, die die Reform angeblich einsparen sollte, sehen wohl nur Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache.
MOMENT: Mehr staatliche Unterstützung in der Pflege, aktive Arbeitsmarktpolitik, Ausbau des Gesundheitssystems: Das hieße konkret höhere Ausgaben aus dem Staatshaushalt und mehr Schulden?
Nauschnigg: Genau. Das müsste finanziert werden. Eine Möglichkeit dafür wäre natürlich die Erbschaftssteuer. Jemand, der das Glück hat gesund zu sein, kann alles vererben. Jemand, der krank ist und Pflege braucht, kann oft nichts mehr vererben. Das ist nicht einzusehen.
Außerdem werden Erbschaften, die ein leistungsloses Einkommen sind, nicht versteuert. Wenn ich arbeite und dabei gut verdiene, zahle ich rund 50 Prozent an Steuern. Aber Personen, die erben, zahlen nichts. Das ist sehr ungerecht und ein leistungsfeindliches Steuersystem.
Wo Staaten Aktien von Unternehmen übernommen haben, gab es keine großen Verluste, im Gegenteil.
MOMENT: Eingriffe des Staates in die Wirtschaft oder den Finanzmarkt stoßen auf Widerstand. Für die Wirtschaft gilt: Der freie Markt soll alles so weit wie möglich selber regeln. Mit Blick auf die vergangenen 30 bis 40 Jahre. War das erfolgreich?
Nauschnigg: Nein, das hätte besser laufen können. In der Finanzkrise zum Beispiel: Dort, wo Staaten Aktien von Unternehmen übernommen haben, gab es keine großen Verluste, im Gegenteil: Die USA und die Schweiz haben sogar Gewinne gemacht.
Das heißt, die Staaten haben damals die Aktien sehr günstig übernommen. Sie haben die Banken mit Staatsgeldern saniert, was nicht ganz billig war. Aber sie haben das aus den Erträgen wieder zurückbekommen.
In Österreich wurden in den 80er Jahren Länderbanken und Kreditanstalten mit Staatsgeldern vor der Pleite gerettet, sie waren also in Staatseigentum. Der Staat hat dann beim Verkauf ein Vielfaches der eingesetzten Mittel wieder zurückbekommen.
MOMENT: Worauf sollten die BürgerInnen jetzt achten, worauf sollten sie aufpassen, damit Lehren auch wirklich gezogen werden und wir nicht wieder zur wirtschaftlichen Tagesordnung der vergangenen Jahrzehnte übergehen?
Nauschnigg: Man muss darauf achten, dass Verluste nicht verstaatlicht werden, während die Gewinne privatisiert werden. Man muss darauf achten, dass jene, die in den letzten Jahren Gewinne ausgeschüttet und kassiert haben, jetzt auch zur Verantwortung gezogen werden. Denn sie sind dafür verantwortlich, dass die Unternehmen so geschwächt worden sind.
—
Zur Person: Franz Nauschnigg (geboren 1956) arbeitete von 1987 bis Mai 2019 bei der Österreichischen Nationalbank, zuletzt war er dort Leiter der Abteilung Integrationsangelegenheiten und internationale Finanzorganisationen (INTA). Von 1995 bis 1999 war er wirtschaftspolitischer Berater im Finanzministerium. Vor seiner Zeit bei der OeNB war er seit 1982 im Handelsministerium und im Ministerium für Landwirtschaft tätig.
—
Mitarbeit: Sara Mohammadi