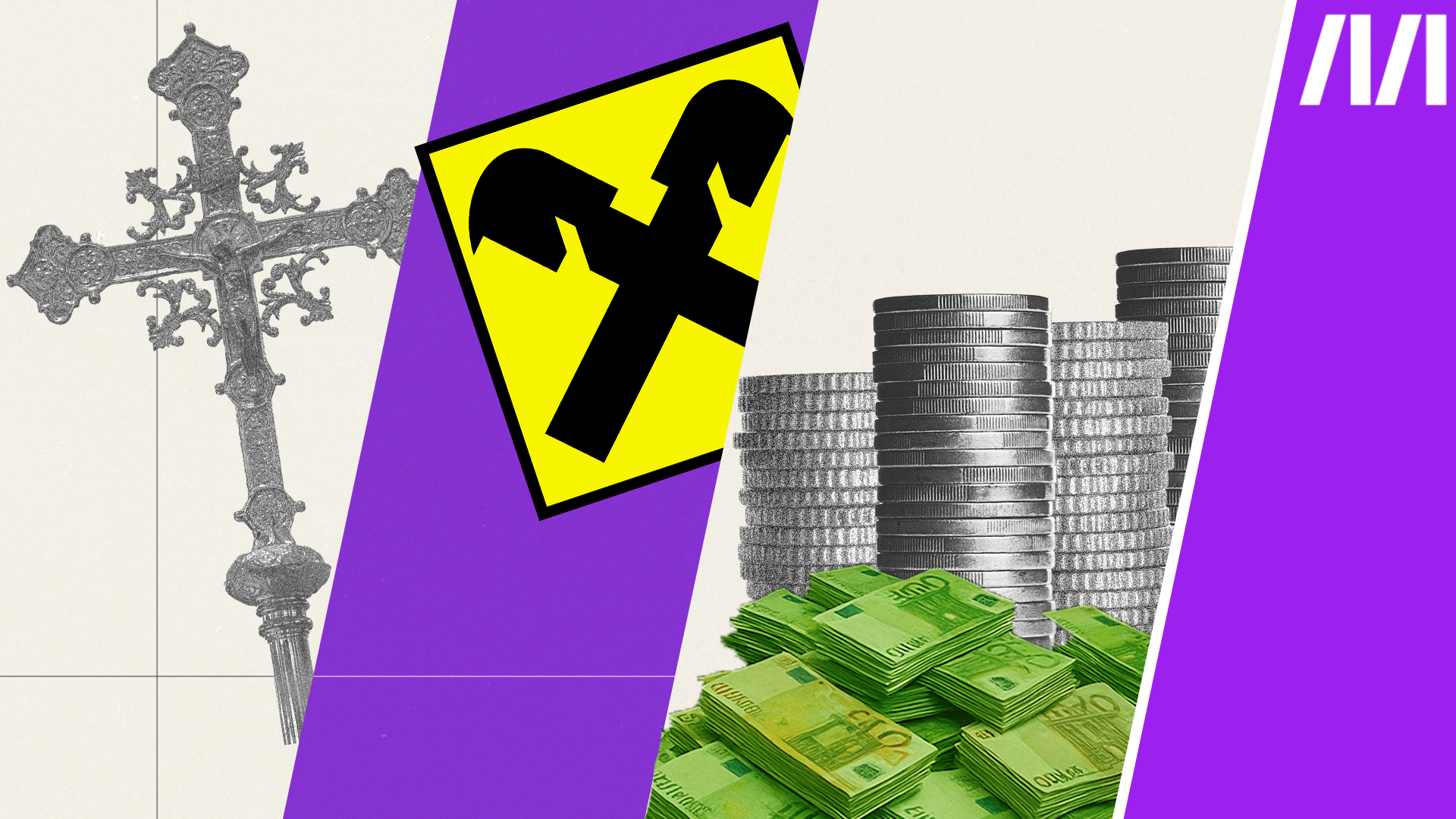Wie Konservative rechte Hetze legitimieren

Die Szene ist aufschlussreich. Julia Klöckner steht beim Sommerfest von Nius-Finanzier Frank Gotthardt und erklärt vor Publikum, die linke taz sei in ihren Methoden nicht unähnlich zum rechtspopulistischen Portal Nius. Es ist nicht nur ein missratener Vergleich, es ist eine politische Setzung. Wer so spricht, verschiebt bewusst die Grenzen des Sagbaren.
Wenn Nius und taz gleichgesetzt werden, entsteht der Eindruck, es gebe keine Qualitätsmaßstäbe, nur politische Vorlieben. Damit wird Kritik an der Regierung nicht mehr als Ergebnis journalistischer Recherche verstanden, sondern als Ausdruck ideologischer Parteilichkeit.
Alles ist Meinung, nichts ist Fakt
Nius ist eben kein bürgerlich-konservatives Medium, sondern eine Plattform, geführt vom umstrittenen Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt, die auf Polarisierung, Skandalisierung und Kampagnen setzt. Die taz hingegen ist eine genossenschaftlich organisierte Tageszeitung, getragen von knapp 25.000 Mitgliedern, die ihre Unabhängigkeit sichern. Die Gleichsetzung verschleiert fundamentale Unterschiede. Auf der einen Seite stehen Eigentum, Mitbestimmung und Qualitätsanspruch, auf der anderen Seite eine Investorenstruktur, die inhaltliche Kontrolle und Agenda sichert und einen harten rechtsaußen Kurs vorgibt.
Wer beides gleichsetzt, sagt in Wahrheit: Es gibt nur Meinungen, keine Standards. Doch journalistische Standards sind das, was die demokratische Öffentlichkeit trägt.
Skandal als Geschäftsmodell
Nius hat wiederholt gezeigt, wie Skandalberichterstattung als Mittel eingesetzt wird. Ende 2024 behauptete das Portal, eine Frauenvertreterin der Berliner Polizei sei “als Mann geboren” und stehe unter Missbrauchsverdacht. Beides ist nachweislich falsch. Die Folgen waren Hassbotschaften gegen die Betroffene, eine Korrektur oder Entschuldigung erfolgte nicht. Jüngst fiel das Desinformations-Portal mit einer Kampagne gegen die Nominierung der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf als Verfassungsrichterin auf. Die Attacken und Angriffe waren so heftig, dass die Juristin ihre Kandidatur schließlich zurückzog.
Der österreichische eXXpress, an dem Nius mittlerweile mehrheitlich beteiligt ist, arbeitet nach ähnlichem Muster. 2022 wurde das Medium wegen übler Nachrede verurteilt, nachdem es mit schlampiger Recherche einen Tagesspiegel-Journalisten diskreditiert hatte. Im selben Jahr veröffentlichte es eine antisemitische Karikatur, die erst nach öffentlichem Druck entfernt wurde. Immer wieder veröffentlicht das Portal frei erfundene Berichte. Es ist eine Spur der Grenzüberschreitungen, die eher an Kampagnen als an Journalismus erinnert.
Trotz dieser Bilanz fließen öffentliche Gelder. 2025 erhielt der eXXpress rund 41.000 Euro aus der Qualitätsjournalismus-Förderung. Und das, obwohl der Fachbeirat sich gegen eine Förderung ausgesprochen hatte. Damit landet Steuergeld nicht bei Redaktionen, die mit Mühe faktenbasierte Arbeit leisten, sondern bei einem Portal, das nachweislich und regelmäßig jenseits von journalistischen Qualitätskriterien arbeitet.
Lektionen aus den USA
Ein Blick in die USA zeigt, wohin dieser Weg führt. Donald Trump machte die Delegitimierung unabhängiger Medien salonfähig. Wer Medien, die Macht kontrollieren, als “Feinde des Volkes” beschimpft und gleichzeitig rechte Kanäle aufwertet, spaltet die Öffentlichkeit und zerstört Vertrauen in die Presse insgesamt. Der Effekt: Fakten verlieren Verbindlichkeit.
Das alles ist kein Zufall, sondern ein kalkulierter Angriff auf die demokratische Öffentlichkeit. Konservative Politiker, die linke Qualitätsmedien mit rechten Desinformationsprojekten gleichsetzen, handeln nicht fahrlässig, sondern strategisch. Sie wollen Standards auflösen, um Deutungshoheit zu gewinnen. Die Verwischung ist eine Strategie der Macht. Sie dient dazu, Fakten zu entwerten, Echokammern aufzuwerten und das Sagbare nach rechts zu verschieben.
Demokratie braucht Standards, keine Beliebigkeit
Die entscheidende Frage lautet: Was passiert, wenn konservative Spitzenpolitiker linke, genossenschaftlich organisierte Zeitungen mit Projekten vergleichen, in denen rechtsradikale Rhetorik als legitime Meinung durchrutscht? Was geschieht, wenn die Verteidigung von Menschenrechten als „linke Schlagseite“ abgetan wird?
Die Antwort liegt auf der Hand. Eine Demokratie, die sich nicht mehr auf ein gemeinsames Fundament von Fakten und roten Linien einigen kann, verliert ihre Abwehrkräfte. Der Unterschied zwischen Kritik an Regierungspolitik und Kampagnenjournalismus gegen Minderheiten ist nicht graduell, sondern prinzipiell. Wer ihn verwischt, verschiebt das Koordinatensystem der Republik.
Konsequenzen für Medienpolitik
Die Politik hat Werkzeuge in der Hand. Förderungen müssen an überprüfbare Qualitätskriterien gebunden sein, es braucht funktionierende Korrektur- und Kontrollmechanismen, transparente Eigentümerstrukturen.
Das hat nichts mit Zensur zu tun, sondern mit Verantwortung. Öffentlichkeit ist kein beliebiges Spielfeld, sondern die Infrastruktur unserer Demokratie. Wer sie an Menschen ausliefert, die bewusst Desinformation und Hetze verbreiten, untergräbt ihr Fundament.