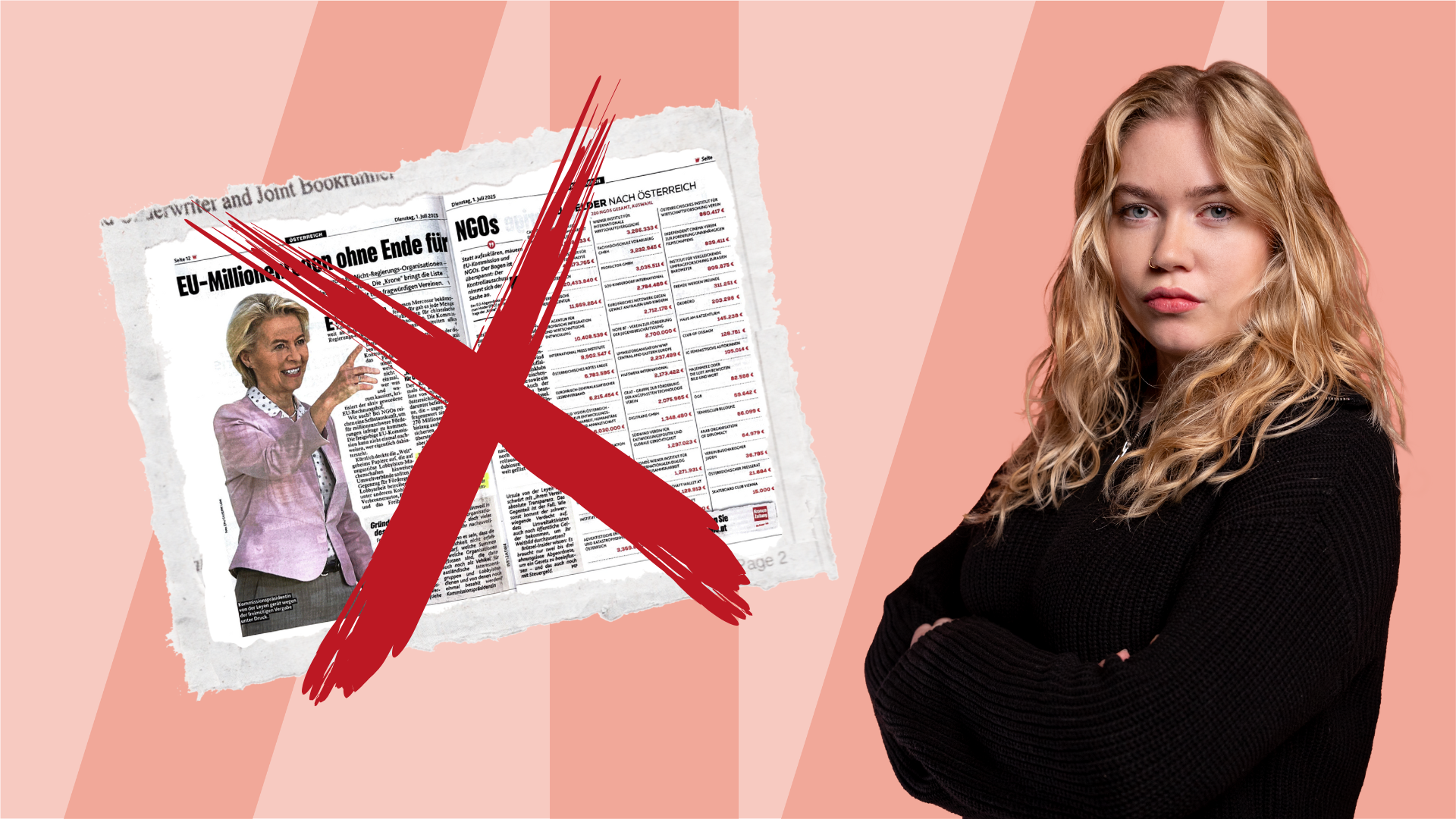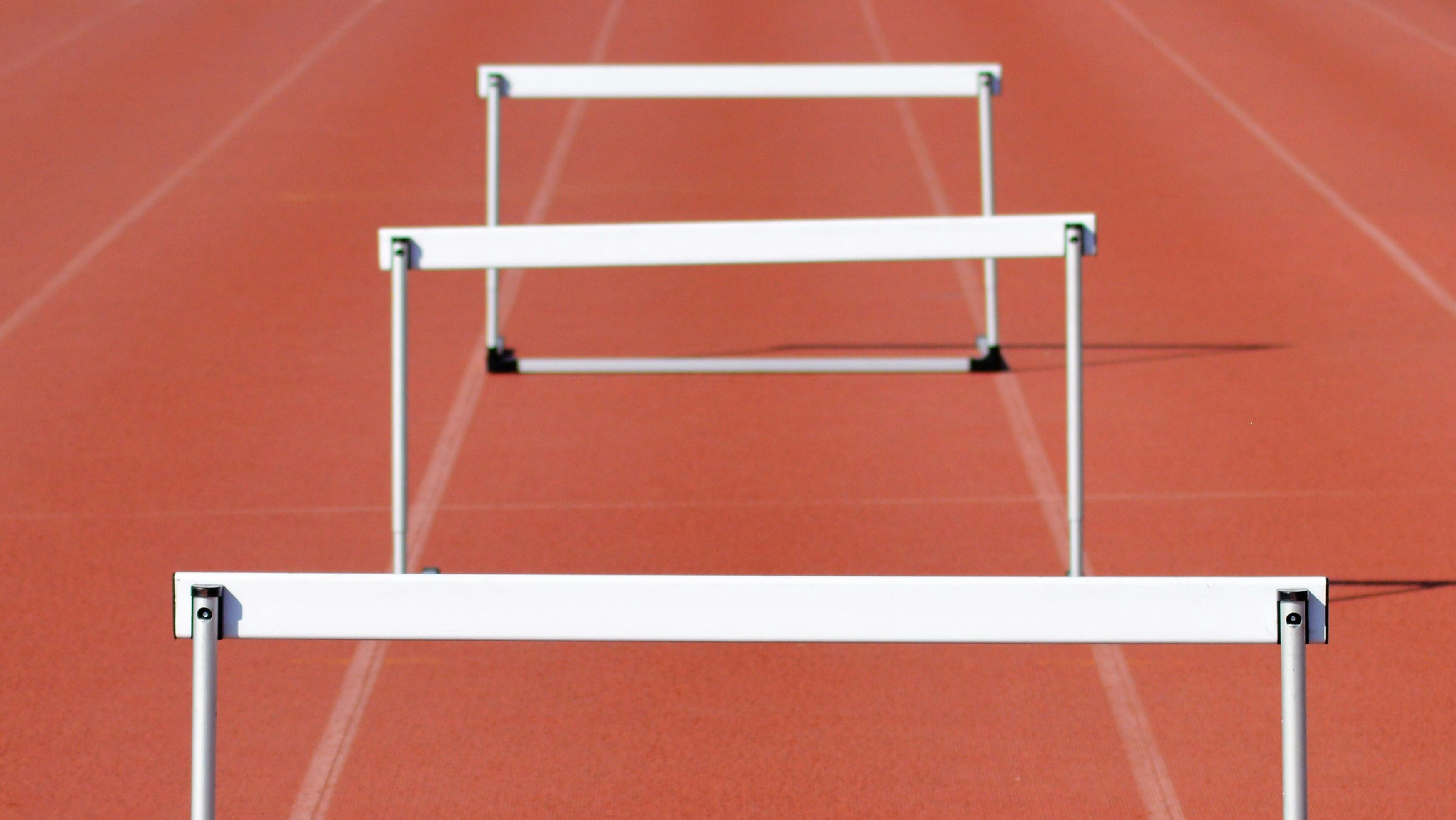Gegen rechte Koalitionen: Was ist die Vranitzky-Doktrin?

Seit wann gibt es die Vranitzky-Doktrin?
Von 1970 bis 1999 war die SPÖ nach jeder Nationalratswahl in Österreich die stärkste Partei. Unter Bruno Kreisky gab es sogar eine Alleinregierung der Sozialdemokraten. Die absolute Mehrheit verlor die SPÖ jedoch bei den Nationalratswahlen 1983. Von 1983 bis 1986 kooperierte sein Nachfolger Fred Sinowatz erstmals mit den Freiheitlichen.
Aber es sollte das letzte Mal sein. 1986 änderte sich die FPÖ. Es kam der Rechtspopulist Jörg Haider an die Spitze. Sinowatz‘ Nachfolger Franz Vranitzky (SPÖ) schloss 1986 eine erneute Zusammenarbeit mit Haider und der FPÖ aus. Bis heute heißt dieser Beschluss deshalb Vranitzky-Doktrin.
Gilt die Doktrin auch für Bundesländer?
Seit der Festlegung dieser politischen Leitlinie wurde die Doktrin immer weiter aufgelockert. Landespolitiker:innen sind demnach freigestellt, eine Zusammenarbeit mit der FPÖ einzugehen. Im Jahr 2004 gab es in Kärnten erstmals wieder seit 1986 eine Koalition zwischen SPÖ und FPÖ. 2015 einigten sich SPÖ und FPÖ im Burgenland auf eine gemeinsame Regierung. Seither regierten in mehreren größeren und kleineren Städten in Österreich rot-blaue Bündnisse.
Richtlinien in der Zusammenarbeit mit Rechten
Auf Bundesebene gibt es Richtlinien, wie mit den Rechten umgegangen werden soll. 2017 wurde ein Kriterienkatalog ausgearbeitet, der die Bedingungen für eine etwaige Zusammenarbeit mit der FPÖ festsetzte. 2018 wurde dieses Papier durch den sogenannten „Wertekompass“ ersetzt. Dieser schließt eine Zusammenarbeit mit der FPÖ nicht mehr grundlegend aus. Aber solange die FPÖ eine rechtsextreme Ausrichtung lebt, führt die SPÖ auf Bundesebene keine Regierungsverhandlungen mit ihr.
Kritik an der Doktrin
Seit sich die SPÖ eine Regierungszusammenarbeit mit den Rechten selbst verboten hat, wird immer wieder laut, dass die Rechte dadurch erst stark werden konnten. Auch in der Kritik: Die “Ausgrenzung” der Freiheitlichen stärke die Position der ÖVP bei Regierungsverhandlungen. Da nur sie als einzige Partei mit zwei Großparteien verhandeln kann.
Das würde die SPÖ leichter erpressbar machen. Tirols scheidender Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer (SPÖ) fordert seit kurzem wieder eine Öffnung hin zur FPÖ, um sich nicht länger der ÖVP “auszuliefern”. Das sind also vor allem wahltaktische Überlegungen.
Warum keine Kooperation mit Rechtsradikalen?
Die FPÖ hat bei Wahlen immer wieder gute Ergebnisse – sie hat aber alleine nie eine Mehrheit. Und gewählt zu werden, macht eine Partei noch lange nicht demokratisch. Schaut man sich den Aufstieg von antidemokratischen Parteien an, erkennt man: Viele wurden mindestens einmal demokratisch gewählt.
Die Einbindung rechter Parteien in demokratischen Prozesse greift in der Folge aber die Demokratie und den Rechtsstaat selbst an. Bei grundlegenden Unterschieden nicht mit einer Partei zu koalieren, ist immer eine legitime und logische Haltung. Insbesondere, wenn diese Partei gefährlich für die demokratische Gesellschaft und ihre Institutionen sind, ist sie sogar wichtig.
Eine Demokratie besteht im Kern aus freien Wahlen, einer unabhängigen Justiz, freien Medien, Gewaltenteilung und einer freien Zivilgesellschaft. Rechtsradikale Parteien haben konkrete Vorstellungen, wie dieser Kern immer weiter zerstört werden soll.
Was ist, wenn Konservative mit Rechtsradikalen koalieren?
Diese grundsätzlichen Überlegungen zu demokratischer Haltung sollten auch nicht nur für Linke eine Rolle spielen. Sie wäre auch für und von konservativen Parteien wichtig.
Denn die Forschung deutet sogar darauf hin, dass diese eine “Schlüsselrolle” für die Gesundheit einer Demokratie haben: Wenn Konservative selbstbewusst die Werte der Demokratie hochhalten, kommen sie bei Wahlen möglicherweise auch unter Druck, aber die Chancen stehen gut, dass die Demokratie insgesamt hält.
Wenn Konservative selbst hingegen zunehmend rechtsradikale Positionen einnehmen, ist die Demokratie in echter Gefahr. Nehmen Rechtsextreme immer mehr Platz in der politischen Debatte und Regierungsämter ein, wird es gefährlich. Für den Sozialstaat, für Minderheiten, für Frauen und Arbeitnehmer:innen. Für unsere Demokratie