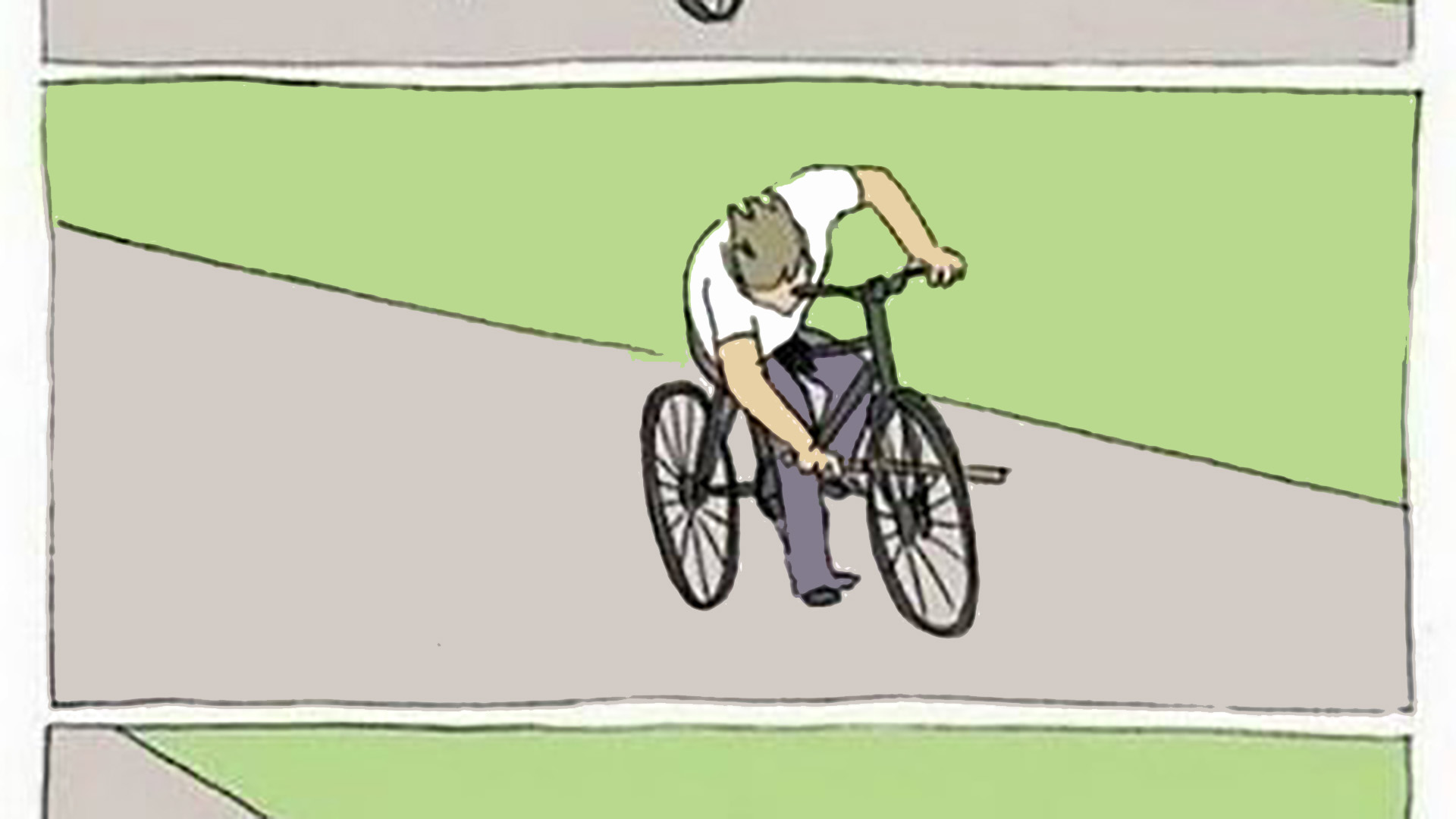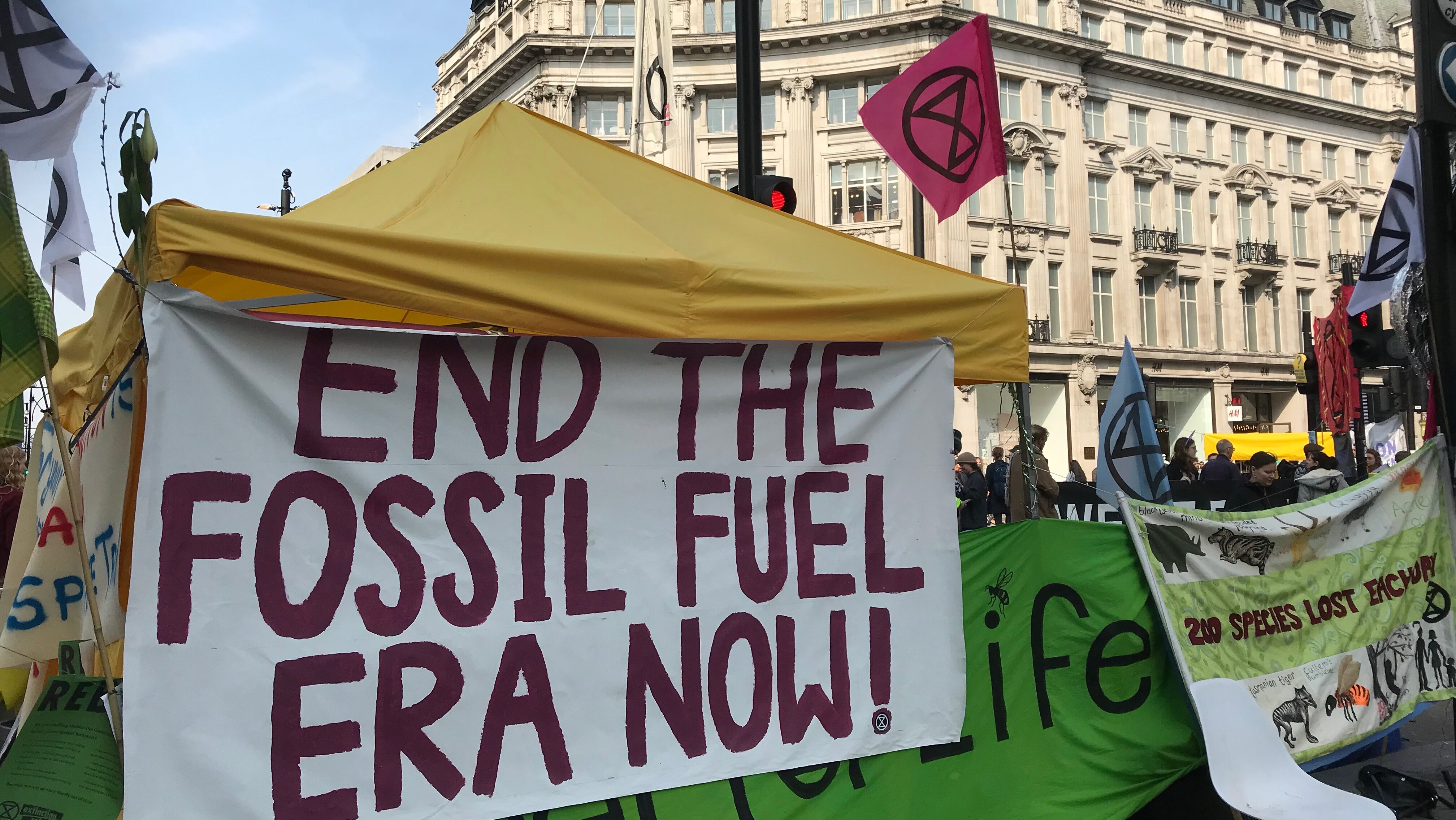Waldbrände: “Schwerwiegende Brände werden immer wahrscheinlicher”

MOMENT.at: Frau Henner, die Waldbrände in Österreich nehmen zu. Aber warum ist das so?
Dagmar Henner: Durch die Klimakrise steigen die Temperaturen und damit die Trockenheit. Das macht Wälder anfälliger für Brände. Auch die Unwettergefahr steigt durch die Erderwärmung. Mehr Wind und Blitze heizen die Waldbrandgefahr an. Blitzschläge lösen in zehn bis 25 Prozent der Fälle einen Waldbrand aus. Die meisten Brände in Österreich, aber auch in anderen Ländern werden immer noch durch Menschen verursacht - etwa 70 bis 90 Prozent. Neben den klimabedingten Veränderungen spielen aber auch geographische Faktoren eine Rolle. Ist ein Wald beispielsweise nach Süden hin ausgerichtet, ist die Waldbrandgefahr besonders hoch, weil der Boden schneller austrocknet.
MOMENT.at: Das heißt, wir müssen mit immer mehr Waldbränden rechnen in Österreich?
Henner: Ja, das Risiko für Waldbrände steigt auf jeden Fall über alle Indikatoren hinweg. Vor allem schwerwiegende Brände werden immer wahrscheinlicher. Besonders gefährdet sind Fichtenwälder, die den größten Anteil der heimischen Wälder ausmachen. Die Waldbrandgefahr in Fichtenwäldern ist dann am größten, wenn sie sich in tiefen Lagen befinden und nach Süden hin ausgerichtet sind. Fichten können mit ihren flachen Wurzeln nicht nur schlecht mit Trockenheit umgehen, sie sind mit steigenden Temperaturen auch durch Borkenkäfer bedroht. Stattdessen brauchen wir mehr Mischwälder. Sie können mit der Hitze besser umgehen und fangen weniger schnell Feuer.
MOMENT.at: Ihre Studie umfasst einen Zeitraum von 30 Jahren. Was hat sich verändert?
Henner: Die Zahl der Waldbrände ist in Österreich zwischen 1993 und 2023 deutlich gestiegen. Mehr als 4.600 Brände wurden in diesem Zeitraum verzeichnet. Besonders viele Brände gab es im Jahr 2022. Was uns aufgefallen ist: eine Verschiebung hin zur Wintertrockenheit. Da weniger Schnee fällt, fehlt der Niederschlag im Winter. Die Böden sind dann bereits im Februar ausgedörrt, also dann, wenn die Wachstumsperiode überhaupt erst anfängt. Wälder stehen damit immer mehr unter Druck. Auch durch Unwetter, die durch die Klimakrise immer früher und häufiger im Jahr auftreten, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es bereits im Frühjahr zu größeren Bränden kommen kann, zusätzlich zur Waldbrandsaison in den Sommer- und Herbstmonaten.
MOMENT.at: Haben Österreichs Wälder nicht einen Vorteil dank der alpinen Lage?
Henner: In unserer Studie vergleichen wir Österreich mit Slowenien und der Slowakei. Es ist richtig, dass die Waldbrandgefahr in höheren Lagen etwas gemäßigter ist. In Slowenien und der Slowakei brennt es häufiger als in Österreich. Das sagt aber noch nichts über die Qualität der Brände aus. In Slowenien sind die Brände beispielsweise aufgrund der mediterranen Vegetation weniger groß und weniger schwerwiegend. Unsere Fichtenwälder hingegen kommen mit Waldbränden gar nicht gut klar.
MOMENT.at: Was für Maßnahmen schlagen Sie vor?
Henner: Eine der wichtigsten Maßnahmen ist für mich die Bewusstseinsbildung. Weil viele Waldbrände noch immer durch Menschen entfacht werden, braucht es mehr Sensibilisierungskampagnen für das Thema und strengere Vorschriften. Andererseits muss darüber aufgeklärt werden, dass das Thema auch bei uns immer mehr zur Gefahr wird. Und dass uns das einiges kosten wird, wenn wir untätig bleiben. Auch ohne Präventionsmaßnahmen belaufen sich die Kosten für die Brandbekämpfung und -nachsorge im Alpenraum schätzungsweise auf 75 Millionen Euro im Jahr. Durch abgebrannte Schutzwälder könnten künftig zusätzliche Kosten entstehen. Werden sie durch Feuer geschädigt, steigt außerdem die Gefahr für Lawinen, Muren und Erdrutsche, die Schutzwälder eigentlich aufhalten sollten, besonders in steilen Hanglagen.
Das zeigt: Wir sollten viel mehr gegen die Klimakrise unternehmen auch wenn sich derzeit politisch wenig bewegt. Nicht zuletzt müssen wir dringend unsere Wälder umbauen. Die Klimakrise ist ja schon da und mit ihr die Waldbrände. Besonders die Fichten in den niederen Lagen sollten durch widerstandsfähigere Baumarten ersetzt werden, die sich besser an die Bedingungen des Klimawandels anpassen können.