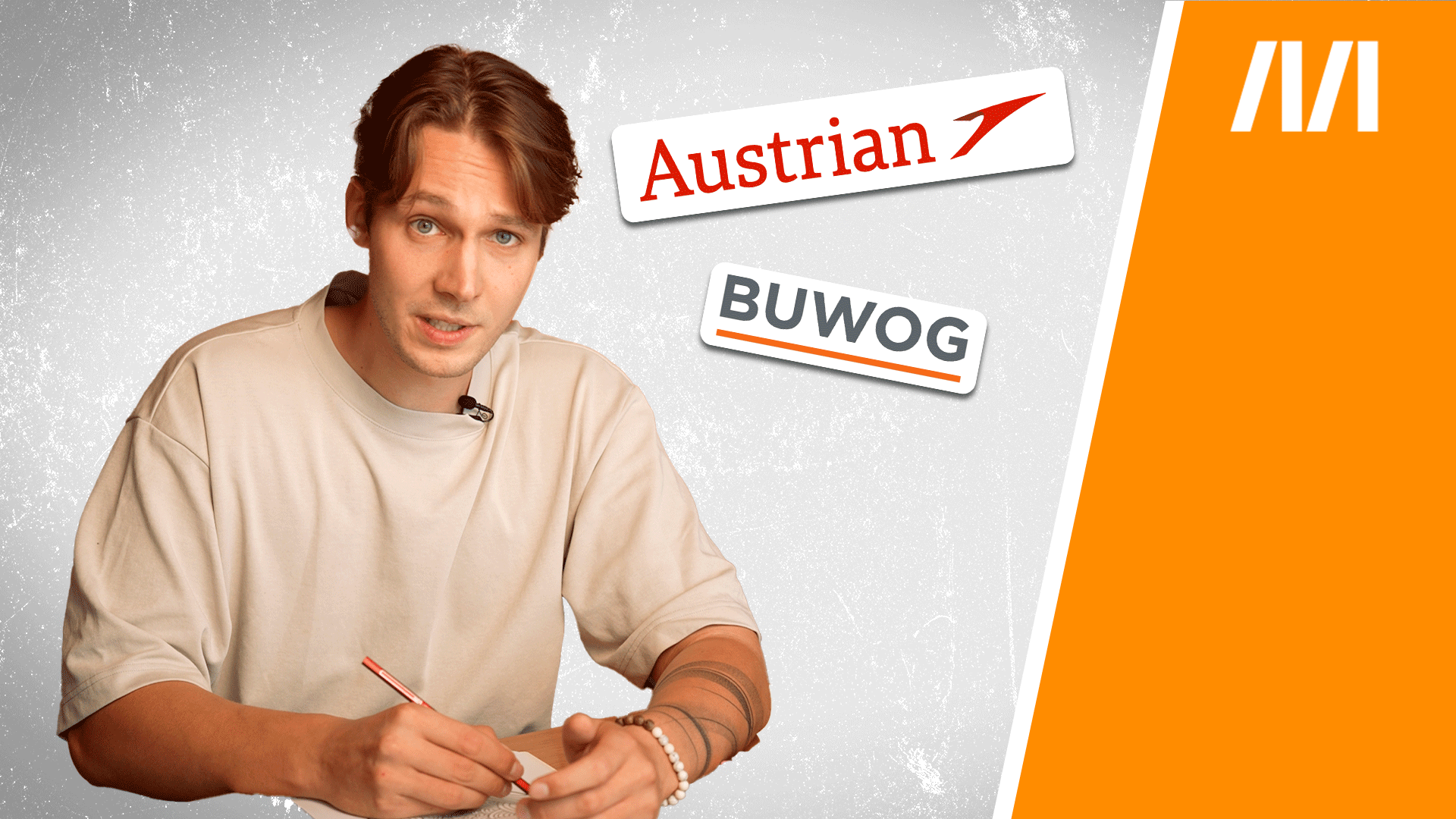Hohe Preise bei Essen, Heizen, Wohnen: Wer kann sich das Leben noch leisten?
Freu dich, dein Leben wird schon wieder teurer. Die Preise in Österreich ziehen wieder an. Und sie ziehen stärker an als anderswo. Im August lag die Inflation bei 4,1 Prozent. In der Eurozone im Schnitt bei 2,1 Prozent. Wir liegen also doppelt so hoch. Es ist deshalb nicht “die Weltlage”, die uns zwingt, mehr zu zahlen, es ist das Ergebnis politischer Entscheidungen.
Das Lebensnotwendige wird teurer
Was treibt hierzulande die Preise am stärksten, stärker noch als in anderen EU-Staaten? Es sind insbesondere jene Dinge, denen wir nicht ausweichen können, weil sie zum Leben unbedingt nötig sind: Essen, Energie, Wohnen.
Dazu kommt, dass zentrale Stützen weggefallen sind. Die Strompreisbremse, die den Anstieg der Energiekosten zumindest teilweise abfedern sollte, lief Ende 2024 aus. Seit Jänner 2025 zahlen Haushalte wieder ihre vollen Energiepreise.
Verzicht auf Preiskontrollen
Gleichzeitig ist Österreich beim Thema Preiskontrolle im EU-Vergleich Schlusslicht. Eurostat zeigt: Nur knapp neun Prozent unseres Inflationswarenkorbs unterliegen administrierten Preisen. Im EU-Schnitt sind es zwölf Prozent, in der Schweiz sogar über dreißig. Und die Bilanz ist eindeutig: Überall dort, wo Preise reguliert oder gedeckelt wurden, stiegen sie deutlich langsamer. Das heißt, wir lassen Spielräume ungenutzt, die andere Länder längst erfolgreich verwenden.
Noch ein Grund, warum es bei uns teurer bleibt: Lebensmittel. Markenprodukte sind in Österreich im Schnitt über zwanzig Prozent teurer als in Deutschland. Die Arbeiterkammer hat dazu einen klaren Vergleich vorgelegt: In über achtzig Prozent der Fälle kosten identische Produkte hierzulande mehr. Das ist kein Naturgesetz, das sind Marktstrukturen. Dazu gehören territoriale Lieferbeschränkungen, die verhindern, dass günstigere Ware aus Nachbarstaaten hier verkauft wird.
Nur ein Anfang ist gemacht
Nun ist es nicht so, dass die österreichische Regierung in den vergangenen Monaten untätig gewesen wäre. Bei der Regierungsklausur wurden durchaus Maßnahmen angekündigt: der Ausbau der Mietpreisbremse auch für die freien Mieten, ein Paket gegen hohe Lebensmittelpreise, auch beim Strom sollen die Kosten gestützt - vor allem für die Industrie.
Es ist ein Anfang, reicht aber nicht, um die Inflation spürbar nach unten zu bringen. Wenn man die Teuerung wirklich bremsen will, dann braucht es klare Regeln, verbindliche Grenzen und langfristige Mechanismen, nicht bloß Ankündigungen und Absichtserklärungen.
Die Mieten
Schauen wir zuerst auf die Mieten. Wohnen frisst einen enormen Teil des Haushaltsbudgets. Und weil Mieten so schwer wiegen, treiben sie auch die Inflationsrate direkt nach oben. Österreich hat zwar schon eine Mietpreisbremse eingeführt, aber: sie gilt bisher nur für Altbauwohnungen, Gemeindewohnungen und Genossenschaftswohnungen.
Aber ein Viertel der Mieter:innen wohnt im freifinanzierten Neubau. Genau dort greifen die bisherigen Regelungen nicht, und genau dort sind die Mieten besonders hoch.
Die Mieten werden angeheizt
Würde man die Mietpreisbremse auf diesen Bereich ausweiten, wären sofort rund 430.000 Haushalte entlastet. Das ist nicht wenig, das ist fast jede vierte Mieterfamilie in Österreich.
Noch dazu steigen Mieten in Österreich automatisch mit der Inflation – das ist ein eingebauter Brandbeschleuniger. Darum reicht es nicht, die Mietpreisbremse nur kurzfristig anzuziehen. Man muss den Anstieg dauerhaft begrenzen. Zwei Prozent pro Jahr wären eine faire, planbare Obergrenze. Alles darüber verschärft die Teuerung nur weiter und macht das Wohnen für breite Schichten unleistbar.
Betriebskosten für Vermieter:innen
Doch es geht nicht nur um die nackte Miete. Auch die Betriebskosten sind in den letzten Jahren kräftig gestiegen. Viele dieser Posten sind schlicht versteckte Gewinn- oder Entlastungspakete für die Vermieter. Nehmen wir die Grundsteuer: Sie ist eine Steuer auf das Eigentum, aber die Vermieter reichen sie an die Mieter:innen einfach weiter. Gleiches gilt für Versicherungen oder Verwaltungshonorare. All das sind Ausgaben, die nicht die Mieter:innen, sondern die Eigentümer tragen sollten.
Wenn man diese Posten aus dem Betriebskostenkatalog streicht, senkt das die durchschnittliche Miete um bis zu zehn Prozent. Das ist eine sofort spürbare Entlastung. Und es geht um Fairness: Wer Vermögen besitzt, soll die damit verbundenen Kosten nicht auf jene abwälzen, die ohnehin schon mit jeder Indexanpassung kämpfen.
Dazu kommt: Der Betriebskostenkatalog ist bisher nur für Altbauten und geförderte Neubauten klar geregelt. Im freifinanzierten Bereich gibt es keine eindeutigen Grenzen, was alles verrechnet werden darf. Das öffnet Tür und Tor für zusätzliche Belastungen. Ein einheitlicher, allgemein gültiger Betriebskostenkatalog würde hier für Transparenz und Gerechtigkeit sorgen.
Wenn man also wirklich gegen die Teuerung vorgehen will, muss man beim Wohnen ansetzen: Mietpreisbremse für alle, Deckel auf zwei Prozent, und Betriebskosten so regeln, dass sie nicht länger ein versteckter Gewinntransfer sind.
Die Energiepreise
Der zweite große Block sind die Energiepreise. Sie sind nicht nur ein Posten auf der Haushaltsrechnung, sondern ein zentraler Treiber der Inflation insgesamt. Denn Strom, Gas und Fernwärme fließen in jede Produktion, jeden Transport, jede Kühlkette ein. Wenn Energie teurer wird, dann verteuert sich alles.
Österreich hat in den vergangenen Jahren gesehen, was passiert, wenn die Energiepreise aus dem Ruder laufen. Plötzlich schossen die Stromrechnungen in die Höhe, obwohl die Produktion aus Wasserkraft eigentlich billig ist. Der Grund: das Strommarktdesign. Durch die sogenannte Merit-Order bestimmt das teuerste Kraftwerk den Preis für alle. Und weil auch Österreich noch viele Gaskraftwerke hat, zahlen die Haushalte und Unternehmen auch für günstigen Ökostrom den Gaspreis. Das ist absurd und es treibt die Inflation künstlich nach oben.
Wie machen es andere?
Andere Länder haben Wege gefunden, das zu vermeiden. Die Schweiz hat ihren Haushaltsstrommarkt nie liberalisiert. Dort gibt es eine regulierte Grundversorgung. Preise werden von einer Aufsicht kontrolliert, die sicherstellt, dass günstige Produktionskosten auch wirklich bei den Kund:innen ankommen. Stabilität statt Preisschocks: genau das macht den Unterschied.
Für Österreich heißt das: Wir müssen die Liberalisierung zurücknehmen und wieder eine regulierte Grundversorgung einführen. Die künstliche Trennung zwischen Erzeugung und Vertrieb gehört aufgehoben. Energieunternehmen wie der Verbund dürfen nicht länger wie Aktiengesellschaften am Gewinn für ihre Aktionär:innen gemessen werden, sondern müssen gesetzlich ans Allgemeininteresse gebunden werden. Wenn sie als Genossenschaften organisiert wären, ginge es gar nicht um Gewinnausschüttungen, sondern um niedrige Preise für die Mitglieder, also für uns alle: Haushalte, Betriebe, öffentliche Einrichtungen.
Gaskraftwerke neu betrachten
Und dann sind da die Gaskraftwerke. Österreich betreibt 65 davon. In der jetzigen Logik treiben sie die Preise hoch, weil sie in der Merit-Order oft die Preissetzer sind. Würde man sie verstaatlichen und als Kriseninfrastruktur behandeln, könnten sie Versorgungssicherheit gewährleisten, ohne den Strompreis in die Höhe zu schießen. So könnte man den Strompreis vom Gaspreis entkoppeln und die Inflationsspirale durchbrechen.
Kurz gesagt: Energiepreise sind kein Naturgesetz. Sie sind das Ergebnis politischer Rahmenbedingungen. Wer sie reguliert, wie die Schweiz es tut, hält die Inflation niedrig. Wer sie dem Markt überlässt, riskiert Preisschocks, die Haushalte und Unternehmen gleichermaßen treffen.
Die Lebensmittel
Der dritte große Kostenblock sind die Lebensmittel. Und gerade hier zeigt sich, wie schlecht Österreich im europäischen Vergleich dasteht. Für denselben Einkauf zahlen wir hierzulande deutlich mehr als unsere Nachbar:innen in Deutschland. Die Arbeiterkammer hat es belegt: Markenprodukte kosten bei uns im Schnitt über zwanzig Prozent mehr. Manche Artikel sogar doppelt so viel.
Ein Teil dieser Differenz erklärt sich aus Strukturen. Lieferanten behandeln kleine Märkte wie Österreich oft schlechter als große Märkte wie Deutschland. Territoriale Lieferbeschränkungen verhindern, dass günstige Ware aus dem Ausland importiert wird. Das Ergebnis ist der berüchtigte „Österreich-Aufschlag“. Solange die Beschränkungen nicht EU-weit abgeschafft werden, zahlen wir mehr, nur weil wir auf der falschen Seite der Grenze wohnen.
Was andere Länder tun
Andere Länder haben bewiesen, dass man gegen hohe Lebensmittelpreise durchaus etwas tun kann. Kroatien hat Preise für bestimmte Grundprodukte gedeckelt, und zwar befristet, eng begrenzt und kontrolliert. Portugal hat die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel zeitweise auf null gesetzt. Dort betraf das 46 Produkte, die Maßnahme lief neun Monate und führte zu einer fast vollständigen Weitergabe der Steuerersparnis an die Kund:innen. Rumänien wiederum hat Margenobergrenzen für Lebensmittel eingeführt und sie zuletzt verlängert. Frankreich hat eine Preistransparenz-Datenbank aufgebaut, die dokumentiert, wie Preise und Margen entlang der gesamten Kette entstehen – vom Erzeuger über den Handel bis zur Kassa.
Für Österreich heißt das: Wir brauchen einen preisstabilen Warenkorb, der für jede Warengruppe ein günstiges Standardprodukt vorsieht, das klar gekennzeichnet und kontrolliert wird. Wir brauchen eine temporäre Null-Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, mindestens für ein Jahr, mit einer Wettbewerbsbehörde, die die Weitergabe lückenlos kontrolliert. Wir brauchen eine Preistransparenz-Datenbank nach französischem Vorbild, die Margen offenlegt und damit die Grundlage schafft, gezielt einzugreifen. Und wir brauchen – wo nötig – temporäre Margenobergrenzen, um sicherzustellen, dass Senkungen bei den Erzeugerpreisen auch wirklich bei den Konsument:innen ankommen.
Arbeit auf EU-Ebene
Und schließlich muss der „Österreich-Aufschlag“ fallen. Territoriale Lieferbeschränkungen dürfen nicht länger dazu führen, dass wir für dieselben Produkte mehr bezahlen als andere. Hier ist die EU gefragt, aber Österreich muss auf internationaler Ebene Druck machen, damit diese Praxis endlich verschwindet.
Lebensmittel sind kein Luxus. Sie sind Grundversorgung. Und deshalb ist es völlig legitim, wenn der Staat eingreift, um Preise fair zu gestalten. Kroatien, Spanien, Portugal, Rumänien und Frankreich zeigen: es funktioniert. Es senkt die Inflation und entlastet die Haushalte spürbar.
Was wir brauchen
Wenn wir alles zusammenfassen, ergibt sich ein klares Bild: Österreich hat ein Inflationsproblem, das nicht vom Himmel gefallen ist. Es ist das Ergebnis politischer Untätigkeit und halbherziger Maßnahmen. Während andere Länder längst eingegriffen haben, wurde bei uns zu lange zugeschaut.
Die Stellschrauben liegen auf dem Tisch. Bei den Mieten braucht es einen echten Deckel – nicht nur für Altbauten und Gemeindewohnungen, sondern auch für den freifinanzierten Neubau, wo die Kosten besonders hoch sind. Ein Viertel aller Miethaushalte würde so sofort entlastet. Indexsteigerungen müssen dauerhaft bei maximal zwei Prozent pro Jahr begrenzt werden. Und die Betriebskosten gehören bereinigt: Grundsteuer, Versicherungen, Verwaltung – das sind Eigentümerkosten, kein Mieter-Service. Streicht man sie aus dem Katalog, sinken die Mieten im Schnitt um bis zu zehn Prozent.
Bei der Energie müssen wir das Rad nicht neu erfinden. Die Schweiz zeigt seit Jahren, wie man Haushalte schützt: mit einer regulierten Grundversorgung, einer starken Preisaufsicht und Unternehmen, die nicht auf Gewinnmaximierung, sondern auf Versorgung ausgerichtet sind. Österreich kann denselben Weg gehen: Liberalisierung zurücknehmen, Verbund und andere Versorger am Gemeinwohl orientieren, Gaskraftwerke als öffentliche Kriseninfrastruktur organisieren. Und die Merit-Order so reformieren, dass Gas nicht länger alle Preise nach oben zieht. Ergebnis: niedrigere Energiekosten, stabilere Inflation.
Und bei den Lebensmitteln gilt: Wir wissen längst, was funktioniert. Portugal hat die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel gestrichen und so sofortige Entlastung geschaffen. Kroatien hat bestimmte Produkte gedeckelt. Rumänien hat Margen begrenzt. Frankreich macht Preistransparenz zum Standard. Österreich kann genau diese Instrumente übernehmen: ein preisstabiler Warenkorb, eine Null-Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel, transparente Daten über Preise und Margen, zeitlich begrenzte Margenobergrenzen, und ein Ende des “Österreich-Aufschlags” durch territoriale Lieferbeschränkungen.
Wir alle könn(t)en uns das Leben leisten
Das sind keine radikalen Ideen. Das sind erprobte Maßnahmen, die funktionieren und die in anderen Ländern längst Wirkung gezeigt haben.
Die Frage war: Wer kann sich das Leben noch leisten? Die Antwort ist: Wir alle: wenn wir politisch dafür sorgen. Mit einem Mietendeckel, mit regulierten Energiepreisen, mit fairen Lebensmittelpreisen.