Metaller-KV: Ein echtes Lohnplus zur rechten Zeit

Kein langes Abtasten, kein wochenlanges Tauziehen: Der neue Kollektivvertrag für die Metallindustrie war in diesem Jahr eine Formsache. Denn auf die Grundzüge der diesjährigen Lohnerhöhungen einigten sich Gewerkschaften und Arbeitgeberseite schon beim schwer erkämpften Abschluss des Metaller-KV im vergangenen Jahr.
Metaller-KV steigt um 4,8 Prozent
Die Ist-Gehälter und Löhne sollten um die rollierende Inflation plus ein Prozent steigen. Diese durchschnittliche Teuerungsrate über die vergangenen 12 Monate betrug 3,8 Prozent. Folglich steigen die Löhne und Gehälter der rund 200.000 Beschäftigten in Metallindustrie und Bergbau ab dem 1. November um 4,8 Prozent. Der KV-Mindestlohn wird genau um die rollierende Inflation erhöht. Er liegt nun bei 2.518,40 Euro. Die Lehrlingseinkommen werden im Schnitt um 5,4 Prozent angehoben.
Als „kräftiges Zeichen für eine lösungsorientierte Sozialpartnerschaft“, bezeichneten das die Chefverhandler aufseiten der Beschäftigten: Reinhold Binder von der Produktionsgewerkschaft PRO-GE und Karl Dürtscher von der Gewerkschaft der Privatangestellten GPA. Die erzielten realen Erhöhungen sicherten die Einkommen der Arbeitnehmer:innen, „die nach wie vor mit den Folgen der Teuerungswelle und Zinserhöhungen konfrontiert sind“.
Das “automatische” Plus bei Lohn und Gehalt der Beschäftigten bereits im vergangenen Jahr ausverhandelt zu haben, erweist sich nun als gute Entscheidung. Angesichts der massiven Teuerung und einem der härtesten Arbeitskämpfe seit Jahrzehnten ging es im vergangenen Jahr darum, echte Lohnerhöhungen auch für die Tarifrunde 2024 sicherzustellen – ohne wochenlangen Verhandlungsmarathon und Streiks.
Krise der Industrie: Schuld sind nicht die Löhne
Es ist ein guter Abschluss für die Beschäftigten in schwierigen Zeiten für die Metallindustrie. Bereits seit zwei Jahren schrumpft Österreichs Wirtschaft. Es ist die längste Rezession seit 1946. Die Metallindustrie leidet stark: Ihr Fachverband meldete für das erste Halbjahr einen Produktionsrückgang von 10 Prozent. Und schoss sich gleich scharf auf einen Grund dafür ein: Es läge an den „explodierenden Lohnkosten in der österreichischen Industrie“.
Doch das ist allenfalls ein Teil der Wahrheit. Die zuletzt starken Lohnabschlüsse waren lediglich die Folge einer Explosion an anderer Stelle: nämlich bei den Preisen. Die Teuerung in Österreich war 27 Monate hintereinander höher als im Euroraum. Die scheidende Regierung ließ sie einfach durchrauschen und trat nicht auf die Preisbremse bei Energie, Mieten und Lebensmitteln.
Österreichs Beschäftigte in der Metallindustrie verloren in den Jahren 2021 und 2022 stark an Kaufkraft. Zahlen des Momentum Institut zeigen: Diese Verluste werden erst in diesem und im kommenden Jahr wieder ausgeglichen. Vorausgesetzt, Österreich bekommt die Inflation nachhaltig in den Griff.
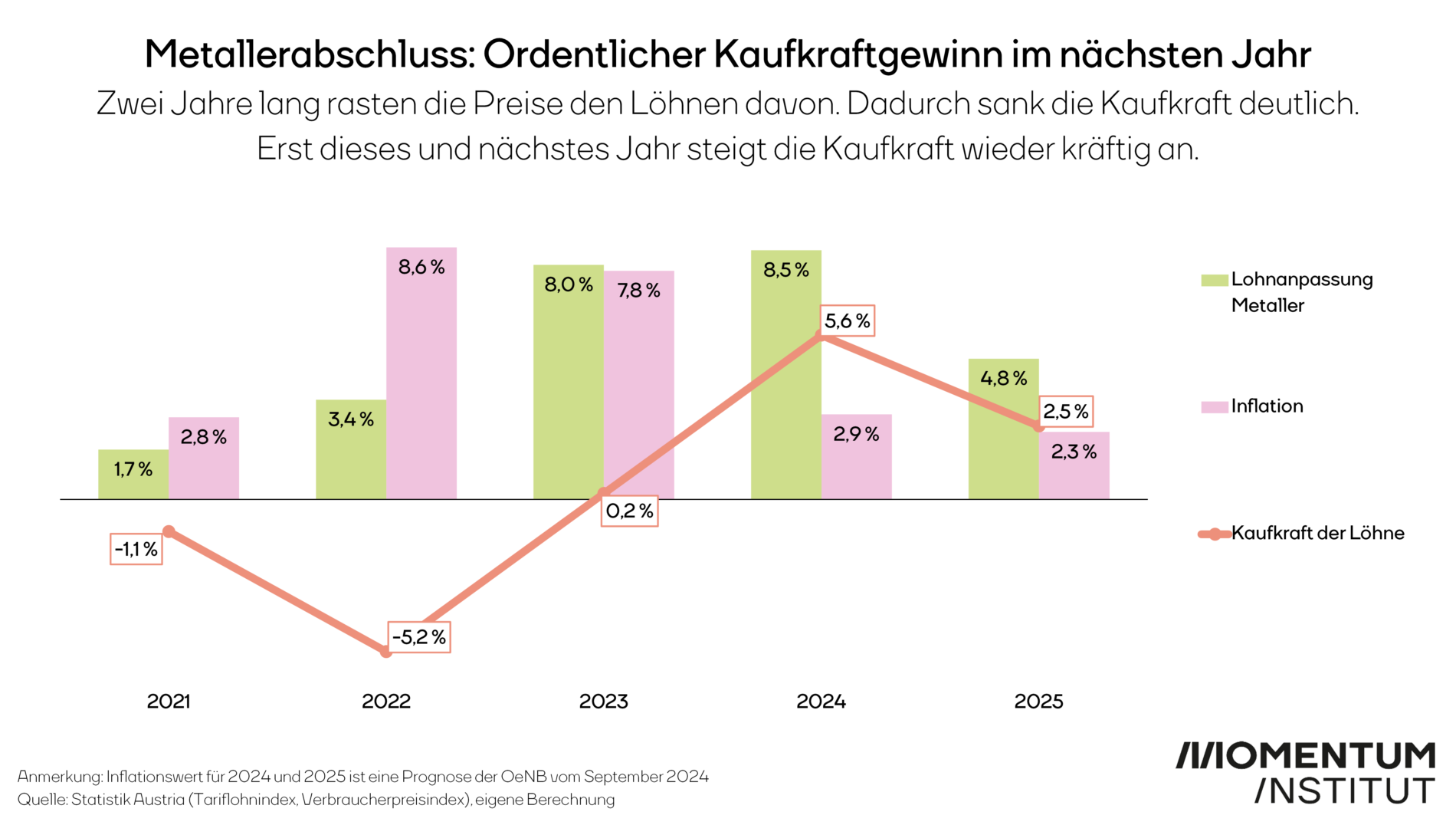
Wenn die Industrie über (zu) hohe Lohnstückkosten klagt, dann ist zu beachten: Löhne und Gehälter sind nur ein Teil der Unternehmens-Ausgaben. Dazu kommt noch der Aufwand für Material und für Energie. Es war der „Energiepreisschock“ infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, der Österreich besonders hart traf und der Industrie schwer zu schaffen machte. Und noch immer ist Österreich an russisches Gas geknebelt.
Sind Jobs in Gefahr, kann vom KV abgewichen werden
Was sicher ist: Höhere Löhne und Gehälter nützen nichts, wenn Betriebe infolge der Krise Jobs streichen müssen. Das war auch den Gewerkschaften klar, als sie sich im vergangenen Jahr mit den Arbeitgeber:innen auf eine „Härtefallklausel“ für die Metallindustrie einigten. Betriebe mit einem besonders hohen Lohnkostenanteil können sie beantragen. Die Löhne und Gehälter steigen in diesen Betrieben etwas weniger.
Konkret: In Firmen, in denen die Personalkosten mehr als 75 Prozent der Bruttowertschöpfung ausmachen, kann die Gehaltssteigerung auf 4,05 Prozent angepasst werden. In Betrieben mit 90 Prozent Personalaufwand an der Wertschöpfung kann es auf 3,3 Prozent gehen. Das geht aber nur, wenn die Mitarbeiter:innen als Ausgleich zusätzliche bezahlte Freizeit oder eine Einmalprämie erhalten.
Laut Industriemagazin vom Dezember 2023 wären im abgelaufenen Jahr rund ein Viertel aller Unternehmen der Branche für diese Klausel qualifiziert gewesen. Jetzt, rund ein Jahr später, gibt die Gewerkschaft PRO-GE an: In 80 von 1.700 Betrieben wurde die „Wettbewerbssicherungs-Klausel für Härtefälle“ tatsächlich angewendet.
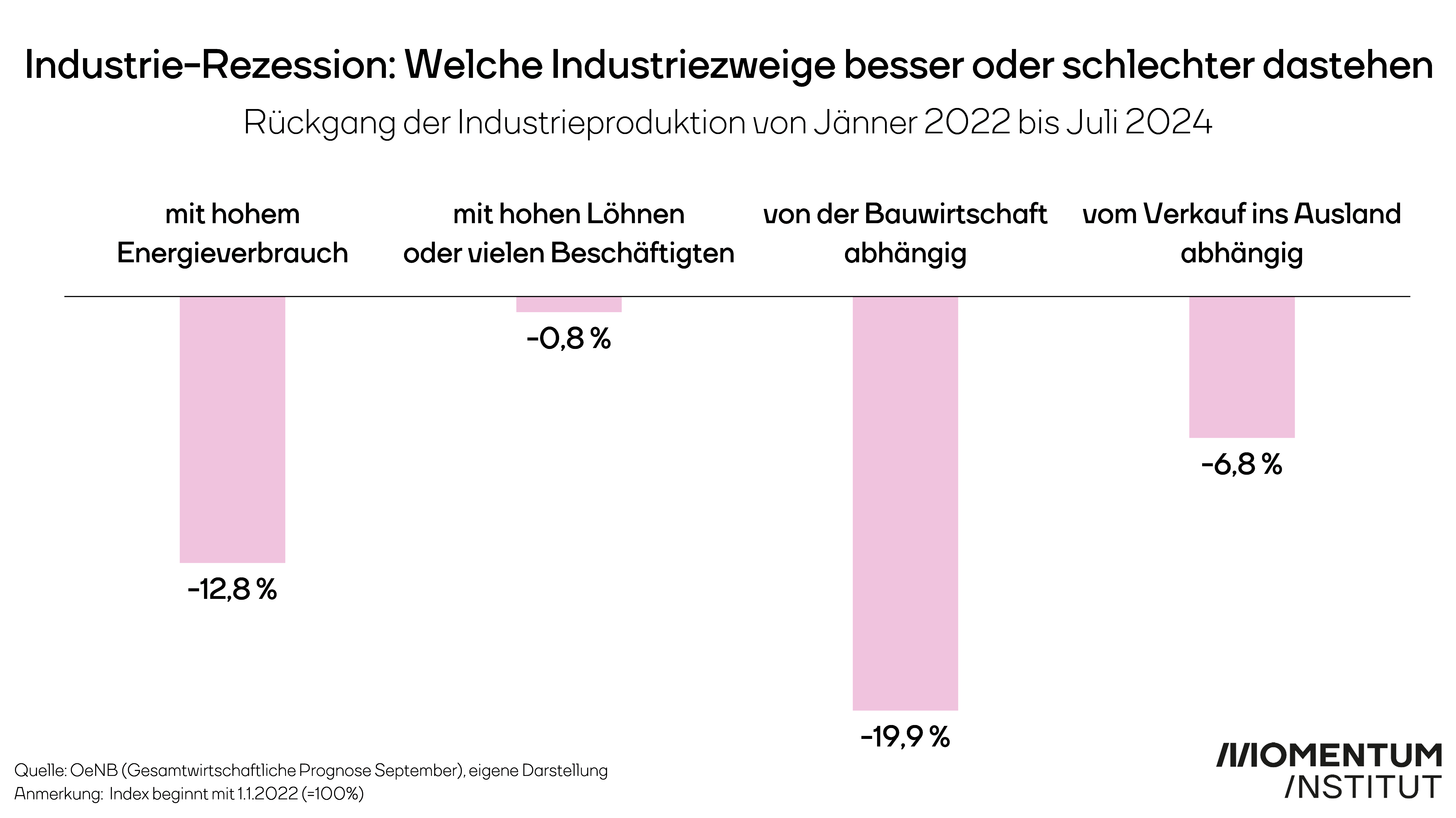
Die Lage der Metallindustrie ist derzeit nicht gut. Dennoch überzeichnet die Branche immer wieder das Ausmaß der Krise und den Einfluss der Löhne darauf. Zahlen des Momentum Instituts zeigen: In Industrie-Unternehmen mit hohen Löhnen oder vielen Beschäftigten ging die Produktion zwischen Anfang 2022 und Mitte dieses Jahres um 0,8 Prozent zurück. Viel schwerer getroffen wurden Firmen, die einen hohen Energieverbrauch haben. um 12,8 Prozent sackte hier die Produktion nach unten. Darunter sind viele Unternehmen der Metallindustrie.
Und dass etwa Österreichs Automobilzulieferer schwächeln, hat wenig mit Lohnabschlüssen zu tun. Vorher haben deren größte Kunden, die deutschen Autobauer, den Umstieg zur leistbaren E-Mobilität verschlafen. Kanzler Karl Nehammer beharrte darauf, dass Österreich ein „Verbrennerland“ sei. Im Sinne des Klimaschutzes erst auf E-Mobilität setzen und dann wieder zurückrudern: Mit dieser Unsicherheit können Unternehmen nicht wirtschaften. Davor haben selbst die Unternehmen gewarnt. Für diese Versäumnisse und Verwirrung die Beschäftigten der Branche mit Lohnverzicht bezahlen zu lassen, ist nicht fair.










