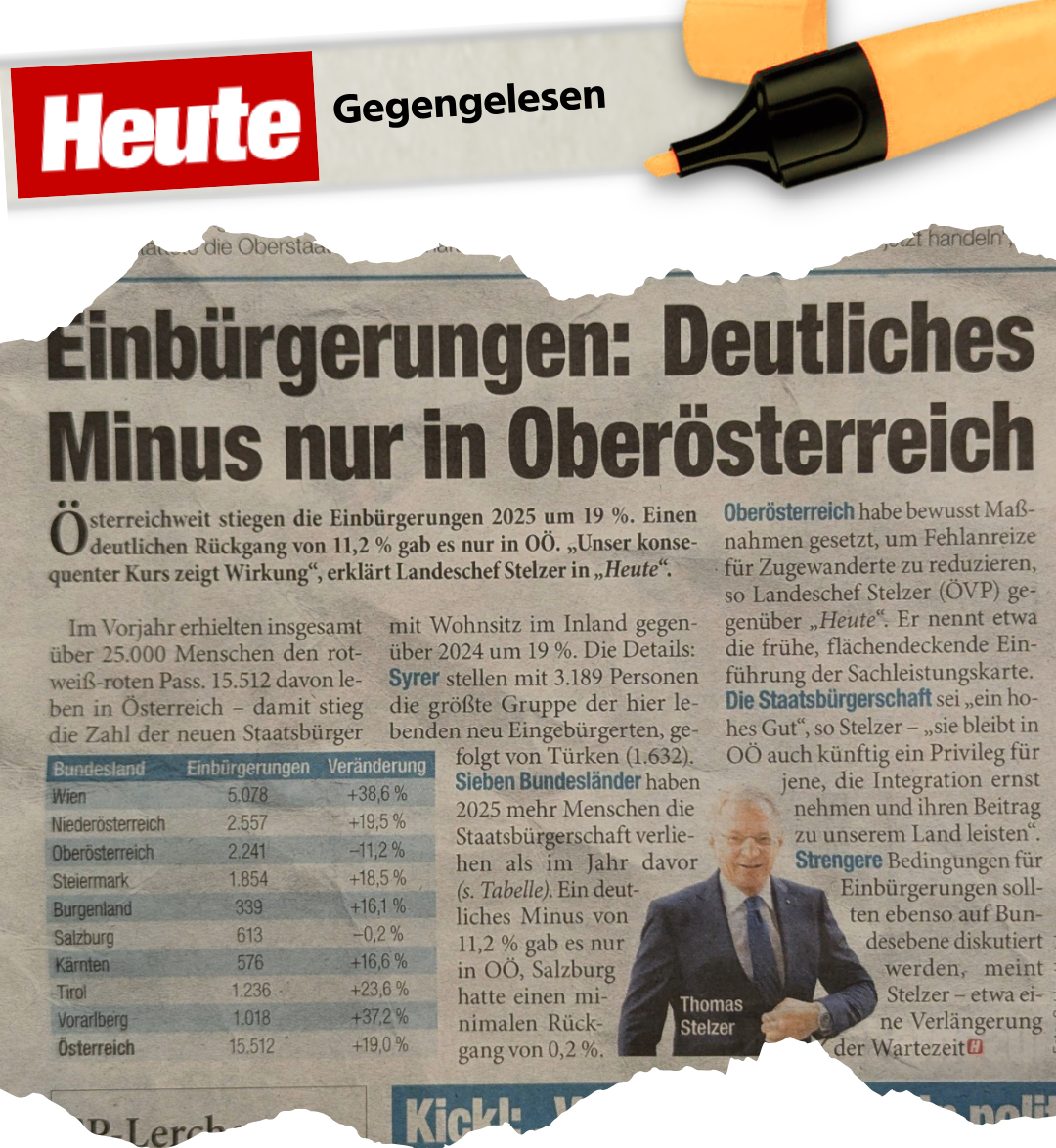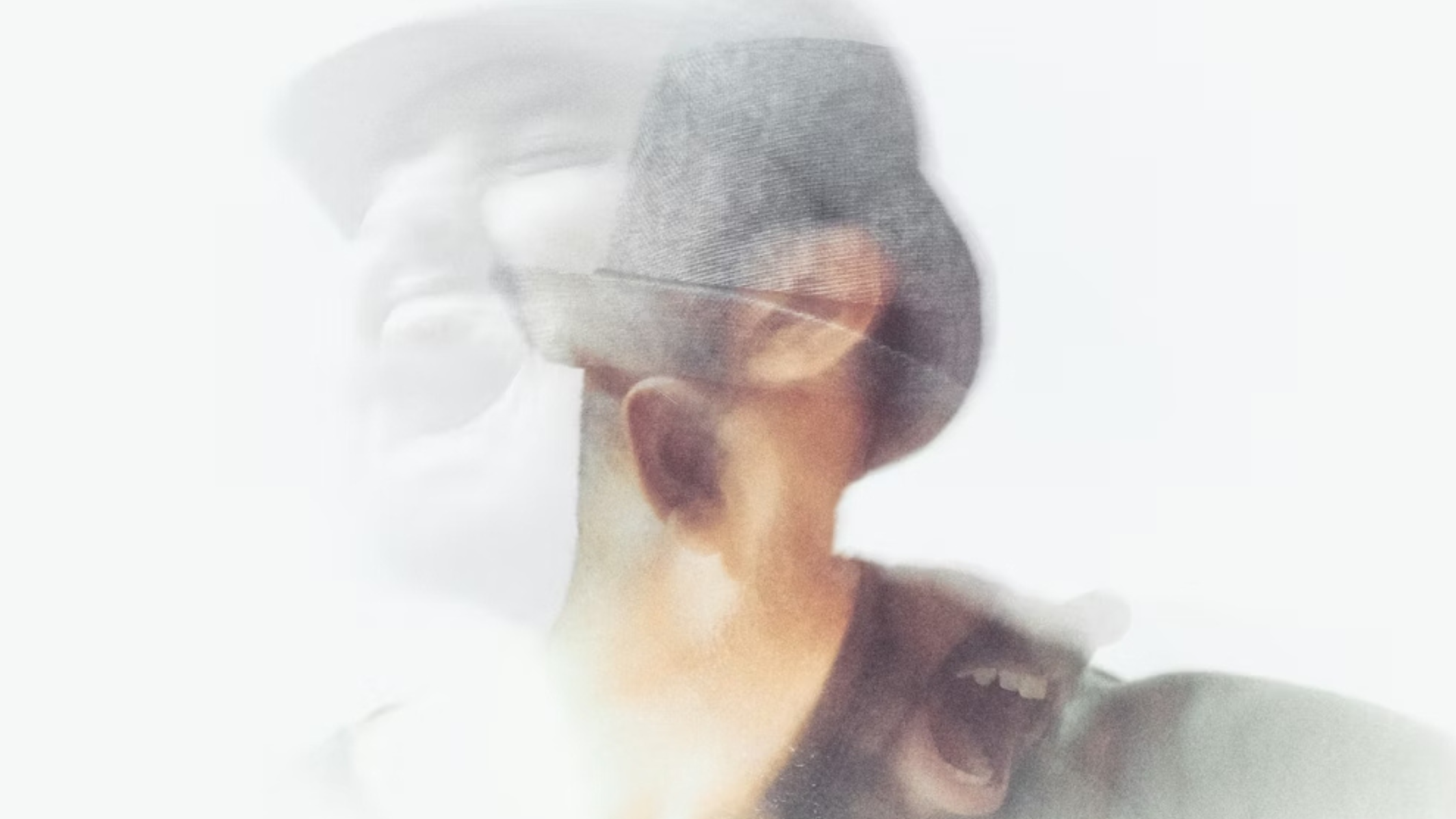Ein Land erstickt in unserer alten Kleidung

228.100 Tonnen Textilabfälle fallen in Österreich jährlich an. Dazu zählen Altkleider, gebrauchte Schuhe, Haus- und Heimtextilien. Etwa 17 Prozent werden wiederverwertet und recycelt. Ein Großteil wird verbrannt. Ein weiterer großer Teil exportiert - 2022 waren das 67.000 Tonnen Textilabfall. Wohin eigentlich, das bleibt oft unklar, mahnt der Verein für Entwicklungspolitik und globale Gerechtigkeit Südwind.
80.000 Tonnen Altkleider trotz Einfuhrverbot
Eines der Länder, in denen unsere Altkleidung landet, ist Uganda. Rund 80.000 Tonnen Altkleidung landen jährlich im ostafrikanischen Land – hauptsächlich aus Europa und Asien. Und das, obwohl der Präsident Yoweri Museveni die Einfuhr von Altkleider 2023 verboten hat. Vor allem in der Hauptstadt Kampala werden die Kleider gesammelt, sortiert, verteilt und auf dem Owino-Markt verkauft.
Der Handel mit Second-Hand-Kleidung ist ein riesiger Markt, in dem geschätzt rund 700.000 Menschen – hauptsächlich Frauen und junge Menschen – arbeiten. Und er ist ein riesiges Problem, berichtet Faith Irene Lanyero. Sie ist Gewerkschafterin der Uganda Textile Garments, Leather & Allied Workers Union und weiß darüber Bescheid.
Altkleider in Uganda: Lokale Betriebe leiden
Die lokale Textilindustrie leidet unter der billigen Second Hand-Kleidung. Einerseits, da sie billiger verkauft wird als lokal produzierte Kleidungsstücke. Andererseits, weil viele Menschen die gebrauchte Kleidung aus dem Ausland für qualitativ hochwertiger halten als lokale Produkte. Obwohl laut Lanyero 60 Prozent der Altkleider gar nicht mehr zu gebrauchen und damit Müll sind.
Unsere Altkleider sind Gefahr für Mensch und Umwelt
Die Unmengen an Altkleidern landen in der Umwelt – zusammen mit anderem Müll. Dadurch gelangen Schadstoffe und Mikroplastik in die Umwelt. Woran dabei kaum jemand denke: Die Probleme kommen so auch wieder zurück nach Europa, erklärt Lanyero. Beispielsweise Fische, die erst das Mikroplastik aus unseren Altkleidern aufnehmen und dann zum Verspeisen exportiert werden.
Außerdem landen Kleidungsstücke in Gewässern und Wasserleitung und verstopfen diese, was zu Überschwemmungen führt. An Land entstehen oft riesige Müllberge. Von diesen geht eine besondere Gefahr aus. So geriet im August 2024 die 14 Hektar große Deponie Kiteezi in Kampala nach Regenfällen ins Rutschen und begrub mehrere Wohnhäuser. 21 Menschen kamen bei dem Erdrutsch ums Leben. Eine „Katastrophe, die vorhersehbar war“, sagte Kampalas Bürgermeister Erias Lukwago gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.
"Moderne Sklaverei"
Altkleider in Uganda sind Fluch und Segen zugleich
Dennoch ist ein Einfuhrverbot nicht die Lösung. Zumindest nicht auf kurzfristige Sicht, macht die Gewerkschafterin deutlich. Einerseits ist der Handel mit Second Hand-Kleidung eben eine wichtige Beschäftigungsquelle. Auch wenn die oft inoffiziell und damit ein eigenes großes Problem ist. So werden auch Arbeitsrechte untergraben. Es gebe schlechte Bezahlung und wenig bis keinen Schutz. Die Gewerkschafterin berichtet von Arbeiter:innen, die eingesperrt werden, von langen Schichten in der Hitze ohne Essen und Trinkwasser und von Missbrauch. Sie nennt die Zustände „moderne Sklaverei“.
Ein weiterer Aspekt, der laut Lanyero trotzdem zeitweilig noch für den Handel mit Second Hand-Kleidung spricht: Er bietet günstige Kleidung für Menschen mit niedrigen Einkommen. Zumal die lokale Textilindustrie mit tendenziell alten Maschinen nicht die benötigte Menge an Kleidung herstellen könne.
Was für Lösungen brauchen wir?
Es braucht aber sowohl kurzfristige als auch langfristige Lösungen. Dazu gehört laut Lanyero und Südwind-Sprecherin Gertrude Klaffenböck: Mehr Transparenz bei den Wegen, wo unsere Altkleider landen. Außerdem strengere Vorschriften für Second Hand-Importe, sodass nicht mehr 60 Prozent der Exporte aus Müll bestehen. Es brauche stärkere Rechte für Arbeiter:innen und faire Arbeitsplätze. Außerdem müssten mit EU-Gesetzen soziale und ökologische Gerechtigkeit im Handel gefördert werden. Dabei wurden auch schon erste Schritte unternommen.

Lanyero berichtet von einem Recyclingprojekt zwischen EU und Uganda, das bereits angelaufen sei und eine vorübergehende Lösung für den Müll bieten soll. Dabei sollen Kleidungsstücke zu Garn recycelt werden. Es komme aber auch darauf an, dass es ordnungsgemäß verwaltet und umgesetzt wird.
Ganz zentral sind laut Klaffenböck drei andere EU-Rechtsinstrumente, die auch schon früher ansetzen und die produzierenden Unternehmen in die Pflicht nehmen: Die Ökodesign-Verordnung (ESPR), die zum Ziel hat, dass Produkte energie- und ressourcenschonender werden und ihre Kreislauffähigkeit verbessert wird. Die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR), die Unternehmen dazu anregt, nachhaltigere und recycelbare Produkte und Fertigungsprozesse zu entwerfen. Und das Lieferkettengesetz (CSDDD). In Letzteres habe Südwind große Hoffnungen gesetzt, sagt die Sprecherin für Textillieferketten. „Wir sehen aber jetzt eine Branche, die jammert über Bürokratie, wenn von ihr gefordert wird, dass sie die Anforderungen des internationalen Menschenrechts und Völkerrechts einhält. Sollte das EU-Lieferkettengesetz tatsächlich aufgeweicht werden, was zu befürchten ist, dann bleiben Ultra Fast Fashion- und Fast Fashion-Unternehmen relativ unbehelligt und können weitermachen wie bisher“, warnt sie. Das EU-Omnibus-Paket gefährdet nämlich diese Reformen. Unter dem Deckmantel der „Vereinfachung“ drohen Verzögerungen und Schlupflöcher, dass die Verantwortung der Unternehmen für Menschenrechte und Umweltstandards abgeschwächt werden. Österreichs neuer Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmansdorfer (ÖVP) hat sich offen gegen das Lieferkettengesetz ausgesprochen.
Was kann ich tun?
Neben der Verantwortung der Unternehmen können auch Privatpersonen etwas gegen die Probleme durch Altkleider tun. Klaffenböck zählt auf: Kleidung, die nicht mehr getragen wird, soll nur dann gespendet werden, wenn sie noch in gutem Zustand ist. Ansonsten soll sie im Müll entsorgt werden. So bleibe die Verantwortung für die Entsorgung immerhin im Land.
Was nicht sein dürfe: „dass wir nun auch noch das Müllproblem auslagern. So wie wir die Umweltprobleme und die Arbeitsrechtsprobleme in andere Länder ausgelagert haben, weil dort die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür aufbereitet wurden“, mahnt Klaffenböck.
Doch es beginnt noch viel früher: Wenn etwas gekauft wird, soll bereits auf einen möglichst langen Lebenszyklus geachtet und damit auf Qualität geachtet werden. Noch wichtiger sei allerdings, möglichst wenig zu kaufen. Denn „das nachhaltigste Kleidungsstück ist das, das gar nicht produziert wird“, erinnert Klaffenböck.