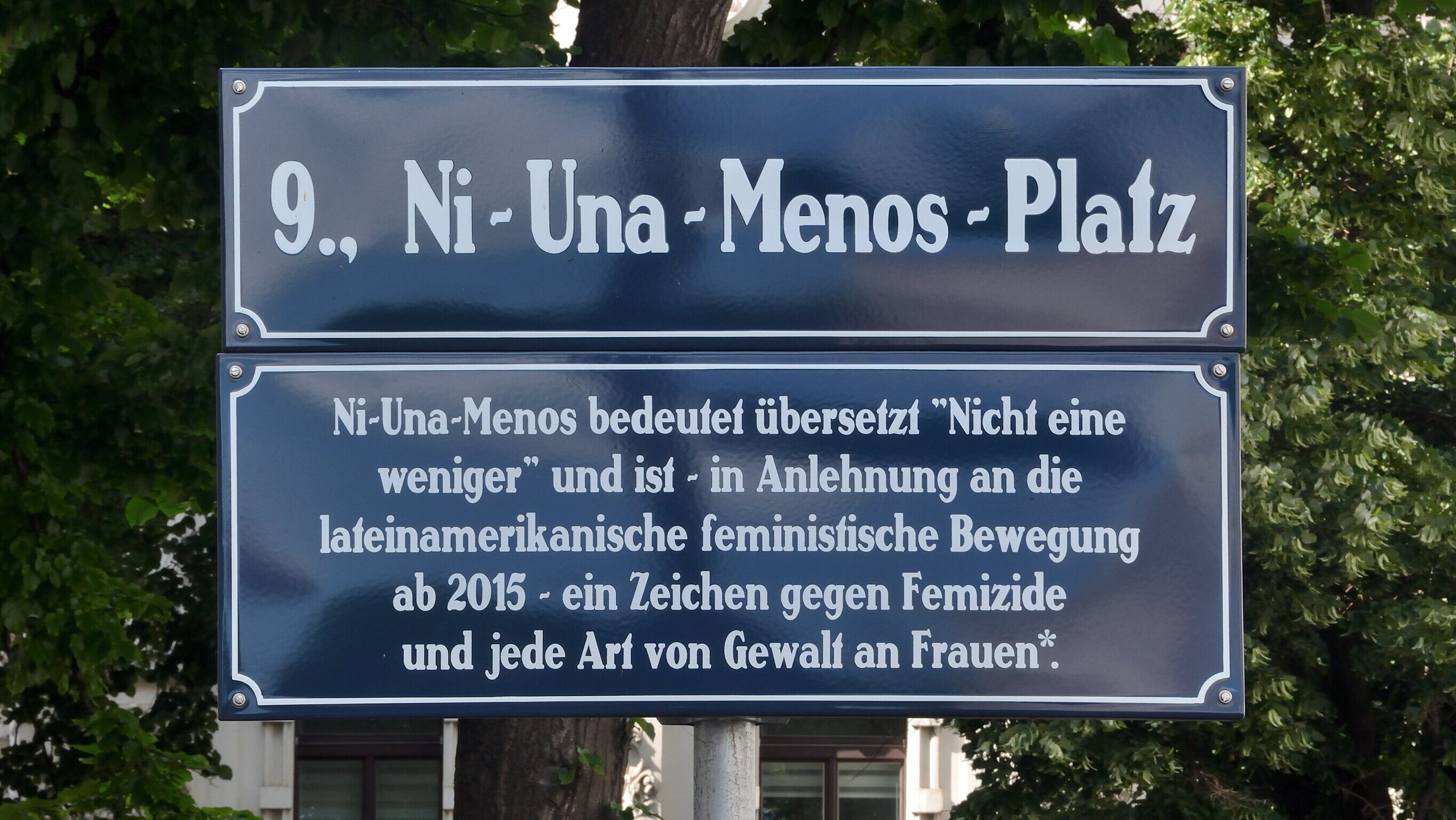Was Schulen jetzt brauchen

#NatsAnalyse: Sollen Schulen schließen? Was brauchen sie, damit sie nicht schließen müssen? Manchmal genügt es, Betroffene zu fragen. Eine Auflistung.
Alle reden über die Schulen. Zwischen "unbedingt offen" und "unbedingt zu" scheint kaum Platz für Zwischentöne. Dabei die "offen/zu"-Debatte ist nur scheinbar eine Grundsatzdebatte. Denn diejenigen, die auf offenen Schulen bestehen, so wie sie sind, sind genau jene, die Schuld sind, wenn die Schulen geschlossen werden. Die "Status quo exakt so aufrechterhalten"-Fraktion schafft die Argumente für die Schulschließungen selber.
Insofern handelt es sich um eine überdrehende und an den Bedürfnissen vorbei gehende Nulldebatte. Die eigentliche Debatte dreht sich darum, was Schulen und alle Menschen, die an Schulen lernen und arbeiten, jetzt brauchen. Manchmal muss man die Leute einfach nur fragen.
Liebe Lehrer_innen, Eltern, Schüler_innen, Administrationskräfte, Schulwarte u Alle,d an Schulen arbeiten. Schreibt mal hier darunter was ihr wirklich braucht abseits der am Thema vorbei gehende Schule offen/geschlossen-Diskussion.Was fehlt? Was braucht ihr? Welche Ideen gibt es?
— Natascha Strobl (@Natascha_Strobl) November 7, 2020
Die Antworten sind klar - und dürfen einander auch widersprechen. Was für eine Oberstufe gilt, geht für die Unterstufe vielleicht nicht. Was am Land möglich ist, ist es in der Stadt vielleicht nicht - und umgekehrt. Es gilt, diese Unterschiede und innere Zerrissenheit auszuhalten und Lösungen und Verbesserungen je nach Gegebenheiten zu finden.
Zu den am häufigst genannten Beiträgen gehören:
Geschlossene Schulen fördern soziale Ungleichheiten, wie hier oder hier gut und eindringlich nachzulesen ist. Schulen sind mehr als bloße Lernstätten, sie sind Orte, an denen Kinder mit anderen Kindern interagieren und wo Kinder zusammenkommen können. Schulen müssen die sozialen Ungleichheiten der Gesellschaft oft abfangen und tun dies auch, sei es durch Schulessen oder auch nur einem ruhigen Ort zum Lernen, den viele Kinder daheim aufgrund einer beengten Wohnsituation schlicht nicht haben.
Schulen dürfen kein Experiment für Durchseuchung sein. Schulen müssen sicher sein. Nur so können sie offen gehalten werden. Eine Gesellschaft, die Kinder und LehrerInnen dazu zwingt, sich zwischen Gesundheit und Bildung zu entscheiden, hat komplett versagt.