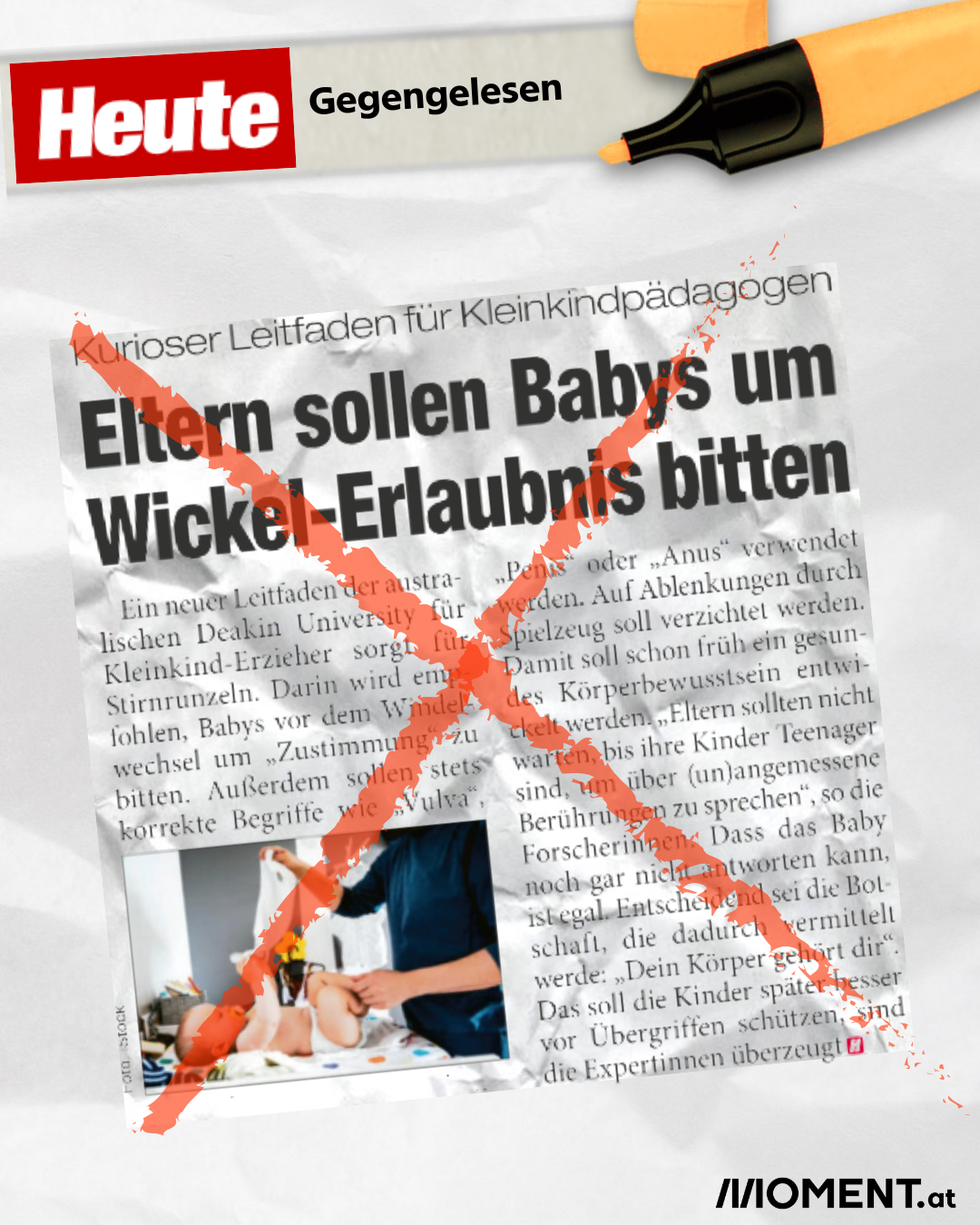Carsharing am Land: Kann das funktionieren?

Karte ans Lesegerät in der Windschutzscheibe oder ein Klick in der App, schon öffnet sich die Türe, und los geht die gemietete Fahrt. Carsharing ist aus den großen Städten kaum wegzudenken. Seien es ShareToo und Free2Move in Wien oder der kommunale Anbieter TIM in Graz und Linz: Die Autos mit dem oft markanten Branding sind ein gewohnter Anblick auf Straßen und reservierten Parkplätzen.
Die Gründe sind leicht zu sehen: Carsharing ist oft günstiger als ein eigenes Auto und eine praktische Ergänzung zu Rad, Fußweg und öffentlichen Verkehrsmitteln. Eine „gmahde Wiesn” quasi. Zumindest in der Stadt, wo die Wege kurz sind und das Öffi-Angebot gut. Aber funktioniert Carsharing auch am Land?
Ja, es gibt Carsharing am Land, …
Wirft man einen Blick auf die Daten, ist die Antwort ein vorsichtiges Ja. Zahlen des Verkehrsclubs VCÖ aus dem Jahr 2022 zufolge kann man sich in etwas mehr als einem Viertel der österreichischen Gemeinden auf die Schnelle ein Auto ausborgen. Auch ein Blick auf die Karte des Dachverbands für Carsharing in Österreich zeigt: Angebote gibt es mittlerweile quer durchs Land. Von Höchst in Vorarlberg bis Neusiedl am See.
Und tatsächlich, bei einem Trip raus aus den urbanen Zentren stößt man auch in kleineren Städten und Gemeinden bereits nach kurzer Suche auf Sharing-Autos. In der steirischen 10.000-Einwohner:innen-Gemeinde Köflach findet sich das vielfarbige TIM-Schild zum Beispiel gleich neben dem Bahnhof. Direkt daneben stehen zwei E-Autos und zwei weitere Ladesäulen bereit. Weniger leicht zu finden, aber dennoch vorhanden, ist das Sharing-Fahrzeug in Malta in Kärnten. Es steht etwas abseits neben dem Gemeindeamt der 1.900-Personen-Gemeinde. Das führt uns auch direkt zum Aber.
… aber nur in bestimmten Gemeinden
In den genannten Zahlen des VCÖ zeigt sich ein klarer Unterschied zwischen Gemeinden mit mehr und weniger als 10.000 Personen. Während 32 Prozent der Orte über dieser Grenze (ohne Wien) Carsharing anbieten, sind es von den kleinen Gemeinden gerade mal acht Prozent.
Was hält kleine Gemeinden am Land davon ab, Carsharing-Angebote einzuführen? Laut Michael Schwendinger vom VCÖ unterscheiden sich die Hürden zwischen Stadt und Land nicht nennenswert: „Der entscheidende Faktor ist in beiden Fällen die Auslastung”, sagt er. Wenn Carsharing-Fahrzeuge wenig genutzt werden, lohnten sie sich für die Anbieter nicht.
Die geringe Auslastung im ländlichen Raum wiederum liegt hat zwei Gründe: zum einen das oft mangelnde Bewusstsein für das Angebot und dessen geringe Sichtbarkeit. Zum anderen die Zersiedlung.
Es muss attraktiv sein
Anna Reichenberger vom Regionalmanagement Steirischer Zentralraum, das die regionale Entwicklung der Gemeinden in den Bezirken Graz, Graz-Umgebung und Voitsberg unterstützt, erklärte 2023 in einem Vortrag bei einer VCÖ-Fachveranstaltung: „Wir dürfen kein Carsharing-Auto hinter ein Gemeindeamt oder einen Innenhof stellen. Innovative Mobilität, vor allem im ländlichen Raum, muss sichtbar sein.” Hier geht es für sie um die Bewusstseinsbildung – und das macht durchaus Sinn, wenn man einen Blick auf unsere Beispiele wirft.
In Köflach stehen die Carsharing-Autos direkt am Bahnhof, gut einsichtig von der Straße aus, mit einem hohen, bunten Schild daneben. In Malta steht ein einzelnes Auto neben dem Gemeindeamt. Noch besser versteckt ist das Fahrzeug in der Kärntner 10.000-Personen-Gemeinde St. Andrä im Lavanttal: in einer Autohandlung. Hier muss man schon wissen, dass es das Angebot überhaupt gibt, wenn man es finden will.
Ein Auto, um zum Auto zu gelangen?
Ein weiterer wichtiger Faktor für die Auslastung ist die Siedlungsdichte: Es bringt nichts, ein Auto an einem Ort anzubieten, wo kaum jemand lebt. Braucht man ein Auto, um ein Auto auszuborgen, führt das das System ad absurdum. Laut Zahlen von TIM Österreich gelangen 82% der Kundschaft entweder zu Fuß oder mit dem Rad zum Auto. Die Zahlen dazu ähneln sich in Gemeinden aller Größenordnungen, ob in Graz oder in Gratwein.
Was der richtige Ort für eine Carsharing-Station ist, variiert je nach Situation. Jede Gemeinde müsse sich im Vorfeld anschauen, welche Bedürfnisse die eigene Bevölkerung hat, sagt Anna Reichenberger in ihrem Vortrag. Erst dadurch könne man herausfinden, ob und wo Carsharing Sinn macht.
Michael Schwendinger sieht hier unter anderem Möglichkeiten im Wohnbau: „Wenn man eine größere Wohnanlage baut, kann man diese so planen, dass dann dort gleich ein Grundangebot an Sharing-Fahrzeugen verfügbar ist. Autos, aber auch Lastenräder zum Beispiel. Für die tägliche Pendelfahrt funktioniert Carsharing nicht, aber als Ersatz für wenig genutzte Zweitautos sehr wohl.”
Weiterdenken
Alternative Anknüpfungspunkte sind der Tourismus und Verbindungen mit dem öffentlichen Verkehr. So wie beim „Rail and Drive”-Angebot der ÖBB mit seinen rund 400 Fahrzeugen in 41 Städten. Der Gedanke dahinter: Man fährt mit dem Zug die lange Distanz und überbrückt mit dem geborgten Fahrzeug die vielzitierte „letzte Meile”. Das kann gerade bei Tages- und Businesstrips und Kurzurlauben eine praktische Hilfe darstellen. Auch hier gilt: Steht das Fahrzeug gleich neben dem Bahnhof, ist es attraktiver.
Das Problem mit der Auslastung lässt sich durch geschickte Zweitnutzung lösen. Zum Beispiel, indem das Carsharing-Auto auch von einem Unternehmen oder der Gemeinde als Dienstauto genutzt wird. In der Gemeinde Aigen-Schlägl im Mühlviertel wird das bereits so betrieben, wie aus einem Video des VCÖ hervorgeht.
Es kann funktionieren
Ob Carsharing funktioniert, hängt also letzten Endes nicht davon ab, wie groß die Gemeinde ist, in der das Fahrzeug steht. Ob Wien, Wels oder Malta: Relevant ist, dass die Fahrzeuge attraktiv für die Bevölkerung werden, die Standorte gut sichtbar sind und, so Anna Reichenberger: „Dass man auf eine gewisse Siedlungsdichte im unmittelbaren Umfeld achtet.”
In anderen Worten: Wo ein Wille und ein guter Plan sind, da ist auch ein Weg.