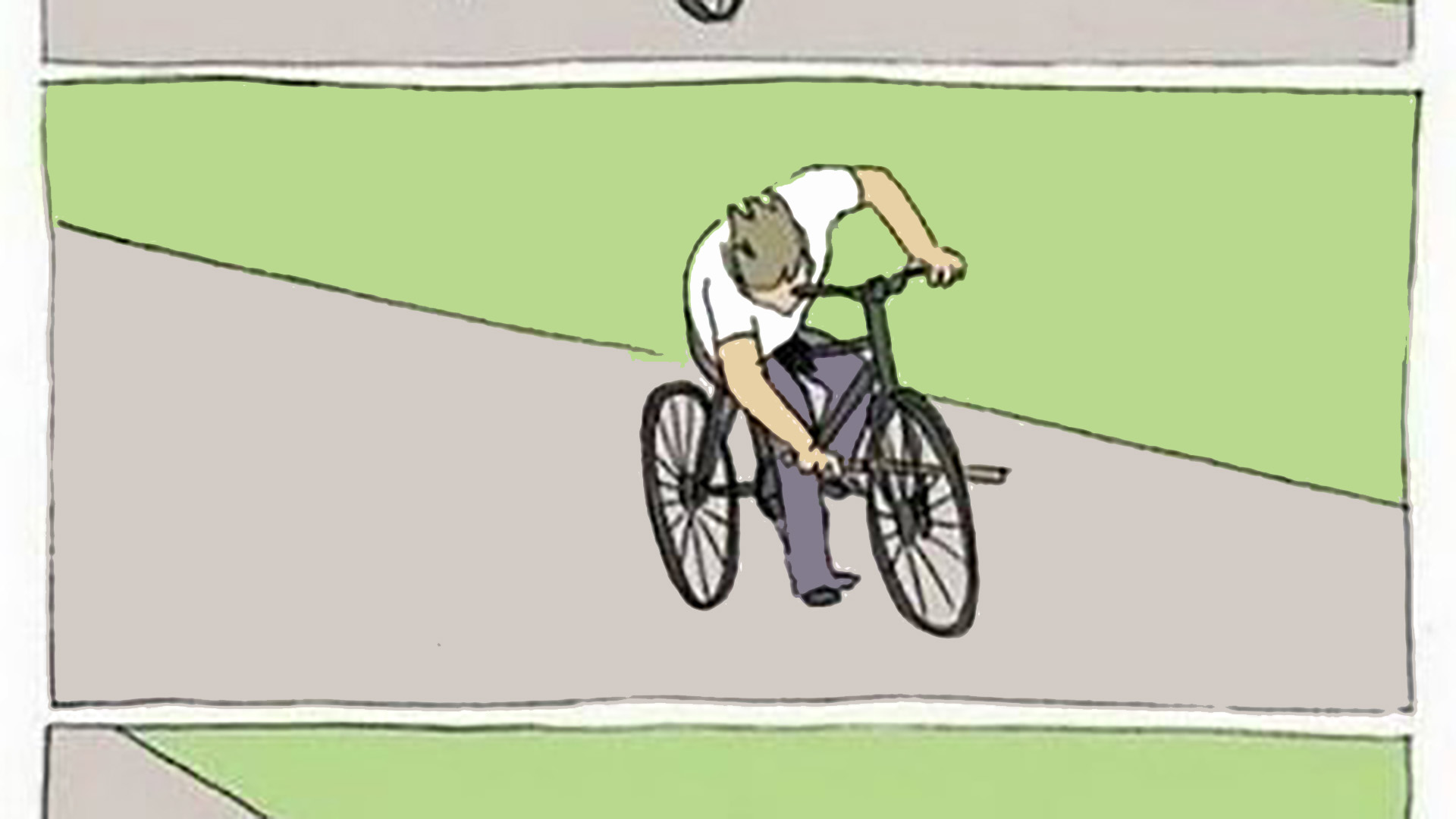Die moderne Verkehrsplanung: Von Männern für Männer

Verkehr ist nicht neutral. Die moderne Verkehrsplanung orientiert sich vor allem an den Bedürfnissen von Männern und ihren Autos. Warum das so ist, woran man das sieht und wie man das ändert?
Wir wären gut beraten, unsere Verkehrsplanung nicht nur an Vollzeit arbeitenden Männern auszurichten. Doch geht es um Autos, scheinen Rollenbilder besonders hartnäckig zu sein.
Eine Straße ist zunächst einmal grau, unspektakulär und fad. Jede:r kann sie benutzen. Eine Straße ist neutral, könnte man meinen. Aber wie sie aussieht, verläuft und finanziert wird, verrät einiges über unser Zusammenleben. Zum Beispiel darüber, wer zuhause den Abwasch macht und warum Frauen zwar weniger Autounfälle bauen, aber dabei häufiger schwer verletzt werden.
Der Reihe nach. Die meisten Städte Europas, auch in Österreich, sind nach einem ähnlichen Muster gebaut: Hauptstraßen verlaufen sternförmig vom Stadtrand Richtung Zentrum. Menschen sollen so möglichst schnell und bequem mit ihrem Pkw vom Wohnort zum Arbeitsplatz und zurück fahren können.
„Du planst für das, was du kennst“
Wobei „Menschen“ in diesem Fall vor allem „Männer“ bedeutet. Die Idee der „autogerechten Stadt“ stammt aus den 1950ern und 1960ern. Die Idee stammt von Männern, die damals fast ausschließlich für die Stadt- und Verkehrsplanung zuständig waren. Und sie wurde für Männer entwickelt, die morgens im eigenen Auto zur Arbeit und abends zurückfuhren. Frauen waren meist für Haus- und Fürsorgearbeit zuständig und kamen in diesen Planungen nicht vor.
„Du planst für das, was du kennst“, fasst Lina Mosshammer, Verkehrsexpertin der Mobilitätsorganisation VCÖ zusammen. Und da Entscheidungen in Sachen Verkehr auch heute noch zumeist von Männern getroffen werden, orientiert sich die Verkehrsplanung auch heute noch vorwiegend an männlichen Lebenswelten.
Frauen legen andere Wege zurück
Doch das Mobilitätsverhalten der beiden Geschlechter unterscheidet sich gravierend. „Die Wege, die Frauen zurücklegen, sind komplexer als die von Männern“, erklärt Sibylla Zech, Professorin für Regionalplanung und Regionalentwicklung an der Technischen Universität Wien. Das hängt unmittelbar mit den Rollenverteilungen in unserer Gesellschaft zusammen. Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit und kümmern sich nach wie vor häufiger um Haushalt, Kinder und (pflegebedürftige) Angehörige.
Statt morgens zur Arbeit und abends (auf einer gut ausgebauten Straße) nach Hause zu fahren, bringen Frauen die Kinder morgens zur Schule. Fahren dann Einkaufen und anschließend zur Apotheke. Nachmittags muss der Sohn zum Klavierunterricht, die Tochter zum Fußballtraining. Und beide wollen anschließend wieder abgeholt werden. Auch die Tante im Spital freut sich über Besuch. All diese Tätigkeiten erledigen in Österreich natürlich nicht nur, aber eben viel öfter Frauen.
Das bedeutet, Männer planen nicht anders, “weil sie Männer sind” oder weil sie Frauen Schaden zufügen wollen, sondern weil ihre Lebensrealität meist eine andere ist. Sie planen nicht aufgrund ihres biologischen Geschlechts anders, sondern weil sie zumeist andere gesellschaftliche Rollen einnehmen.
Das Auto, Symbol der Männlichkeit
Einiges hat sich geändert an den Rollenbildern der 1950er-Jahre. In der Politik sind Frauen mittlerweile zwar immer noch eine Minderheit aber doch eine Selbstverständlichkeit. In Mobilitätsfragen ist das aber immer noch deutlich weniger so als anderswo. In Verkehrsausschüssen muss man nach Frauen mit der Lupe suchen, in den Vorstandsetagen von Automobilkonzernen sowieso. Geht es um Autos, scheinen sich Rollenbilder besonders hartnäckig zu halten. „Entscheidungen in Sachen Mobilität werden nach wie vor überwiegend von Männern ‚im besten Alter‘ getroffen“, beobachtet Zech.
Das ist kein Zufall, vermutet Gabriele Michalitsch, Politikwissenschafterin an der Universität Wien. Das Auto, das große Auto, ist das „Symbol für Männlichkeit schlechthin“. Am Image des Autos arbeitet die Werbeindustrie hart. Sie vermitteln Macht, Stärke, Aggression, Freiheit, Abenteuer, Status, Technikaffinität. Und all das sind Eigenschaften, mit denen sich Männer gerne schmücken.
Der Unterschied zwischen den Geschlechtern zeigt sich auch beim Kauf- und Verkehrsverhalten. Ein Drittel der Männer hierzulande fährt ein Auto mit über 180 PS, aber nur jede achte Frau. Von Jänner bis November dieses Jahres wurden in Österreich von Männern 23.905 SUVs zugelassen, von Frauen 11.586. Von 2010 bis 2020 kamen in Österreich bei Verkehrsunfällen dreimal so viele Männer ums Leben wie Frauen. Das liegt daran, dass sie viel mehr und längere Strecken zurücklegen. Bei Unfällen wegen Trunkenheit am Steuer waren 86 Prozent der Beteiligten männlich.
Mobilität breiter denken
Frauen sind beim Autofahren gemessen an ihrem Anteil an Fahrten aber einem höheren Verletzungsrisiko ausgesetzt. Auch das ist der männlichen Brille geschuldet. Crash-Test-Puppen, mit denen die Sicherheit einzelner Fahrzeugtypen erprobt wird, orientieren sich meist an den Maßen eines „Durchschnitts-Mannes“. Laut der Initiative „Women in Mobility“ ist das Risiko, bei einem Unfall schwer verletzt zu werden für eine Frau um fast die Hälfte höher als für einen Mann. Weil sie eben nicht den Maßen eines „Durchschnitts-Mannes“ entsprechen.
VCÖ-Expertin Mosshammer fordert, bei der Verkehrsplanung die Lebensrealitäten möglichst vieler Menschen mitzudenken. Nicht nur von autofahrenden Männern und Frauen, sondern genau so von kinderwagenschiebenden Eltern, Öffi-fahrenden Jugendlichen, von spielenden Kindern und von spazierengehenden Senior:innen. Die Kernfrage müsse lauten: „Wie können Menschen ihre Mobilitätsbedürfnisse möglichst sicher, komfortabel und nachhaltig erledigen?“.
Auch Zech verweist darauf, dass Mobilität mehr bedeutet, als von A nach B zu gelangen. „Wenn ich einen Supermarkt ans Dorfende baue, dann zieht das automatisch mehr Verkehr nach sich“. Und das wiederum mehr Lärm, Verschmutzung, Gefahren beim Überqueren der Straße. In der Verkehrsplanung müsse man sich ständig fragen: „Wer profitiert von einer Maßnahme, wer wird benachteiligt?“.
„Stadt der 15 Minuten“ und „Supergrätzl“
Als Positivbeispiel nennen beide Paris. Die „Stadt der 15 Minuten“ war eines der zentralen Wahlkampfversprechen der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Erholungsräume, Nahversorger, Ärzt:innen und Schulen sollen für alle Bewohner:innen eines Grätzls innerhalb einer Viertelstunde erreichbar sein – ohne Auto. Viele der Wiener Außenbezirke kommen einem solchen Modell bereits sehr nahe, auch Graz schneidet sehr gut ab. (Auf www.15-minuten-stadt.de kann man sehen, wie nahe der eigene Wohnort dem Ideal einer „Stadt der 15 Minuten“ kommt)
Auch die aus Barcelona stammende Idee der „Superblocks“ zielt darauf ab, die Lebens- und Mobilitätsbedürfnisse aller Bewohner:innen zu berücksichtigen. Im Inneren eines solchen Blocks werden der Durchzugsverkehr unterbunden, Öffis an die Außenkanten verlagert und Fuß- und Radverkehr gefördert. Die Verringerung von Lärm, schlechter Luft und Unfällen soll die Lebensqualität aller Bewohner:innen des Blocks erhöhen. In Anlehnung daran soll Wien-Favoriten in den kommenden Jahren zum „Supergrätzl“ werden[5].
Und am Land?
Eine gendergerechte Verkehrs- und Raumplanung in der Stadt ist das eine – auf dem Land ist die Situation komplizierter. In Städten profitieren Frauen von Investitionen in den öffentlichen Verkehr tendenziell mehr, weil sie ihn viel häufiger nutzen, erklärt Politikwissenschafterin Michalitsch. Prinzipiell kann der Öffi-Ausbau daher auch in ländlichen Gegenden einen Beitrag zur gendergerechten Mobilität leisten.
Erschwert wird dies dadurch, dass sich Ortskerne immer mehr entzerren, Geschäfte des täglichen Bedarfs, wie Nahversorger, Post und Bank aus den Zentren an den Ortsrand verlegt werden. Auch die Distanzen zwischen Wohnort und Arbeitsplatz vergrößern sich beständig. Vielfach gilt die Devise: Ohne Auto geht’s nicht. Was wiederum Investitionen in den Autoverkehr „nahelegt“.
Zusätzlich zum Ausbau des Öffi-Netzes braucht es laut Michalitsch kürzere Arbeitswege und kürzere Wege für die Erledigungen des täglichen Bedarfs. In Sachen Mobilität und Raumplanung müsse die Frage im Zentrum stehen, „was unser körperliches und seelisches Wohlbefinden, unsere sozialen Beziehungen, fördert“.
Umdenken, um an alle zu denken
Eine Straße mag grau, unspektakulär und fad aussehen. Aber wie sie aussieht, verläuft und finanziert wird, verrät einiges über Machtverhältnisse und unser Zusammenleben. Dabei wären wir zukünftig wohl gut beraten, dieses Zusammenleben nicht nur am Vollzeit arbeitenden Mann auszurichten – sondern an der Lebensqualität aller.
Als einen ersten Schritt schlägt Sibylla Zech (mit einem Schmunzeln) einen „Rollentausch“ vor: für einen Tag sollten die männlichen Mitglieder einer Planungsbehörde die typischen Wege von Frauen erledigen – „und dann schauen wir, was anschließend dabei rauskommt!“