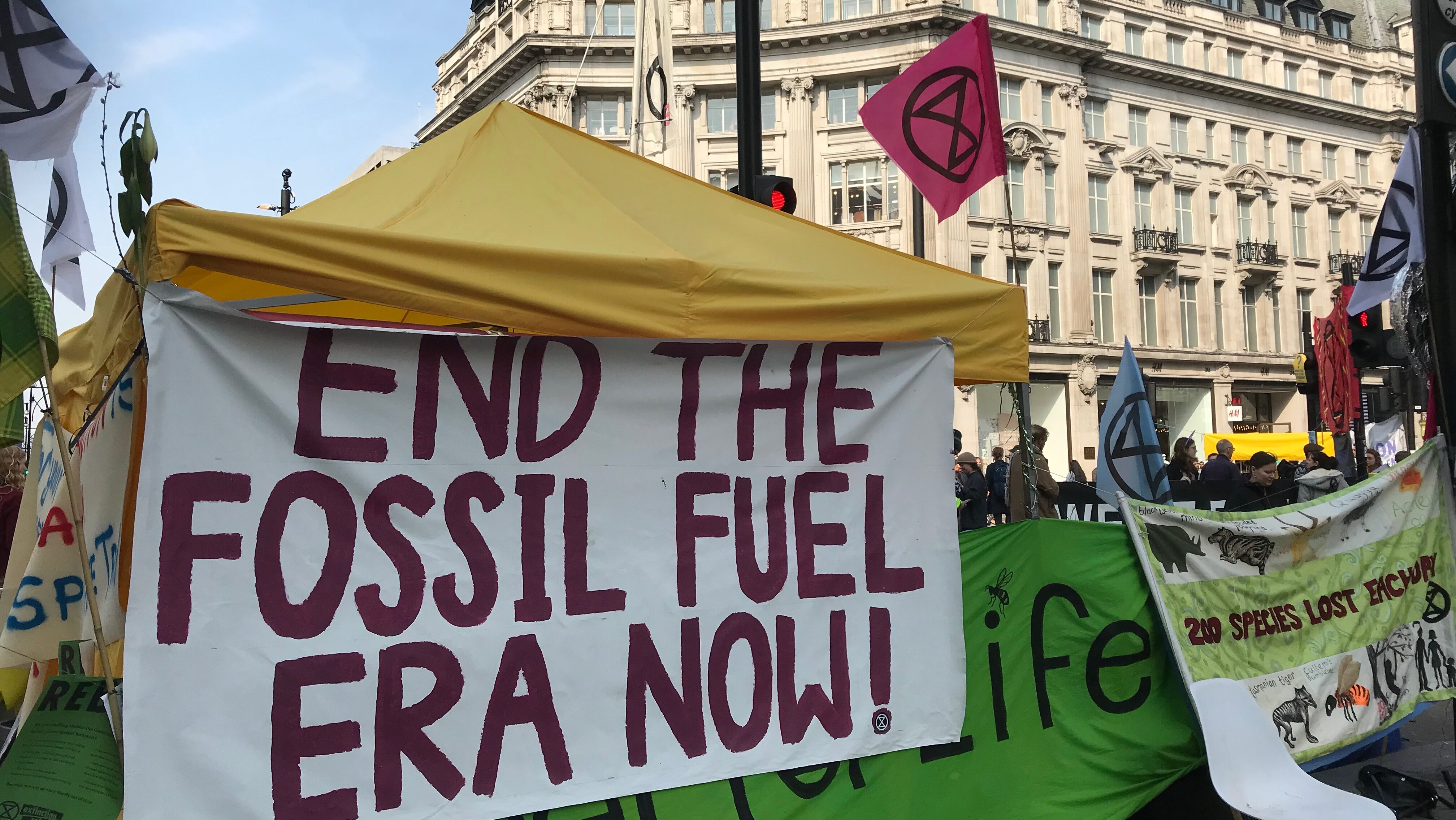Im Bann von Kohle, Öl und Gas: Warum der Ausstieg aus den Fossilen nicht gelingt
Die internationale Staatengemeinschaft hat sich auf der Klimakonferenz in Dubai grundsätzlich auf die Abkehr von fossilen Energieträgern wie Öl, Gas und Kohle geeinigt - wenn auch mit einigen Schlupflöchern für die fossile Industrie. Auch Österreich bekennt sich zum Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden. Aber obwohl der Ausbau erneuerbarer Energien weltweit massiv vorangeht, investieren Unternehmen und Banken weiter in fossile Energieträger wie Öl, Kohle und Gas. Staaten tragen mit Subventionen weiter dazu bei, dass der Ausstieg aus den Fossilen stockt. Wie kann das sein?
Österreich steht im EU-Schnitt relativ gut da, was den Anteil erneuerbarer Energie bei der Stromerzeugung anbelangt. Aber beim Energieverbrauch machen fossile Energieträger wie Öl und Gas noch immer 60 Prozent aus. Den Großteil davon importiert Österreich aus Nicht-EU-Staaten. Zusätzlich zu den Milliarden Euro, die Österreich jedes Jahr für fossile Subventionen ausgibt, fließen für diese Importe jährlich 10 Milliarden Euro ins Ausland. Allein mit dieser Summe könnte Österreich stattdessen das Ziel der Klimaneutralität erreichen.
Fossiler Boom statt Klimawende
Weltweit erschließen laut der NGO urgewald 96 Prozent der Öl- und Gasproduzenten weiter neue Vorkommen. Die meisten Kohleunternehmen haben kein Ausstiegsdatum festgelegt, 40 Prozent planen sogar neue Kohlekraftwerke. Die Investitionsausgaben für die Erschließung neuer fossiler Projekte sind seit 2021 um 30 Prozent gestiegen - obwohl die Internationale Energieagentur (IEA) seit Jahren warnt: Will die Menschheit das Ziel erreichen, die Emissionen bis 2050 zu reduzieren, dürfen keine neuen Öl- oder Gasfelder oder Kohleminen entstehen.
Ein Bericht von Greenpeace zeigt: Keiner der zwölf führenden europäischen Energiekonzerne hat glaubhafte Maßnahmen ergriffen, um sein fossiles Geschäftsmodell umzurüsten. Besonders dreist: die teilstaatliche österreichische OMV. 2022 wendete sie gerade einmal ein Prozent ihrer Gesamtinvestitionen für den Ausbau erneuerbarer Energien auf, die restlichen 99 Prozent investierte sie weiter in fossile Energieträger. Etwa in umstrittene Gasbohrungen im Meeresschutzgebiet Marwah und in die Offshore-Gasplattform „Neptun Deep” im Schwarzen Meer.
Ihr fossiles Geschäftsmodell lässt sich die OMV mit mehreren Milliarden Euro von Investor:innen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA finanzieren. Insgesamt stützen Investor:innen aus aller Welt fossile Unternehmen mit circa 4,3 Billionen US-Dollar. Österreichische Banken wie die Raiffeisenbank und die Erste Bank sind mit hunderten Millionen dabei.
All das zeigt: Klimaversprechen und fossile Realität klaffen nach wie vor auseinander. Doch warum tut die Politik so wenig?
Dass die Abkehr von fossilen Energieträgern so schleppend vorangeht und klimapolitische Vorhaben immer wieder aufgeweicht oder zurückgenommen werden, hat drei Gründe, sagen die Politikwissenschaftler:innen Alina Brad und Etienne Schneider von der Universität Wien. Erstens ein Konflikt mit zentralen staatlichen Strukturen, zweitens die Profitlogik fossiler Konzerne und Banken und deren Lobbyismus, und drittens scheinbar fehlende politische Mehrheiten. Daraus ergeben sich für die Forscher:innen aber auch Ansatzpunkte für eine Transformation hin zu einem gerechteren Wohlstandsmodell, das weitestgehend ohne Kohle, Öl und Gas auskommt.
Fossile Strukturen des Staates
Die Umsetzung ambitionierter Klimaziele bringt den Staat in Konflikt mit einigen seiner zentralen Funktionen, schreiben die Forschenden gemeinsam mit Kolleg:innen in einem aktuellen Forschungsbeitrag in der Fachzeitschrift Nature Climate Change.
Denn die Legitimität von Staaten im Globalen Norden hänge von einer wachsenden Wirtschaft ab. „Dieses Wachstum stützt sich noch immer zu großen Teilen auf fossile Industrien - in Österreich etwa auf die Autoindustrie”, sagt Brad im Gespräch mit MOMENT.at. Durch Steuereinnahmen aus diesen wirtschaftsstarken Sektoren finanziert der Staat soziale Sicherungssysteme und garantiert Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit.
Ambitionierte Klimaziele bringen demnach diese Versprechen ins Wanken. Denn sie erfordern drastische Eingriffe in bestehende Strukturen und die Wirtschaft – Eingriffe, für die der Staat seine eigenen Funktionsweisen und Institutionen grundsätzlich transformieren müsste. „Es gibt sozusagen ein Missverhältnis zwischen ehrgeizigen Zielen und den aktuellen Institutionen des Staates, die eigentlich nicht für die Erreichung dieser Ziele geschaffen beziehungsweise darauf ausgelegt sind“, erklärt Etienne Schneider.
Profitlogik treibt fossilen Backlash
Solche staatlichen Eingriffe sind mehr denn je gefragt. Denn das Geschäft mit den Fossilen lohnt sich nach wie vor - vor allem in Krisen. 2022 verzeichnete die Branche Rekordgewinne. In Österreich machte die OMV 2022 Übergewinne von circa 4 Milliarden Euro. Nur ein Bruchteil wurde abgeschöpft, während vor allem Menschen mit geringem Einkommen nach wie vor unter den hohen Gas- und Strompreisen ächzen.
„Gerade der urgewald-Bericht zeigt, dass es bei der Dekarbonisierung um einen massiven Verlust der Vermögen großer Energiekonzerne geht. Dafür bräuchte es staatliche Kapazitäten, die diesen Vermögensverlust gegen sehr mächtige Interessen durchsetzen können”, sagt der Politikwissenschaftler Etienne Schneider. „In den USA und der EU sehen wir gerade, dass das nicht gelingt. Es steht zu viel Geld, zu viel Profit auf dem Spiel”.
Und auch der Finanzmarkt zieht sich wieder zurück: „Auf Druck von Aktionär:innen verabschieden sich viele Unternehmen von früheren Dekarbonisierungsplänen”, so Schneider. Investitionen in fossile Energien gelten wieder als sicherer und profitabler.
Klimapolitik in der Krise: Wer zahlt den Preis?
Und wie steht es um die politischen Mehrheiten? „Ich würde sagen, dieser Backlash ist weniger getragen von einer breiten gesellschaftlichen Opposition zur Klimapolitik als eher vom Aufstieg der Rechten”, sagt Schneider. In vielen europäischen Ländern gebe es nach wie vor Mehrheiten in der Bevölkerung, die sich für Klimaschutz aussprechen. Trotz des breiten Problembewusstseins befinde sich Klimapolitik in einer Legitimitätskrise. „Das Problem ist, dass bestimmte klimapolitische Maßnahmen als unfair wahrgenommen werden – und das auch sind“, sagt der Politikwissenschaftler. „Vor allem Maßnahmen, die marktliberal auf CO₂-Bepreisung setzen und damit untere Einkommensgruppen viel stärker treffen als obere.“
Ein Beispiel: In manchen Städten dürfen ältere Verbrennerautos nicht mehr in die Innenstadt. Eine Maßnahme, die besonders Menschen mit geringerem Einkommen trifft. „Das ermöglicht es rechten, rechtsextremen oder faschistischen Kräften, dagegen zu mobilisieren und Klimaschutz als ein elitäres, abgehobenes Projekt zu framen“, sagt Schneider.
Die Folge: Aus Angst vor einem weiteren Rechtsruck ziehen sich auch konservative und sozialdemokratische Kräfte aus der Klimapolitik zurück. Bereits beschlossene Maßnahmen werden verwässert oder gestrichen, besonders auf EU-Ebene. „Der Europäische Green Deal wird immer stärker in Frage gestellt und auch in Teilen zurückgebaut”, so Brad. Erst kürzlich polterten Konservative gegen das Ende des Verbrennungsmotors 2035. „Das schafft Planungsunsicherheit für Unternehmen, die bereits Dekarbonisierungs-Strategien entwickelt und in sie investiert haben“, warnt Brad.
Transformation statt Rückschritt: Wie Klimapolitik gelingen kann
Wenn die Klimaziele nicht scheitern sollen, braucht es Investitionen und Planungssicherheit für Unternehmen. Außerdem müssen fossile Abhängigkeiten so weit wie möglich reduziert werden.
Diese Transformation kann beispielsweise in der Umstellung der Produktion beginnen. Ein österreichisches Unternehmen, das früher Teile für Autoscheinwerfer herstellte, produziert heute hochwertige Parfümflaschen. Ein kleiner Schritt, aber ein Symbol für das, was möglich ist, wenn Transformation nicht als Verlust, sondern als Chance zur Neuorientierung verstanden wird.
„Ich glaube, solche Beispiele ließen sich für unterschiedliche Branchen durchspielen und entwickeln“, sagt Alina Brad. Auch für große Industrie-Konzerne wie die OMV oder die Voestalpine stellt sich die Frage: Was könnten sie produzieren, wenn fossile Geschäftsmodelle langfristig unrentabel oder klimapolitisch nicht mehr tragbar sind?
Der Ausstieg aus fossilen Energieträgern bedeutet in letzter Konsequenz, ganze Industrien und Wertschöpfungsketten umzubauen, in denen zehntausende Jobs direkt oder indirekt von den Fossilen abhängen. Etwa die Automobil- und ihre Zulieferindustrie.
Dem Staat fehlten aber „die klimapolitischen Instrumente, um diese Konflikte aufzufangen und gleichzeitig ein anderes Wohlstandsmodell zu schaffen“, sagt Etienne Schneider.
Für Brad und Schneider muss die Transformation deshalb viel tiefer reichen. „Es braucht eine Ökonomie und eine Industriepolitik, die viel stärker an der Grundversorgung ausgerichtet ist und diese so günstig und klimafreundlich wie möglich bereitstellt“, sagt Schneider.
Die Idee: Statt auf Marktmechanismen und individuelle Verantwortung zu setzen, brauche es Investitionen in öffentliche Infrastrukturen wie öffentlichen Verkehr, erneuerbare Energie und Fernwärme, die den Wandel tragen. Dazu gehöre auch „eine Demokratisierung öffentlicher Infrastrukturen, abseits der Profitlogik“, ergänzt Alina Brad.
Ein Beispiel dafür ist das häufig übersehene Potential der österreichischen Bahnindustrie. Eine Studie der Arbeiterkammer zeigt, dass Österreich zu Europas wichtigstem Bahnproduzenten aufsteigen könnte. Der massive Ausbau der Schiene könnte nicht nur bezahlbare und klimafreundliche Mobilität für alle bereitstellen, sondern auch über 230.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Eine sinnvolle Strategie, findet Etienne Schneider: „So könnte man den Ausstieg aus fossilen Energieträgern forcieren, gleichzeitig neue Arbeitsplätze schaffen und damit auch Unsicherheiten und Ängste in der Gesellschaft auffangen, die sonst von rechten Kräften bespielt werden."
Hoffnung in Sicht?
Aufstieg der Rechten, Sparpolitik, fossiler Backlash - trotzdem gibt es für Brad und Schneider Anlass zur Hoffnung. „Man darf nicht vergessen, dass beispielsweise China den Ausbau der erneuerbaren Energien und auch die Elektromobilität massiv vorantreibt”, sagt Brad.
„Auch innerhalb des Kapitalismus gibt es starke Interessen, die für Klimapolitik sind”, ergänzt Schneider. „Nicht zuletzt, weil große Vermögenswerte durch Extremwetterereignisse bedroht sind. Und je stärker die Klimakrise als grundlegende Bedrohung spürbar wird, desto mehr wird auch wieder um stärkere Klimapolitik gerungen.“