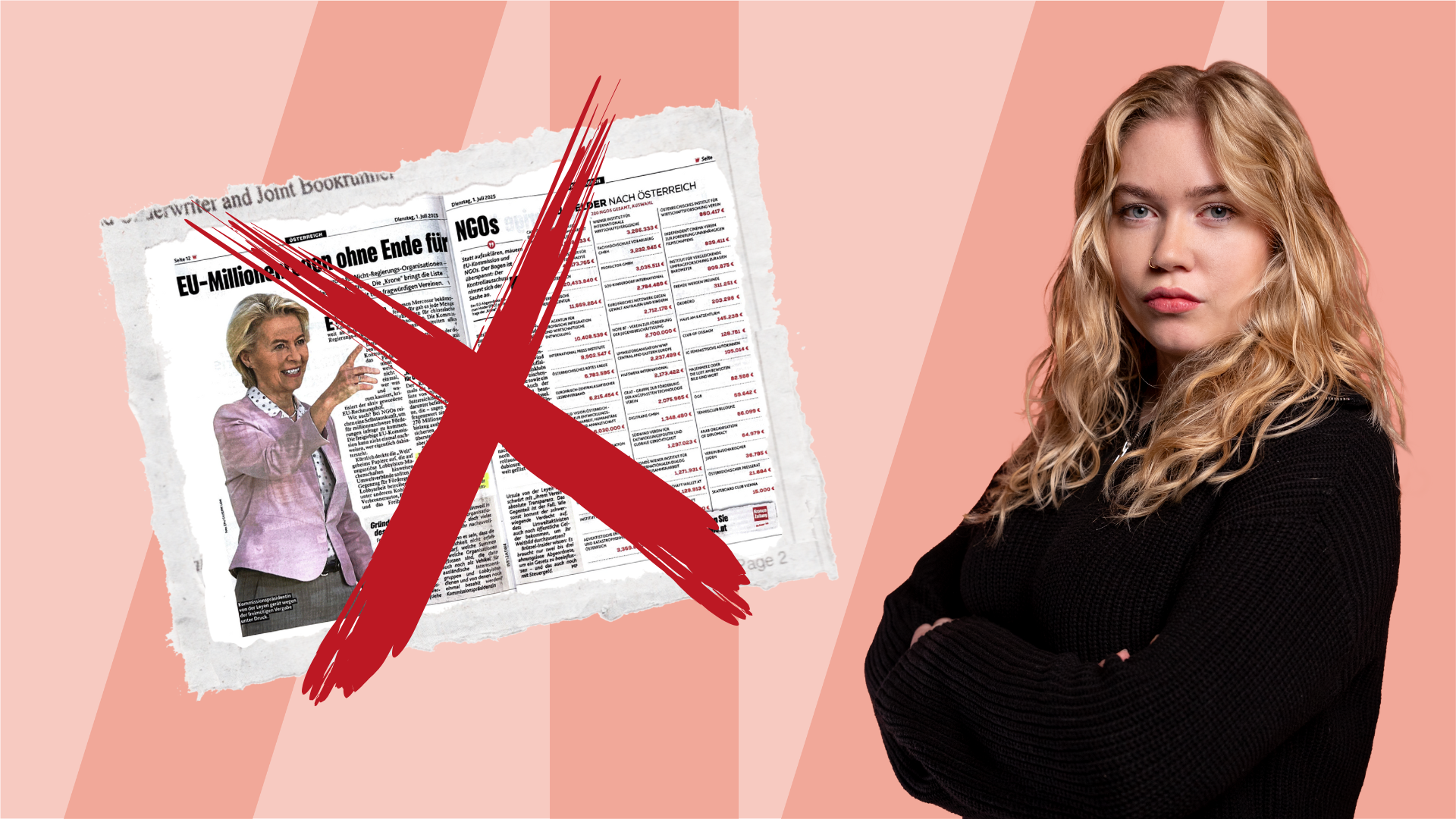Ökonomin Springler: "Jetzt ist die Zeit das System zu ändern"

Der Staat könnte gezielt die Kleinen entlasten und Hilfen für Große an Bedingungen knüpfen. Damit es am Ende nicht wieder heißt, die Verluste werden verstaatlicht, die Gewinne aber privat eingestrichen. Jetzt sei genau der richtige Zeitpunkt dafür, unser Wirtschaftssystem zu ändern, so Springler. „Wenn wir business as usual machen, haben wir bald die nächste Krise.“
MOMENT: Die ökonomischen Folgen der Corona-Krise werden uns noch lange beschäftigen: Wie lange wird die Krise zu spüren und wie tief wird der Einschnitt?
Elisabeth Springler: Es ist schwer zeitlich einzuschätzen. Keiner kann sagen, ob es 10 Monate sein werden, zwei Jahre oder mehr. Es wird sich auf einzelne Branchen unterschiedlich lang auswirken. Auf dem Arbeitsmarkt können wir zum einen davon ausgehen, dass die Corona-Krise sich auf die unteren Einkommensgruppen stärker auswirkt. Vor allem wird die soziale Spreizung stärker. Wenn wir schauen, was die Krise für die Auszubildenden bedeutet und die Jugendarbeitslosigkeit, wird das auch lange dauern. Es gibt Befürchtungen, dass es eine verlorene Generation geben wird, die jetzt aus dem Arbeitsmarkt rausfällt oder sich schwertut überhaupt hineinzufinden. Es könnte sein, dass sie in fünf Jahren noch hinterherhinken.
MOMENT: Schätzungen erwarten bereits im nächsten Jahr einen Anstieg des Wirtschaftsleistung, der die Verluste dieses Jahres schon beinahe ausgleichen könnte. Das wäre eine Erholung in nicht sehr langer Zeit?
Springler: Ich gehe nicht davon aus, dass wir einen so steilen Nachholeffekt haben werden. Wir werden nicht in der ersten Hälfte des nächsten Jahres schon wieder aufholen, was wir jetzt verloren haben. Denn auf struktureller Ebene werden wir sehr viele Effekte erst später sehen. Diesen Rebound-Effekt, von dem viele sprechen, wird es nicht geben.
Es braucht Programme für Kleinunternehmen: Sie bei den Mieten unterstützen und ihnen Sozialbeiträge nicht nur zu stunden, sondern zu erlassen.
MOMENT: Sie sagen, die soziale Spreizung könne weiter zunehmen. Heißt das, Ungleichheit und auch Marktkonzentration könnten zunehmen, da kleine Unternehmen viel eher scheitern als große?
Springler: Es wird auf jeden Fall weitere Konzentrationstendenzen geben. Das sieht man jetzt schon, wenn es darum geht, Hilfen in Anspruch zu nehmen. Die Ein-Personen-Unternehmen und kleinen Firmen tun sich einerseits schwer, die notwendigen Voraussetzungen zu erbringen. Und andererseits, die benötigten Fördergelder nachdrücklich einzufordern, weil sie gar nicht die Kapazitäten dafür haben.
Größere Betriebe können vielleicht ganze Abteilungen abstellen, die sich darum kümmern und tun sich dadurch leichter. Ich halte es für wahrscheinlich, dass die Kluft innerhalb der Unternehmenslandschaft noch einmal breiter wird: Hin zu denen, die jetzt wachsen können und zulasten derjenigen, die auf der Strecke bleiben.
MOMENT: Das Unternehmen unterstützt werden müssen, die vielen Menschen Arbeitsplätze bieten, ist klar. Wie kann gewährleistet werden, dass die kleinen Unternehmen und diejenigen, die jetzt arbeitslos geworden sind, eben nicht auf der Strecke bleiben?
Springler: Indem man nicht nur mit einem Programm quasi mit der Gießkanne staatliche Garantien abgibt. Mit zusätzlichen Krediten und Garantien aushelfen zu wollen, würde wieder eher denen zugutekommen, die bereits eine gute Bonität haben. Es braucht gezielte Programme für EPUs und Kleinunternehmen. Es ist nicht sinnvoll für die, sich weiter zu verschulden.
Da muss man sich etwas anderes überlegen: Sie bei den anfallenden Mieten zu unterstützen oder ihnen die Sozialversicherungsbeiträge nicht nur zu stunden, sondern zu erlassen. Sonst verschieben wir diese Welle nur. Dann werden vielleicht im dritten Quartal dieses Jahres nicht so viele Betriebe verschwinden, dafür im vierten Quartal und im folgenden Jahr.
MOMENT: In der der Corona-Krise scheinen Politik und Wirtschaft auf links gedreht: Unternehmen, die sich zuvor jegliche staatliche Einflussnahme verbeten haben, fordern jetzt Staatshilfen ein, und das nicht immer nur freundlich. Ist das noch logisch?
Springler: Ja klar! Es ist logisch zu sagen, ich würde gerne eine Förderung erhalten aber im zweiten Satz anzufügen: Aber selbstverständlich darf niemand in mein Management eingreifen. Aus liberaler Sicht ist das vollkommen nachvollziehbar. Mit dieser Art von Staatshilfe verstaatliche ich meine Verluste, aber privatisiere weiterhin meine Gewinne.
Auch unter dem Credo, dass ja der Standort gesichert werden soll, fordern Unternehmen staatliche Hilfen ein. Aber ohne den Zusatz, dass es in besseren Zeiten einen stärkeren Einfluss auf das Management oder veränderte Rahmenbedingungen gibt.
Der Staat muss stärker eingreifen, um negative Verteilungseffekte zu minimieren.
MOMENT: Das ist für die Staaten ja nun nicht sonderlich lukrativ. Warum sagen die nicht klar, wir setzen Bedingungen für Staatshilfen, wir übernehmen vielleicht sogar Anteile, denn die Unternehmen bekommen ja auch etwas dafür?
Springler: Es kommt sehr darauf an, wie der fiskalpolitische Anspruch der einzelnen Staaten ist. Einen kurzen Eingriff zu setzen oder große Unternehmen zu unterstützen, um meine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und den Standort zu sichern, entspricht auch dem, was davor schon gemacht wurde. Bei der Übernahme der AUA durch die Lufthansa zum Beispiel hatte Österreich für die Unterstützung auch die Zusage gefordert, den Standort Wien zu erhalten.
Die Diskussion jetzt entspricht dem gleichen Pfad wie vorher. Es hat sich am wirtschaftspolitischen Kurs nichts geändert. Wir wissen, dass in der Krise etwas getan werden muss. Aber die Frage nach dem Modus der Maßnahmen ist eigentlich noch nicht ausdiskutiert. Noch immer fungiert der Staat eigentlich nur als Backup. Das ist, was ich nicht als zukunftsfähig sehe. Der Staat muss stärker eingreifen, um negative Verteilungseffekte zu minimieren.
MOMENT: Wie könnte der Staat sinnvoll eingreifen, damit er und wir alle am Ende auch profitiert, wenn es wieder besser läuft, und eben nicht nur Unternehmenseigner?
Springler: Er sollte natürlich profitieren. Am einfachsten profitiert er bei den Haushalten. Wenn deren Einkommen wieder steigen, steigt auch der Konsum und davon profitiert auch der Staat. Der Staat profitiert aber nicht von großen Unternehmen, die ihre Gewinne in multinationalen Konzernen woanders versteuern oder Strukturen schaffen, die Steueroasen gleichen.
Es ist auch zu fragen, wie viele Dividenden ausgeschüttet werden sollten, wenn gleichzeitig staatliche Hilfen gewährt werden. Hilfen, die dann nicht an Haushalte und kleinere Unternehmen fließen, die alle die genannten Optionen nicht haben.
MOMENT: Soll man jetzt also großen Unternehmen Hilfen verweigern, wenn sie weiter Dividenden ausschütten?
Springler: Hilfen für große Unternehmen sind nicht zu vernachlässigen, die braucht es. Die Frage ist nur wie. Wenn man ihnen staatliche Garantien und Finanzierung gibt, muss man einen Rahmen schaffen, der verhindert, dass diese Zuschüsse in Form von Dividenden oder Ähnlichem wieder abfließen. Die Rückflüsse dieser Hilfen sollten dahin kommen, wo geleistet worden sind, und nicht ins Ausland oder an Kapitaleigner gehen.
MOMENT: Diese Krise hat Schwächen unseres Wirtschaftssystems aufgezeigt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte an, in Zukunft essenzielle Lebensbereiche wie die Gesundheit nicht mehr Marktmechanismen unterordnen zu wollen. Wird sich die öffentliche Daseinsvorsorge jetzt wandeln?
Springler: Es gibt eine Chance, weil das Thema jetzt zumindest einmal im breiteren öffentlichen Fokus gelandet ist. In den vergangenen 30 Jahren war das Credo immer: Der Staat soll bei der Gesundheitsvorsorge, aber auch bei Wasser oder der Müllabfuhr, immer nur als letzte Sicherung fungieren. Ansonsten soll möglichst privatisiert werden.
Aber ein privatisiertes Unternehmen setzt sich nicht als oberstes Ziel, eine möglichst gleiche und günstige Versorgung für alle zu erbringen. Sondern es agiert marktwirtschaftlich. Seit es die Tendenz zu Privatisierungen gibt, gibt es auch die Gegenforderung. Nämlich die Bereiche, die essenziell dafür sind, dass Menschen ein gutes Leben führen können, von Marktmechanismen auszuklammern. Diese Option haben wir jetzt.
Diejenigen, die Kapitaleigner sind und selbst in einer Krise mitprofitieren, werden einen Wandel in der Wirtschaftspolitik nicht unterstützen. Das ist klar.
MOMENT: Auch in der Finanzkrise wurde von politischer Seite viel versprochen, damit sich Exzesse auf den Finanzmärkten, die in die damalige Krise führten, nicht wiederholen. Als die Krise vorbei war, blieb von diesen Worten nicht mehr viel. Ist das auch diesmal zu befürchten?
Springler: Das ist sehr wohl zu befürchten. Nämlich dann, wenn diese institutionellen und vor allem strukturellen Probleme nicht angegangen werden, sondern mit den schon vorher genutzten Hilfsmaßnahmen zugeschüttet werden. Es bietet sich aber an, einen stärkeren institutionellen Rahmen zu geben. Der führt dann dazu, dass ich in einer Boomphase vielleicht nicht so hohe Gewinne einfahren kann. Aber die Zyklen der Konjunktur glätten sich etwas.
Es ist vielfach mit Studien belegt: Innerhalb der Krise verschwindet nicht die Anfälligkeit für weitere Krisen. Jetzt erleben wir mit der Coronavirus-Pandemie einen exogenen Schock. Es kann aber auch wieder eine Blase innerhalb der Wirtschaft entstehen, die dann platzt. Diejenigen, die jetzt sehr stark profitieren von konjunkturellen Aufschwüngen, die Kapitaleigner sind und selbst in einer Krise mitprofitieren, werden einen solchen Wandel in der Wirtschaftspolitik nicht unterstützen. Das ist klar.
MOMENT: Warum soll gerade jetzt ein guter Zeitpunkt dafür sein, einen solch grundlegenen Wandel umzusetzen? Jetzt geht es doch vor allem darum, die Wirtschaft überhaupt zu retten und Wachstum anzuregen?
Springler: Es ist genau der richtige Zeitpunkt, unser Wirtschaftssystem zu ändern. Denn wenn wir die Wirtschaft retten wollen, müssen wir das nachhaltig gestalten. Es geht jetzt nicht darum, Maßnahmen zu setzen, um weiteres Wachstum zu verhindern. Im Gegenteil: Es soll eine Entwicklung geben. Aber sie soll maßvoll und vor allem beständig laufen. Auf der einen Seite ressourcenschonend, also ökologisch nachhaltig. Aber auch ökonomisch nachhaltig.
Das heißt, ohne Konjunkturzyklen, die in starke Hochs und Tiefs ausarten. Bisher haben wir das immer wieder verschoben. Aber jetzt sehen wir: Es geht nicht so weiter wie bisher. Denn wir sehen, dass jederzeit exogene Schocks auf uns zukommen können. Wir wissen auch nicht, woher der nächste Schock kommt. Das heißt, wir müssen gewappnet sein. Das bestehende System hat sich als sehr zerbrechlich erwiesen – für einzelne Gruppen der Gesellschaft wie auch für die Strukturen zwischen den Unternehmen.
Jede neue Krise hat die soziale Spreizung und die Ungleichheit immer größer werden lassen. Jetzt wäre die Chance zu sagen: Wir wollen keine weiter wachsende soziale Ungleichheit! Wir wollen nicht, dass einige auf Kosten von vielen leben.
Die Frage ist: Wie können wir unsere Wirtschaft so formen, dass wir in Zukunft zufriedener sind?
MOMENT: Was antworten Sie denjenigen, die sagen: Wenn die Krise erstmal vorbei ist, werden wir doch wieder business as usual betreiben?
Springler: Wenn wir business as usual machen, wird es dazu führen, dass wir in naher Zukunft die nächste Krise haben – auch als Reaktion auf Maßnahmen, die gesetzt werden, um die jetzige Krise zu bekämpfen. Es kann kein business as usual geben, weil die Störung im System schon da ist. Die Frage ist: Wie können wir die Struktur unserer Wirtschaft so formen, dass wir in Zukunft zufriedener sind als jetzt?
Wollen wir alle Klein- und Mittelbetriebe eingehen lassen? Wollen wir noch mehr Marktkonzentration? Wollen wir eine immer stärkere Ungleichheit? Wenn wir sagen: Ja, das ist uns alles egal und vielleicht gehöre ich ja zu den Gewinnern, dann werden wir die sein, die für ein business as usual eintreten und in der Vergangenheit dafür eingetreten sind.
Wenn wir uns aber vor Augen führen, dass der Großteil der Bevölkerung nicht zu den Gewinnern gehören wird, sondern nur einige wenige, dann ist es klar: Es ist in unser aller Sinne für eine strukturelle Veränderung einzutreten.
Zur Person: Elisabeth Springler ist Studiengangsleiterin an der FH des bfi Wien für den Studiengang Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung. Davor forschte sie unter anderem an der Wirtschaftsuniversität Wien und in der volkswirtschaftlichen Analyseabteilung der Österreichischen Nationalbank. Sie ist daneben Mitglied im Österreichischen Fiskalrat und im Finanzmarktstabilitätsgremium.