"Noch lange keine Lipizzaner": Kein Wahlrecht, wegen Schuhen vor der Wohnungstür?

„Wenn eine Katze in der Hofreitschule Junge wirft, sind das noch lange keine Lipizzaner": Dieser User-Kommentar in einem Online-Forum hat Olga Kosanović zu ihrem Film „Noch lange keine Lipizzaner" inspiriert. Die Filmemacherin, Jahrgang 1995, ist in Wien geboren und aufgewachsen, aber ihr Antrag auf Staatsbürgerschaft wurde abgelehnt. In ihrem Film untersucht sie ausgehend von ihrem eigenen Fall Österreichs restriktives Einbürgerungsrecht (weltweit sind nur Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate noch strenger) und spannt den Bogen zu Fragen von Identität und Wir-Gefühl. Der Film, eine Mischung aus dokumentarischen und fiktionalen Szenen, Interviews und Animationen, läuft ab 12. September in den Kinos.
MOMENT.at: Frau Kosanović, wie steht es um Ihren Einbürgerungsantrag? Sind Sie mittlerweile Österreicherin?
Olga Kosanović: Zugesicherte Österreicherin. Ich habe einen Wisch, dass sie mir die österreichische Staatsbürgerschaft verleihen werden, sofern ich innerhalb von zwei Jahren aus der serbischen austrete – was natürlich auch Bürokratie mit sich bringt – und weiterhin alle Kriterien erfülle. So richtig entspannt bin ich aber erst, wenn ich die Staatsbürgerschaft wirklich habe. Die MA 35, die in Wien für Staatsbürgerschaften zuständig ist, schaut wohl am Tag der Verleihung noch einmal ins Strafregister – und wenn man in der Zwischenzeit irgendwelche Verwaltungsstrafen bekommen hat, wird einem die Staatsbürgerschaft doch verweigert, und man ist staatenlos. Wir wohnen im Dachgeschoss und hatten die Schuhe vor der Tür stehen. Vor kurzem war der Brandschutzbeauftragte da und hat gesagt, wir müssen das wegräumen, sonst gibt's eine Verwaltungsstrafe. Na gut, der kommt nur einmal im Jahr - aber das Risiko ist für mich groß.
MOMENT.at: Die Sache mit den Verwaltungsstrafen habe ich erst aus Ihrem Film gelernt: Die Einbürgerung kann abgelehnt werden, weil man mal eine Strafe wegen Falschparkens hatte oder bei Rot über die Straße gegangen ist. Ist das nur theoretisch möglich, oder passiert das wirklich?
Kosanović: Wenn man das einmal macht, wertet es die Behörde wahrscheinlich nicht als so schlimm. Aber es hängt davon ab, wer da sitzt. Und beim zweiten Mal ist man ein Wiederholungstäter. Parkstrafen detto, oder geblitzt werden. So etwas beeinträchtigt den Alltag: wenn ich in einer Gruppe unterwegs bin und alle gehen bei einer kleinen Straße über Rot, dann zahlen die anderen im schlimmsten Fall 50 Euro. Bei mir geht es um viel mehr. Diese Hürde will die Politik immerhin senken, weil sie endlich draufgekommen sind, dass damit ganze Berufsgruppen ausgeschlossen sind, Taxi- oder LKW-Fahrer:innen zum Beispiel.
MOMENT.at: Im Film kam auch ein Mann vor, dem eine Firma gehört …
Kosanović: Völlig absurd. Er ist Inhaber einer Installateursfirma mit 17 Mitarbeitenden. Er hat erzählt, eine Leiter auf einem der Firmenfahrzeuge war nicht ordnungsgemäß montiert, dafür gab es eine Verwaltungsstrafe – und die wurde ihm in der Einbürgerung zum Verhängnis. Am Ende hat er es geschafft, aber es war ein irrer Weg. Da macht es sich der Staat auch vom Aufwand für die Behörden her unnötig kompliziert.

MOMENT.at: Laut Ihrem Film kann man auch abgelehnt werden kann, weil der Expartner, die Mitbewohnerin oder die Eltern mal Sozialhilfe bezogen haben. Passiert das wirklich?
Kosanović: Ja. Zum Beispiel bei einem 16-Jährigen, der nicht eingebürgert werden konnte, weil seine Eltern Wohnbeihilfe bekommen haben – da ging es um Beträge von 30 Euro. Viele Menschen mit Fluchterfahrung werden in den ersten Jahren immer wieder von Heimen zu WGs zu Wohnungen weitergereicht. Für die Einbürgerung werden dann rückwirkend all diese Meldeadressen angeschaut: wer hat da noch gewohnt, und hat jemand davon womöglich Sozialhilfe erhalten? Ich selbst war auch in so einer Situation: Vor sechs Jahren hat mein Partner noch mit seiner Ex-Frau zusammengewohnt – und mein Anwalt sagt, diese Frau ist tatsächlich für meinen Antrag relevant.
MOMENT.at: Wenn die Ex-Frau Ihres Partners vor sechs Jahren Sozialhilfe bezogen hätte, ...
Kosanović: ... hätte womöglich er davon profitiert, und das könnte bedeuten, dass ich auch davon profitiere. Aus der Frage, wie man diese Absurdität erzählen könnte, ist die fiktionale Szene im Autokino entstanden. Ich will ja auch als Behördenmitarbeiterin nicht jemanden so etwas fragen müssen!
MOMENT.at: Haben Sie mit Behördenmitarbeiter:innen gesprochen?
Kosanović: Wir durften bei der MA35 Einbürgerungen, Erstinformationsveranstaltungen und meinen Antrag drehen. Aber zu Interviews war niemand bereit. Im Film geht es aber auch nicht darum, die Behörde an den Pranger zu stellen – da gibt es viele Probleme, aber das ist ein eigenes Thema. Meine Ablehnung war ja total gesetzeskonform. Ich habe mit Mitarbeiter:innen gesprochen, die anonym bleiben wollten – die werden da reingeworfen, müssen sich irre schnell in unglaublich komplizierte Gesetze einarbeiten, haben dann sofort 20 Akten auf dem Tisch und kommen nicht hinterher.
„Verlassen Sie das Land möglichst nicht“ - was ist das für eine Ansage gegenüber einer 25-Jährigen?
MOMENT.at: Sie sind in Österreich geboren und aufgewachsen, aber Ihre Einbürgerung wurde abgelehnt, weil Sie 58 Tage zu viel im Ausland waren, Maturareise eingerechnet. Wie kann das sein?
Kosanović: Ich habe in Deutschland studiert. Dafür habe ich sogar ein österreichisches Mobilitätsstipendium bekommen. Dann bin zurückgekommen, wollte den Antrag stellen, und es hieß: „Das wird schwierig. Gleich nach der Matura wäre es gegangen, aber jetzt ...“ Nach der Ablehnung hat die Beamtin zu mir gesagt: „Probieren Sie es einfach in ein paar Jahren wieder, aber verlassen Sie bis dahin das Land möglichst nicht“. Was ist das für eine Ansage gegenüber einer 25-Jährigen?
MOMENT.at: Wie kam die Behörde auf die 58 Tage?
Kosanović: Es gab eine Anhörung. Ich wusste nicht, worum es geht, hatte damals auch keinen Anwalt und bin mit meinem Partner hin. Sie haben zum Beispiel gefragt, wo ich im Sommer 2005 war. Ich habe gesagt, da war ich zehn Jahre alt. „Können Sie vielleicht Ihre Eltern anrufen?“ „Nein, kann ich nicht. Ich weiß nicht, wo ich da war. Wahrscheinlich in Serbien.“ „Aha, und wie lange?“ Dann habe ich halt irgendwas gesagt. Die 58 Tage sind also auch ein bisschen beliebig. Irgendwann sagt mein Freund: „Wir waren ja auch letztes Jahr in Italien.“ „Ah, in Italien! Wie lange?“ „Drei Tage“. Dann wurde ich entlassen und hatte keine Ahnung, was da passiert ist. Und irgendwann kam dieser elf Seiten lange Brief, der eine Tabelle mit den Auslandsaufenthalten beinhaltet hat.
MOMENT.at: Was ist die Regelung dahinter?
Kosanovic: Man darf 20 Prozent des Betrachtungszeitraums im Ausland gewesen sein. Das ist sich bei mir knapp nicht ausgegangen. Auch das schließt übrigens ganze Berufsgruppen aus, Reiseleiter:innen und andere Leute, die beruflich viel im Ausland sind.

MOMENT.at: Sollte es aus Ihrer Sicht gar keine solche Regelung geben?
Kosanović: Ich würde die Schwelle anders setzen. Dass man eine bestimmte Zeit hier sein muss, macht Sinn. Das Pendant sind ja die 600.000 Auslandsösterreicher:innen, die teilweise seit Generationen im Ausland leben und die Staatsbürgerschaft ewig weiter vererben. Da gibt es Menschen, die haben noch keinen einzigen Tag in Österreich gelebt, sind Österreicher:innen, haben das Wahlrecht. Das vergisst man immer, da gibt es keine so starken Gefühle dazu. Deren Lobby setzt sich auch für die Doppelstaatsbürgerschaft ein, weil diese Menschen keine Lust haben, die österreichische zurückzugeben. Da gibt es in Österreich plötzlich ein großes Verständnis für den Wunsch nach Doppelstaatsbürgerschaft, der in der umgekehrten Situation gleich als Loyalitätskonflikt dargestellt wird.
MOMENT.at: Wann und warum haben Sie eigentlich beschlossen, die Staatsbürgerschaft zu beantragen?
Kosanovic: Es war immer klar, dass ich das irgendwann in Angriff nehme. In erster Linie wegen des Wahlrechts. Aber ich wollte volljährig sein und mein eigenes Einkommen haben, damit nur ich angeschaut werde. Wenn man unter 18 oder noch bei den Eltern gemeldet ist, werden die mit beleuchtet, und das wollte ich meiner Familie nicht antun. Meine Mutter ist schon durch den Kampf um den Daueraufenthalt extrem mitgenommen. Deswegen habe ich es erst nach dem Studium gemacht. Als es zu spät war.
MOMENT.at: Gab es abseits von Wahlen Situationen, wo Ihre Staatsbürgerschaft ein Problem war?
Kosanovic: Vor allem aufgefallen ist es natürlich bei der Reisefreiheit. Mit 18 wollte ich mit Freunden nach London und konnte nicht ins Flugzeug einsteigen, weil ich nicht gecheckt hatte, dass ich ein extra Visum brauche.
Da steht immer: „die Fremde“. Das zieht einem ein bisschen den Boden unter den Füßen weg.
MOMENT.at: Was ist dann passiert?
Kosanović: Ich konnte nicht mitfliegen, ich bin wieder nach Hause gefahren. So etwas ist prägend. Es zeigt auch die Realität einer 18-Jährigen, die gar nicht damit rechnet, dass das jetzt bei ihr anders ist als bei ihrem Umfeld. Das Dritte war, in der Corona-Zeit und jetzt, wo rechte Stimmen in Europa wieder lauter werden, der Gedanke: Was ist, wenn die morgen sagen, alle Nicht-Staatsbürger:innen müssen zurück? Oder wenn ich mit meinem Mann verreise: würde im Ausland irgendetwas passieren, wäre die serbische Botschaft für mich zuständig, wir würden diplomatisch getrennt voneinander behandelt. Aber wenn etwas passiert, will ich nach Hause gebracht werden, und zu Hause ist halt hier.
MOMENT.at: Sie dachten, der Antrag auf die Staatsbürgerschaft sei ein reiner Formalakt. Dann kam die Ablehnung. Wie war das für Sie?
Kosanović: Den argen Moment hatte ich schon nach dem Antragstermin, als die Beamtin mir prophezeit hat, dass es wahrscheinlich nicht klappt. Ich bin da hin so „Jaja, wir treffen uns eh später, ich geh jetzt noch kurz zur MA 35“ – und dann war ich vollkommen vor den Kopf gestoßen: Hä, was ist da passiert? Als über ein Jahr später die Ablehnung kam, habe ich schon ein bisschen damit gerechnet. Der Brief war dann aber noch einmal arg, weil da immer steht: „die Fremde“. Okay, aus österreichischer Sicht bin ich „die Fremde“. Das Gefühl hatte ich davor nie. Das war schon schirch, es zieht einem ein bisschen den Boden unter den Füßen weg.
MOMENT.at: War das der Anstoß für den Film?
Kosanovic: Der Film ist nicht aus dieser Kränkung heraus entstanden. Sondern aus ehrlichem Interesse, herauszufinden, welche Gründe dahinter liegen und vor allem, warum das Thema so viele Menschen bewegt. Unter einem Artikel zu meinem Fall gab es 800 Kommentare. Als ich den Lipizzaner-Kommentar von User „Desert Eagle“ gelesen habe, wusste ich zumindest, ich muss irgendwas damit machen.
Viele dachten, das ist ein Formalfehler.
MOMENT.at: Wie hat Ihr Umfeld reagiert, wenn Sie erzählt haben, dass Sie die Staatsbürgerschaft nicht bekommen?
Kosanović: Viele konnten es gar nicht glauben, sie dachten, das ist ein Formalfehler. Das war auch ein Zeichen für mich: Aha, diese Wissenslücke hatte nicht nur ich. Viele hatten den Gedanken: Wenn ich das nicht schaffe, wie soll es zum Beispiel mein Vater schaffen? Es gibt eben viel Unwissen zu dem Thema. Deswegen war es uns wichtig, dass der Film ein breites Publikum mitnehmen kann.
MOMENT.at: Das breite Publikum kommt im Film auch zu Wort – da sitzen Menschen vor einer orangefarbenen Wand und werden befragt. Wie haben Sie diese Menschen gefunden und ausgewählt?
Kosanović: Zum Teil haben wir gezielt Menschen eingeladen, die eine Geschichte mit dem Thema Einbürgerung hatten – manche haben wir gekannt, andere haben wir in Facebook-Gruppen der MA-35-Bubble gefunden oder über Empfehlungen. Um das Spektrum zu erweitern, ist unser Produktionsteam auf der Straße herumgelaufen und hat uns Leute ins Studio geschickt.
MOMENT.at: Sie haben sie einfach auf der Straße angesprochen?
Kosanović: Ja, und erstaunlich viele haben zugesagt. Mit allen, die sich darauf eingelassen haben, war es ein super Gespräch. In dem Moment, wo ich jemandem gegenübersitze und der mir zuhört und ich ihm zuhöre, ist schon was gewonnen. Gegen Ende wussten wir, jetzt müssen wir noch gezielt Leute suchen, die einen ganz anderen Standpunkt vertreten. Unser Produzent ist dann in Bars rein und hat dort Leute überzeugt, die dann am nächsten Tag ins Studio gekommen sind.
Mich haben die spontanen, intuitiven Antworten interessiert.
MOMENT.at: Die Leute wussten also, es geht um das Thema Einbürgerung, aber nicht mehr?
Kosanović: Genau. Sie wussten nicht, wer ich bin oder was meine Geschichte ist. Die Schwierigkeit war immer, zu entscheiden: Wie schnell offenbare ich, was hier gerade verhandelt wird? Mich haben ja auch die spontanen, intuitiven Antworten der Leute interessiert zu Fragen wie „Was ist österreichisch?“.
MOMENT.at: Da kamen doch bestimmt auch Aussagen, wo Sie tief durchatmen mussten?
Kosanović: Das ist ja die Krux. Wie schafft man es, den Leuten diese plakativen Ängste zu nehmen? So Floskeln wie „Wir haben zu viele Ausländer“ oder „Die Ausländer nehmen uns alles weg“ – sobald ich nachgefragt habe: „Kannst du mir das näher erklären? Was meinst du genau?“, kommen die Leute ins Strudeln und merken selbst, dass es doch nicht ganz so schwarz/weiß ist. Wenn sie gehört haben, dass es für mich unmöglich ist, die Staatsbürgerschaft zu bekommen, haben viele gesagt: „na gut, das ist schon absurd“.
MOMENT.at: Politiker:innen, die den Status Quo befürworten, haben Sie nicht befragt. Sie kommen über TV-Ausschnitte zu Wort, werden aber nicht direkt interviewt.
Kosanović: Darüber haben wir im Team viel diskutiert. Letztlich haben wir aktiv entschieden, nicht direkt mit Politiker:innen jeglicher Couleur zu sprechen, weil die immer auch eine andere Mission haben als die Sache selbst. Das ist halt Teil ihrer Job Description. Außerdem sind sie rhetorisch wahnsinnig gut, es ist schwierig, dagegen anzukommen, wenn man nicht geschult ist. Die medialen Ausschnitte zeigen wir, um den öffentlichen Diskurs über die Gesetzeslage ein bisschen zu dekonstruieren.
Da muss ich als Filmemacherin gar nichts mehr inszenieren.
MOMENT.at: Was war für Sie selbst der größte Aha-Moment bei der Recherche?
Kosanović: Sicherlich die Härte der Regelungen zu den Verwaltungsstrafen. Was mich auch sehr bewegt hat: nach den Erstinformationsveranstaltungen konnten die Leute noch Fragen stellen, bei einigen durften wir mitdrehen. Da sieht man in kurzer Zeit ganz geballt, wie komplex eine Biografie ist, und wie die Leute dann aus ganz unterschiedlichen Gründen rausfallen, die vielleicht gar nicht das sind, worum es dem Staat eigentlich geht. Und natürlich die Geschichte der Lipizzaner. Zu lernen, wie mixed und multikulturell die sind.
MOMENT.at: Der Film fängt mit einer Text-Einblendung an: „Bitte erheben Sie sich für die österreichische Bundeshymne“. Ich musste lachen, weil ich für einen Moment den Impuls hatte, tatsächlich aufzustehen.
Kosanović (klatscht in die Hände): Sehr gut! Das ist ein bisschen ein Sozialexperiment, ich wusste ja nicht, was dann passiert im Kino. In manchen Ländern spielt es wirklich im Kino die Hymne. Die Leute stehen ganz selbstverständlich auf, setzen sich und schauen den Film. Vor Fußball-Länderspielen wird im Stadion auch genau dieser Satz gesagt, alle stehen auf, die Hymne wird gespielt. Das ist ein emotionaler Moment, wenn du mittendrin stehst und das ganze Stadion aufsteht und singt. Das macht was mit dir. Wir haben also gesagt, wir schreiben das hin und schauen, was passiert. Meistens sorgt es für einen Lacher, eben weil man sich nicht ganz sicher ist: Soll ich jetzt? Dieser Impuls ist ja in Ordnung. Vielleicht beginnt da schon das Hinterfragen: Warum mache ich das?
MOMENT.at: Es gibt viele Szenen am Amt, zum Beispiel von Einbürgerungs-Zeremonien. Manche sind eindeutig fiktional, manche haben für mich echt gewirkt, bei manchen war ich unsicher.
Kosanović: Es gibt eine Art Gesetzesprotokoll, wie eine Staatsbürgerschafts-Verleihung auszusehen hat: da muss diese und diese Fahne stehen, es muss diese Musik gespielt werden, es muss dieser Schwur geleistet werden. Da muss ich als Filmemacherin gar nichts mehr inszenieren, das inszeniert der Staat schon für mich. Die Verleihungen, die man am Anfang sieht, sind gestellt. Aber sie sehen in der Realität genauso aus.
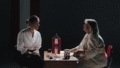
MOMENT.at: Es gibt auch eine Szene mit der Satirikerin Toxische Pommes, die zeigt, wie sich ChatGPT eine Einbürgerung vorstellt. Stammt der Dialog tatsächlich so von ChatGPT?
Kosanović: Ja, ich habe gesagt: „Schreib mir eine Szene, in der eine Frau in Österreich eingebürgert wird.“ Und rausgekommen ist das. Im ersten Moment hatte ich das Gefühl, ich werde hier gerade von meinem Computer verarscht, weil das wie eine Satire auf mein Leid ist. Andererseits aber auch das Gefühl: Ja, warum läuft es nicht so? Toxische Pommes deswegen, weil sie diese Thematik auch in ihrer eigenen Biographie hat, einen wahnsinnig schönen Roman dazu geschrieben hat und ich gern wollte, dass sie Teil dieser Geschichte ist.
MOMENT.at: In einer fiktiven Szene geht es um einen reichen Mann, der sich die Staatsbürgerschaft kauft. Dann kommt heraus, dass es um Zypern geht – warum nicht um Österreich?
Kosanović: Es gibt EU-Länder, wo der Kauf der Staatsbürgerschaft durch Investition Alltag ist: Zypern, Malta, Portugal. Da geht es, verglichen mit den sonstigen Investitionen von Superreichen, um sehr wenig Geld. Man kauft sich den Pass, muss den alten nicht abgeben, Agenturen bieten das auf Messen an. In Österreich gibt es eine Einbürgerung „im besonderen Interesse der Republik“, den „Netrebko-Paragraphen“, aber der Passus ist sehr schwammig, und ich wollte im Film nicht etwas behaupten, was zerrissen werden könnte. Deswegen das Beispiel Zypern. Mir ging es vor allem um die Ungerechtigkeit, um das Gefühl: wenn man Geld hat, gelten die Gesetze nicht mehr und alles ist super easy.
Das sind demokratiepolitische Fragen, die auch autochthone Österreicher:innen betreffen.
MOMENT.at: Wie kam es bei Ihnen letztlich zur positiven Entscheidung über Ihre Einbürgerung?
Kosanović: Ich habe mit einem Anwalt eine Säumnisbeschwerde eingelegt, weil die MA 35 ihre Frist von sechs Monaten für die Entscheidung überschritten hat. Die Behörde hat den Fall direkt ans Verwaltungsgericht weitergegeben. Der Richter, der sich dann auch durch den Fall durchackern musste, hat mich zu einer Anhörung eingeladen, und das Ganze war in acht Minuten vorbei. Er hat gesagt, ihm ist unverständlich, warum das nicht schon längst entschieden wurde. Ich kann mir nur zusammenreimen, dass es an der Überlastung der Behörde lag. Die Stadt muss in solchen Fällen die Anwaltskosten bezahlen, das ist auch nicht billig, wenn es dauernd passiert. Das meine ich mit diesem selbstauferlegten Bürokratiewahnsinn. Ich komme da ja auch mit einer analogen Mappe hin, und dann scannen die erst mal alles ein.
MOMENT.at: Was wollen Sie mit dem Film erreichen?
Kosanović: Mein Wunsch ist, dass die Leute sowohl die Gesetze als auch ihre eigenen Stehsätze hinterfragen. Und dass sie verstehen, dass das Thema uns alle betrifft. In Wien dürfen 35 Prozent der Erwachsenen nicht wählen, dadurch sind die junge und die städtische Bevölkerung bei nationalen Wahlen unterrepräsentiert. Die Einkommensschwelle für die Einbürgerung ist so hoch, dass 30 Prozent der Arbeiter und 60 Prozent der Arbeiterinnen in Österreich sie nicht überschreiten. Was heißt das alles langfristig? Wer darf in 40, 50 Jahren noch wählen? Das sind demokratiepolitische Fragen, die auch autochthone Österreicher:innen betreffen.
Vielleicht sieht „Desert Eagle" den Film ja irgendwann.
MOMENT.at: Der Film ist schon auf Festivals gelaufen. Gab es Rückmeldungen vonseiten der Politik?
Kosanović: Noch gar nicht, leider. Ich hoffe, dass das nach dem Kinostart passiert. Wir haben den Bundespräsidenten zur Premiere eingeladen.
MOMENT.at: Sie haben erwähnt, dass die Regierung Verbesserungen plant?
Kosanović: Sie will beim Thema Verwaltungsstrafen etwas erleichtern. Ich war positiv überrascht davon, dass die Staatsbürgerschaft überhaupt Teil des Regierungsprogramms ist. Aber das ist nur ein Zahnrädchen, und es ist noch nicht durchgesetzt.
MOMENT.at: Immer wieder formulieren Sie im Film mögliche Antworten an „Desert Eagle“. Haben Sie je geantwortet?
Kosanović: Nein. Aber die Überlegungen, was ich ihm oder ihr sagen würde, waren ein gutes Tool für die Dramaturgie. Vielleicht sieht er oder sie den Film ja irgendwann, das fände ich toll.

















