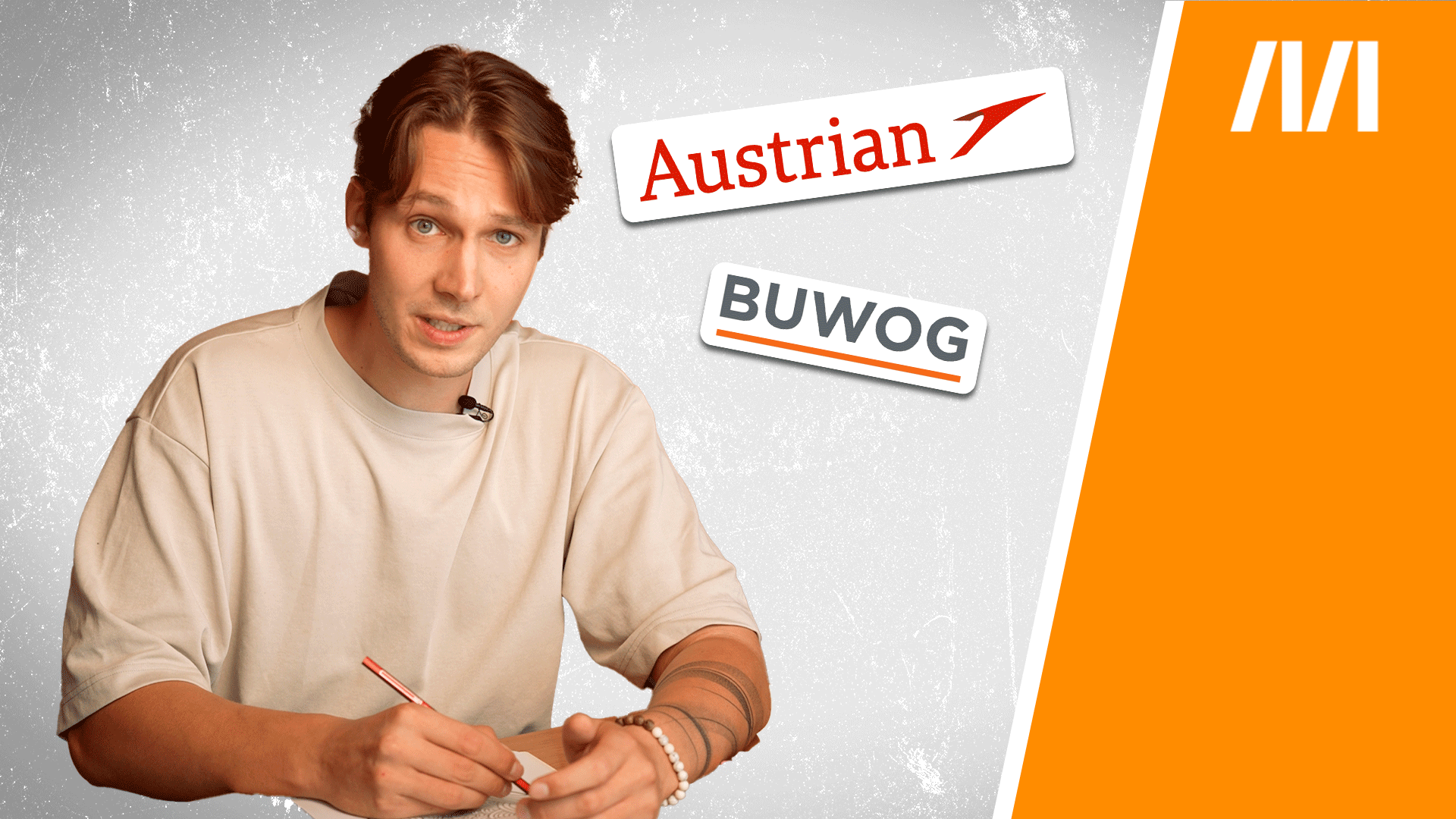Was bedeutet Wohlstand? Über eine Zukunft, in die wir mit Hoffnung blicken können
Mein Ur-Ur-Opa Franz war Bettgeher an genau der Adresse, in der ich heute wohne. Er hatte nicht genug Geld für eine eigene Wohnung. Nicht einmal genug Geld, um auch nur die Miete für ein eigenes Bett zu bezahlen. Er musste es sich mit anderen teilen. Acht Stunden er, dann der nächste. Er hat gelebt wie 170.000 andere Arbeiter auch. Und hatte es dabei immer noch besser als die Ziegelböhmen, mit deren Ziegeln das Haus gebaut wurde, in dem er sich mit anderen das Bett geteilt hat.
Mit ihren Ziegeln wurde halb Wien gebaut. Sie hatten kein Teilzeit-Bett, sondern mussten in Werksbaracken hausen. Ihr Lohn wurde in Blechmarken ausbezahlt, die sie nur bei betriebseigenen Wirten und Geschäften einlösen konnten. Maßlos überteuert natürlich. Das hat der Industrielle damals wohl unter “Kreislaufwirtschaft” verstanden.
Könnte mich mein Ur-Urgroßvater heute sehen, wie ich im selben Haus wohne, in dem er sich 100 Jahre zuvor nur ein Drittel von einem Bett leisten hat können: Ich würde ihm vorkommen wie eine Prinzessin. Ihr beurteilt das natürlich anders. 100 Quadratmeter zu fünft heißt: Meine Kinder teilen sich das Kinderzimmer. In meinem akademisch geprägten, urbanen Umfeld sind wir damit eher die Ausnahme.
Was bedeutet Wohlstand?
Wohlstand ist relativ und immer eine Frage der Perspektive. Das macht die Sache mit der Messbarkeit ein wenig tricky. Eine Messlatte ist vielleicht eine schlichte Frage: Was hat unser Leben spürbar besser gemacht im Vergleich mit früheren Generationen.
Gibt es mehr Selbstbestimmung?
Gibt es mehr Sicherheit?
Gibt es mehr Qualität in den Strukturen, die wir uns gemeinsam bauen?
Unser Wohlstand wächst immer dann, wenn Selbstbestimmung und Sicherheit zunehmen. Wenn Menschen ihre Zeit zurückgewinnen und Raum erhalten, den sie selbst gestalten können. Der Weg vom Frondienst zum freien Sonntag, von der gottgegebenen Obrigkeit zum Wahlrecht, vom Almosen zur Sozialversicherung: All das sind Wohlstandsgewinne.
Bis weit ins 18. Jahrhundert war das Leben der Mehrheit eine einzige Verpflichtung anderen gegenüber. Jeder Bauer hat seine Saat auf fremdem Boden angebaut. Ein Drittel seiner Ernte hat dem Grundherrn gehört, ein Zehntel der Kirche. Hat er Vieh gehabt, so musste er Fleisch, Milch und Wolle abgeben; hat er Wein angebaut, dann ist die halbe Lese an den Herrn gegangen. Und selbst wenn alle Abgaben erfüllt waren, war seine Arbeitskraft nicht frei. Er hat seinem Grundherren immer noch Robot geschuldet – also unbezahlte Arbeit.
Als Robot und Zehent schließlich fallen - keine 200 Jahre ist das her - da verschiebt sich der Alltag der Menschen von Zwang zu Gestaltung. Das erste Mal, dass der Tag, ein Teil davon wenigstens, wieder dem eigenen Leben gehört.
Ein Leben für den Wohlstand anderer
Wie allumfassend unser Leben früher anderen gehört hat, das hat mir meine Urgroßmutter klargemacht. Es sind die ersten weiblichen Abgeordneten im Parlament, unter ihnen Adelheid Popp, die das Hausgehilfinnengesetz einbrachten. Gemeinsam beschränken die Sozialdemokraten und Christlich-Sozialen 1919 die Arbeitszeit auf 13 Stunden; beschließen Ruhepausen und einen Mindestlohn.
Seit den 20er Jahren sinkt die bezahlte Arbeitszeit dank der Organisation und Solidarität von Menschen, die nicht nur für mehr Lohn kämpfen. Sondern für mehr Lebenszeit. Jede Stunde, die der Arbeit abgerungen wird, schafft Platz für anderes: für Familie, Freundschaften, Muße, Bildung, politisches Engagement. Zeit ist unsere wertvollste Ressource, denn unsere Lebenszeit ist begrenzt.
Wie wir diese Zeit nutzen oder nutzen können, das unterscheidet sich grundlegend nach unseren ökonomischen Möglichkeiten – und nach unserem Geschlecht. Denn jeder Gewinn an Freiheit durch weniger bezahlte Arbeitszeit ist überproportional den Männern zugutegekommen.
Bis heute leisten Frauen das Gros der unbezahlten Arbeit zu Hause, der Anteil, den Männer übernehmen, hat sich seit 40 Jahren nicht verändert. Dass die Stunden der Frauen überhaupt gesunken sind, das liegt nicht an der Emanzipation des Mannes, sondern an der massenhaften Verbreitung des Geschirrspülers und – zumindest in den einkommensstarken Haushalten – der Putzhilfe.
Womit sich der Kreis schließt zu Adelheid Popp und zur Regelung der gesetzlichen Arbeitszeit. Immer, wenn sich die Arbeitszeit ändert, dann ist das auch ein Ausdruck dessen, dass sich die politische Ordnung ändert. In die gleiche Zeit fällt die Einführung von Grundrechten, dem allgemeinen Wahlrecht, der Mitbestimmung in Betrieben und Gemeinden – und damit hat ein völlig neues Kapitel gesellschaftlicher Entwicklung begonnen.
Soziale Sicherheit ist die Voraussetzung für Freiheit
Die großen sozialen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts – Krankenversicherung, Arbeitslosenhilfe, Unfall- und Pensionsversicherung – folgen demselben Prinzip. Sie machen aus der Unsicherheit des Einzelnen die Sicherheit des Kollektivs. Soziale Sicherheit ist keine milde Gabe, sondern die Voraussetzung für Freiheit. Erst, wer nicht ständig Angst haben muss, kann selbstbestimmt handeln.
Wohlstand misst, wie gut Menschen leben können – nicht nur, wie viel Geld sie haben. Wohlstand, so verstanden, ist kein Zustand, sondern eine expansive Emanzipation: von Fremdbestimmung, von Angst, von Zeitnot. Eine Emanzipation, die immer weiter wächst und uns dabei immer freier macht.
Eine Frage der Zeit
Wohlstand ist immer eine Frage der Zeit und des Rahmens, in dem wir leben. Nicht einfach eine Zahl.
Das prägende Leitbild der Nachkriegsjahre war “Wohlstand für alle, die etwas leisten”. Es verspricht materiellen Aufstieg, soziale Sicherheit und Teilhabe durch Wachstum. Doch dieses Versprechen, “alles wird gut mit Fortschritt”, hat Schattenseiten. Die Verheißungen des Wohlstands sind an ein Konsumversprechen gekoppelt, das darauf angewiesen ist, dass Ressourcen immer verfügbar sind, die Natur sich ausbeuten lässt – und auf asymmetrische Produktionsverhältnisse. Dass immer irgendwer irgendwen ausbeuten kann.
Sonst läuft der Laden nicht. Während einige von diesem Modell profitieren, bleibt es für viele, für die große Mehrheit, ein schlechter Deal. National wie global. Der Massenkonsum sammelt wie ein moderner Staubsauger – natürlich kabellos! – immer mehr Vermögen in den Händen von nur ganz wenigen Leuten.
Die Ungleichheit explodiert
Das ist nicht nur ein Gefühl, das kann man messen: Alle Daten zeigen uns eine sozioökonomische Schieflage von gewaltigem Ausmaß. Wir haben in Österreich und Deutschland eine Ungleichheit wie seit den Lebzeiten meines Ur-Ur-Opas, der Zeit des Ersten Weltkriegs nicht mehr. Als hätten wir die Monarchie nie abgeschafft.
Die ärmere Hälfte unserer Bevölkerung hat praktisch gar kein Nettovermögen. Nur ein Bankkonto, Schulden und einen Haufen Elektrogeräte. Bei den ärmsten 20 Prozent sind die Schulden sogar größer als die Vermögenswerte. Das oberste Prozent hält bis zu 50 Prozent des Vermögens. Tendenz: Weiter steigend.
Diese Superreichen sind eine kleine, aber unfassbar einflussreiche Gruppe, die einen erheblichen Teil des globalen Vermögens, der Finanzmärkte und Produktionskapazitäten kontrolliert. Wenn man die atemberaubende Konzentration von Vermögen thematisiert, geht es dabei nicht einfach darum, dass manche Menschen halt mehr besitzen. Das ist keine “Neid-Debatte”. Es geht um die Demokratie.
Wer Geld hat, hat auch Macht
Um die Macht, die mit so viel Vermögen einhergeht; die Macht, die Spielregeln unserer Wirtschaft zu bestimmen und die Macht, unsere Öffentlichkeit durch den Besitz von Medien zu formen. Und nur damit das auch laut ausgesprochen ist: selbstverständlich auch der Politik. Und die Superreichen bedienen sich beider, Medien und Politik, um ihre Interessen durchzusetzen: Die Besteuerung von riesigen Vermögen und Erbschaften gehört da nicht dazu. Die Ökonomin Kate Raworth bringt es treffend auf den Punkt:
“Regierungen haben historisch gesehen eher das besteuert, was sie konnten – statt das, was sie sollten. Und das sieht man.”
Und das ist die Ursache des Fortschritts-Dogmas: Wer die Verteilungsfrage nicht mehr stellen darf, dem bleibt nur mehr das immerwährende Wirtschaftswachstum, um das Leben der breiten Massen zu verbessern.
Der Motor unseres Fortschritts ist leider auch die Quelle unseres Untergangs. Seit dem Beginn der industriellen Revolution haben wir Energie, die Hunderte von Millionen Jahren in der Erde gespeichert war, als Öl, Gas und Kohle rausgesaugt und verbrannt. Wir haben mehr als zwei Milliarden Tonnen an CO₂in die Atmosphäre geblasen.
Aber eben nicht alle gleich viel: Während 80 Prozent der Bevölkerung seit 1990 ihren CO₂-Ausstoß reduziert haben, hat sich der CO₂-Ausstoß des obersten Prozentes um 25 Prozent erhöht. Die verhindern auch kulturell jeden Wandel. Denn sie prägen den Blick auf die Welt: Was sie kaufen, wollen wir auch. Ihre Konsummuster setzen Maßstäbe, auch für uns Normalos.
Wachstum gegen Wohlstand
Der Preis für all das ist hoch und die Zeche zahlen wir alle: sozial wie ökologisch. Wer teilhaben will, muss konsumieren und treibt damit Ungleichheit und Ressourcenverbrauch voran. Und die Prognosen sehen eine Fortsetzung dieser Trends. Die Wirtschaft wächst um ein Vielfaches schneller als die Bevölkerung. Heißt: Wir konsumieren immer mehr.
Seit über 70 Jahren ist die Wirtschaftswissenschaft fixiert auf das BIP als zentralen Maßstab für Wohlstand und Fortschritt. Die Fixierung auf Wachstum ist gleichzeitig die Rechtfertigung für extreme Ungleichheiten von Einkommen und Vermögen – UND für eine beispiellose Zerstörung der lebendigen Welt.
Es wurde und wir viel dafür getan, dass wir alle das so spät wie möglich merken, weil es für einige wenige sehr reiche Menschen nach wie vor verdammt profitabel ist, unseren Planeten anzuzünden. Seit 1977 haben Wissenschaftler:innen im Auftrag von Exxon Mobil simuliert, wie stark sich die Erde erhitzen wird, weil wir pausenlos Gas und Öl abfackeln. Ende der 70er Jahre war eine weltweite Temperaturerhöhung noch überhaupt nicht messbar. Aber die Exxon-Vorhersagen von damals waren erstaunlich präzise.
Anzünden, anzünden
Die Prognosen der Erdöl-Industrie waren sogar besser als das, was etwa der NASA-Forscher James Hansen 1988 im US-Kongress vorgestellt hat. Dieses Jahr gilt als jenes, in dem der Klimawandel als Problem erstmals auch einer breiteren politischen Öffentlichkeit langsam gedämmert ist. Was haben also die Öl-Multis gemacht? Richtig: Sie haben sich 1988 zusammengesetzt und geplant, wie sie die Öffentlichkeit hinters Licht führen können, wie ein geleaktes Dokument zeigt.
Das Ziel: „Der Sieg wird erreicht sein, wenn Durchschnittsbürger die Unsicherheiten in der Klimawissenschaft ‚verstehen‘ ; wenn die Anerkennung dieser Unsicherheiten Teil der allgemeinen ‚gängigen Meinung‘ geworden ist.” Was haben sie getan, um das zu erreichen? Wissenschaftler:innen eingekauft, Medien bespielt, selektiv “Forschung” finanziert, für Schein-Objektivität gesorgt, in dem sie „beide Seiten“ in die Berichterstattung hineingebracht haben. Und das tun sie bis heute.
Christian Stöcker hat für sein Buch, Männer, die die Welt verbrennen, recherchiert, dass laut Internationalem Währungsfonds im Jahr 2022 weltweit sieben Billionen Dollar an direkten und indirekten Subventionen für fossile Brennstoffe ausgegeben wurden. Das ist fast das Doppelte des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Den fossilen Konzernen stellen wir die Schäden, die sie verursachen, also nicht nur nicht in Rechnung. Wir bezahlen sie mit unserem Steuergeld auch noch dafür, dass sie weitermachen.
Das Ende des Kapitalismus? Gibt es nicht
Wir können uns leichter das Ende der Welt vorstellen, als das Ende des Kapitalismus. Weltweit waren die 80er-Jahre eine große Struktur-Revolte: Die kapitalistische Wirtschaft wurde vom Postfordismus zum Neoliberalismus umgebaut. “There is no alternative” ist die Formel, in die diese Politik gerinnt. Der Wettbewerb ist das bestimmende Merkmal. Wenn jeder auf sich schaut, ist auf alle geschaut? Dieser Egoismus wird uns auf magische Weise den Weg zur gesellschaftlichen Verbesserung zeigen und uns irgendwann einmal alle reicher machen.
Damit das gelingt, dürfen wir nur eines nicht: Die natürliche, leistungsorientierte Hierarchie von Gewinnern und Verlierern stören. Der Markt wird – wenn man ihn in Ruhe lässt – bestimmen, wer es verdient, erfolgreich zu sein, und wer nicht. Die Talentierten und Fleißigen werden sich durchsetzen, während die Unfähigen, Schwachen und Inkompetenten scheitern werden. Ein aktiver Staat, der versucht, das Marktergebnis zu ändern, der darin eingreift, zum Beispiel durch – Gott bewahre! – Verteilungspolitik, der behindert nicht nur die Entstehung dieser natürlichen Ordnung, er belohnt die Verlierer:innen!
In dieser Logik sind soziale Unterschiede nicht nur verdient, sondern sie sind total legitim. Ungleichheit ist damit nicht nur normalisiert, sondern naturalisiert. Vermögen und Macht bleiben in den obersten Schichten konzentriert. Die haben das verdient, sie sind uns in Leistung und Moral sicherlich überlegen.
Auch progressive Kräfte haben im Nachkriegs-Boom auf diese Erzählung gestützt. Wer sich anstrengt, soll sich was aufbauen können - das ist die Formel dafür. Gesellschaftlicher Erfolg ist auch in dieser Erzählung das Ergebnis individueller Leistung. Aber das führt eben auch dazu, dass Ungleichheit vielleicht wahrgenommen, aber selten offen thematisiert oder aktiv bekämpft wird. Sie ist ja das Ergebnis des eigenen, persönlichen Tuns.
Wo Rechte einhaken
Genau hier schließen die Sirenengesänge der Rechten an. Sie versprechen, dass “die anderen” unten bleiben – nicht Gerechtigkeit für alle. Sie reden von Ordnung und Sicherheit – nicht von Solidarität. Sie bieten keine Lösungen, sondern Geschichten darüber, wer an allem schuld ist. Und weil mit der alten Erzählung vom „Wer will, der kann“ ohnehin schon die Verantwortung personalisiert haben, ist der Schritt zur Schuldzuweisung an andere nur noch ganz klein.
Nicht Reichtum oder Armut allein erklären politische Radikalisierung, sondern die Angst, abzurutschen. Menschen, die sich an der Grenze fühlen, die spüren, dass eine Krankheit, eine Kündigung, die steigende Inflation sie in den Abgrund reißen könnte, sind anfälliger für rechte Angebote. In einer Gesellschaft, die dir ständig was von Wachstum und Aufstieg erzählt, ist der Abstieg ist die fundamentale Kränkung. Und aus dieser Kränkung kommt das Gefühl, von der Politik im Stich gelassen zu werden.
Verlustängste führen zu Radikalisierung
Genau deshalb suchen viele nach autoritären Alternativen. Genau hier setzen die Rechten an. Sie wissen, dass die Verletzlichsten nicht unbedingt die sind, die schon alles verloren haben – sondern jene, die glauben, dass sie noch was zu verlieren haben.
Es ist die Eigentumsachse entlang derer sich Interessen spalten, nicht das Einkommen. Paula und Emil wohnen in der gleichen Straße, beide sind ähnlich alt, sind ähnlich gut gebildet, haben ein ähnliches Einkommen. Paula aber besitzt die Wohnung, in der sie wohnt. Emil zahlt für seine Miete. Das ändert alles. Wer Eigentum hat, fürchtet sich vor Wertverlusten. Wer mietet, fürchtet sich vor Preissteigerungen.
Beide gehen rationale Wege innerhalb ihrer Risikolandschaft, beide „wählen Sicherheit“. Nur zeigen die Zeiger in entgegengesetzte Richtungen. Besitz sorgt für Anreize, Werte zu erhalten und Regeln zu formen, die das eigene Vermögen schützen. Das zeigt sich dann auch in Einstellung und Verhalten. Wo Hauspreise steigen, wächst die Unterstützung für Amtsinhaber, wo sie fallen, wechseln die Wähler:innen eher ins Lager der Herausforderer. Diese Ergebnisse stimmen übrigens auch für andere Vermögenswerte.
Eigentum orientiert uns vertikal: Wir rechnen uns nach oben, jede Veränderung des Status quo ist eine potenzielle Bedrohung. Autoritäre Denkweisen und der Glaube an die Meritokratie verstärken diesen Prozess.
Strukturen gegen das Abdriften
Wenn wir die Gruppen, die Angst vor dem Abrutschen haben und nach rechts driften, wieder reinholen wollen, dann müssen wir die Strukturen ändern. Aber das wird nicht vom Himmel fallen.
Wer Verlust fürchtet, den überzeugt man nicht mit moralischen Vorwürfen, sondern mit Angeboten, die diese Angst neutralisieren. Planungssichere Schichtmodelle, die das Familienleben schützen. Weiterbildung, die nicht nebenbei „irgendwann“ passiert, sondern bezahlt und verbindlich. Absicherungen, die nicht nur die Schwächsten auffangen, sondern den viel zitierten „Mittelstand“ ernst nehmen. Mieten, die nicht jedes Jahr davongaloppieren. Energiepreise, die berechenbar sind. Man könnte auch dazu sagen: Wohlstand.
Wir werden die Strukturen auch nur ändern können, wenn wir die Erkenntnisse der Wissenschaft ernst nehmen, die uns mittlerweile bescheinigt, auf eine Art Re-Feudalimus zuzusteuern. Das lässt sich natürlich nicht laut sagen. Um den Status quo zu rechtfertigen, können die Verteidiger:innen der bestehenden Ordnung diesen Zustand nicht gerade wunderbar abfeiern. Also wird uns der aktuelle Zustand – in dem alles Dasein ausschließlich nach Geld bewertet wird – auf andere Weise als Ideal präsentiert. Indem man sagt: Alles andere ist noch schrecklicher.
"Woanders ist es auch nicht besser"
Sicher, sagen sie, wir leben vielleicht nicht in einer Gesellschaft, wo Milch und Honig fließen und alles gerecht zugeht, aber wir können froh sein, nicht woanders zu leben. Ja, unsere Demokratie ist nicht perfekt, aber besser als blutige Diktaturen! Ja, der Kapitalismus ist ungerecht, aber die Alternative ist Stalins Gulag. Auch diese Art der Rhetorik beendet jede Suche nach Alternativen, bevor sie überhaupt angefangen hat. Wer in der besten aller möglichen Welten lebt, und sei sie noch so schlecht, braucht über eine andere Zukunft nicht nachdenken.
Aber Achtung: Das Ende der Zukunft ist kein Prozess des Stillstands. Unserem Wirtschaftssystem ist eine Steigerungslogik eingebaut. Aber unsere aktuelle Methode, den Wohlstand zu messen, hat nicht unser Wohlbefinden im Sinn. Ob ein Geschäft oder eine Transaktion der Umwelt nützt oder schadet, ob sie glücklich macht oder am Unglück anderer Leute verdient, das ist dem Bruttoinlandsprodukt herzlich egal. Bereits 1968 witzelte Robert Kennedy, der später ermordete Bruder des US-Präsidenten:
„Das Bruttoinlandsprodukt misst alles, außer dem, was das Leben lebenswert macht.“
Wir leben heute in Volkswirtschaften, die wachsen müssen, ob es uns guttut oder nicht.
Was wir brauchen, sind Volkswirtschaften, die uns guttun: ob sie wachsen oder nicht.
Es existieren bis dato keine empirischen Beweise für eine längerfristige absolute Entkopplung des Wirtschaftswachstums von der Entwicklung der Umweltbelastung. Heißt andersrum und vereinfacht gedacht: Mehr Wachstum heißt immer mehr Schaden.
Ein Donut für den Wohlstand
Seit etwa 30 Jahren diskutiert deshalb die Wissenschaft, wie Wirtschaftswachstum ökologische und soziale Grenzen einhalten kann. Das gelingt etwa im Konzept der »Donut-Ökonomie« von Kate Raworth.
Das Wesen des Donuts: ein gesellschaftliches Fundament des Wohlergehens, unter das niemand abstürzen sollte auf der einen Seite und eine ökologische Decke des planetaren Drucks auf der anderen, über die wir nicht hinausgehen sollten. Zwischen diesen beiden Grenzen liegt der „Sweet Spot“: ein Raum, der zugleich ökologisch sicher und sozial gerecht ist.
Die Aufgabe ist so herausfordernd wie lohnend: die Menschheit in diesen sicheren und gerechten Raum zu bringen. Also die Menschenrechte jedes Einzelnen zu verwirklichen. Aber innerhalb der Belastungsgrenzen unseres Planeten. Hier liegt unser Dilemma, wie auch Raworth selbst sagt:
“Kein Land hat je menschliche Not überwunden, ohne dass seine Wirtschaft gewachsen ist. Und kein Land hat je ökologische Zerstörung beendet, während seine Wirtschaft weiter gewachsen ist.”
Wirtschaft muss nicht grenzenlos wachsen, sondern innerhalb eines sicheren ökologisch-sozialen Handlungsraums gedeihen. Wachstum kann neu gedacht werden als Wachstum in Qualität, Nutzen und Diversität, nicht in Verbrauch. Zukunftsfähiges Wachstum heißt also: nicht “mehr von allem”, sondern “besser in allem”.
Die Geschichte hat uns gezeigt, dass Wohlstand immer dann gestiegen ist, wenn Menschen Kontrolle über ihre Zeit, ihren Körper, ihre Arbeit und ihr Lebensumfeld zurückgewonnen haben. Der Wohlstand von morgen kann also kein Fortschreiben des Alten sein.
So muss Wohlstand
Er wird sich daran zeigen, ob wir mehr Zeit haben, unser Leben frei zu gestalten; ob wir uns sicher fühlen, ohne Angst vor Absturz; ob wir einander wieder vertrauen können, und ob wir nicht mit Angst in die Zukunft schauen, sondern mit Zuversicht – und mehr noch: mit Vorfreude.
Diese Zukunft wiederzuentdecken – und mit ihr die Hoffnung! – ist zweifelsohne eine große Aufgabe. Eine riesengroße. Aber: “Erst durch das Engagement für die Zukunft wird die Gegenwart überhaupt bewohnbar.” Sagt der Philosoph Ernst Bloch. So betrachtet ist das Suchen nach Alternativen jedenfalls alternativlos.
Die lange, dunkle Nacht vom Ende der Geschichte (und damit aller Zukunft) können wir auch als gewaltige Chance verstehen. Denn gerade die erdrückende Allgegenwart unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems bringt es mit sich, wie Mark Fisher analysiert hat, “dass selbst kleinste Anzeichen alternativer politischer oder ökonomischer Möglichkeiten eine überproportional große Wirkung entfalten können. Das winzigste Ereignis kann einen Riss in den grauen Vorhang der Reaktion reißen, der den Horizont des Möglichen so lange begrenzt hat. Aus einer Situation, in der nichts geschehen kann, wird damit ganz plötzlich eine, in der alles möglich ist.“