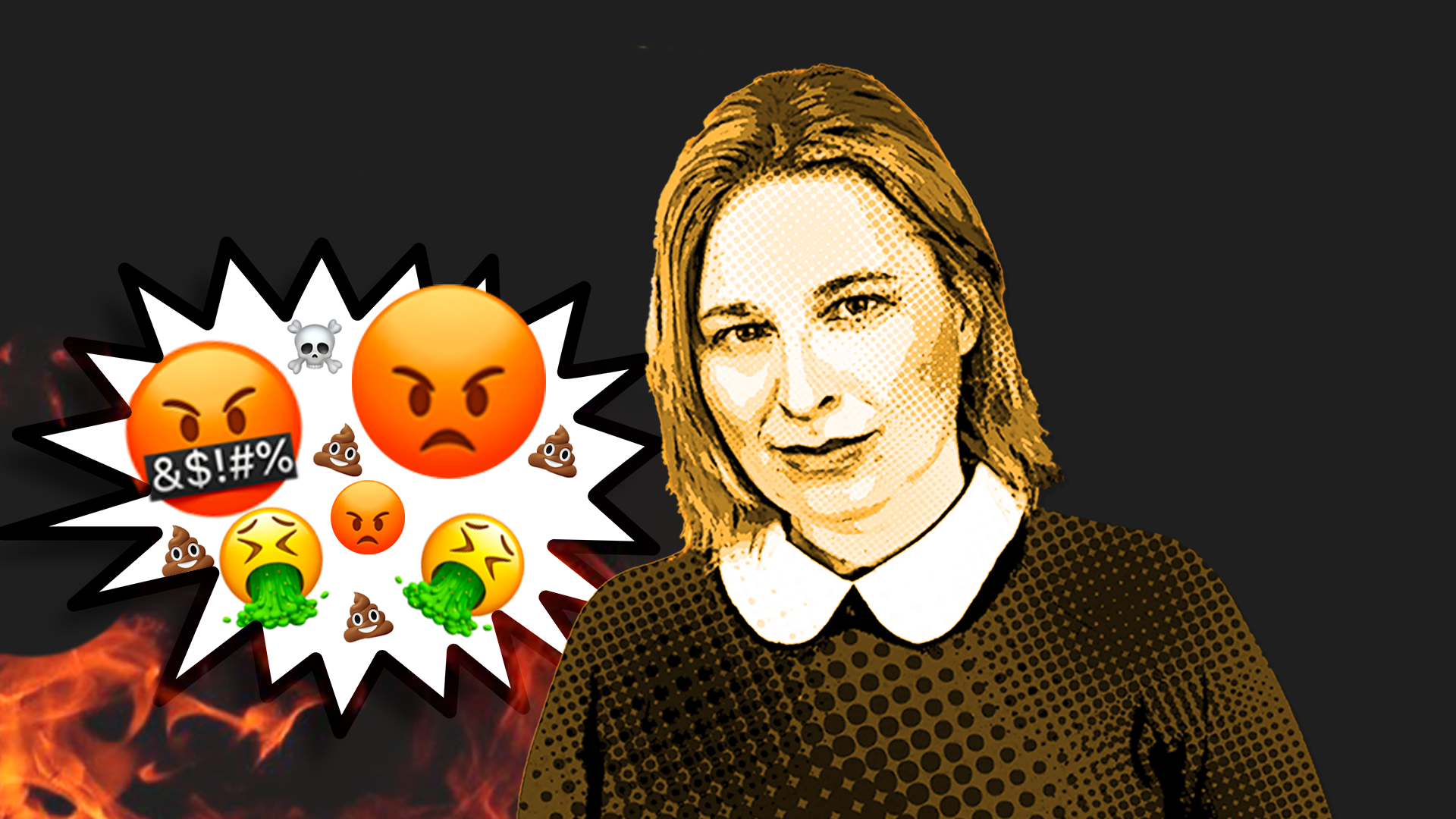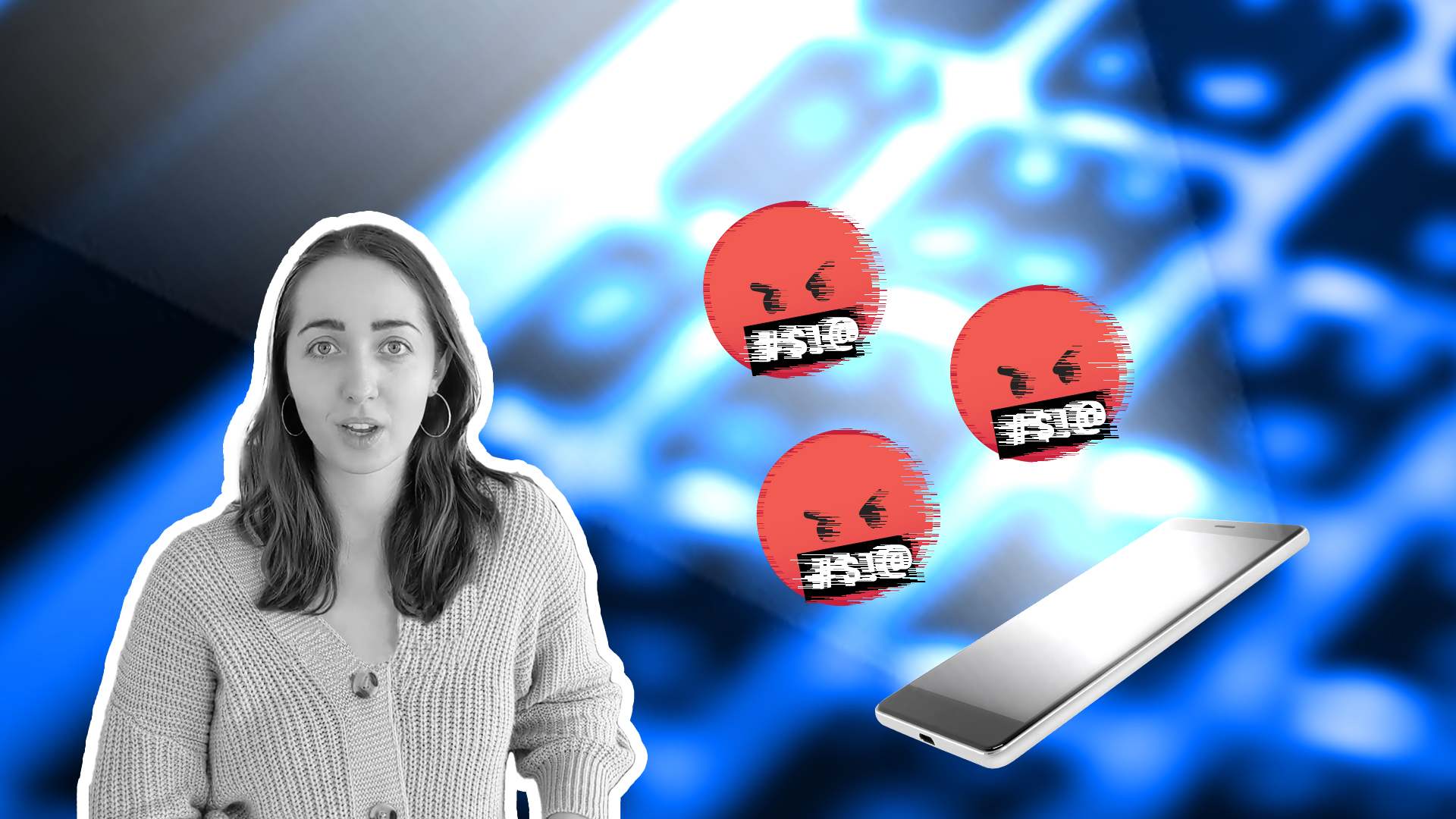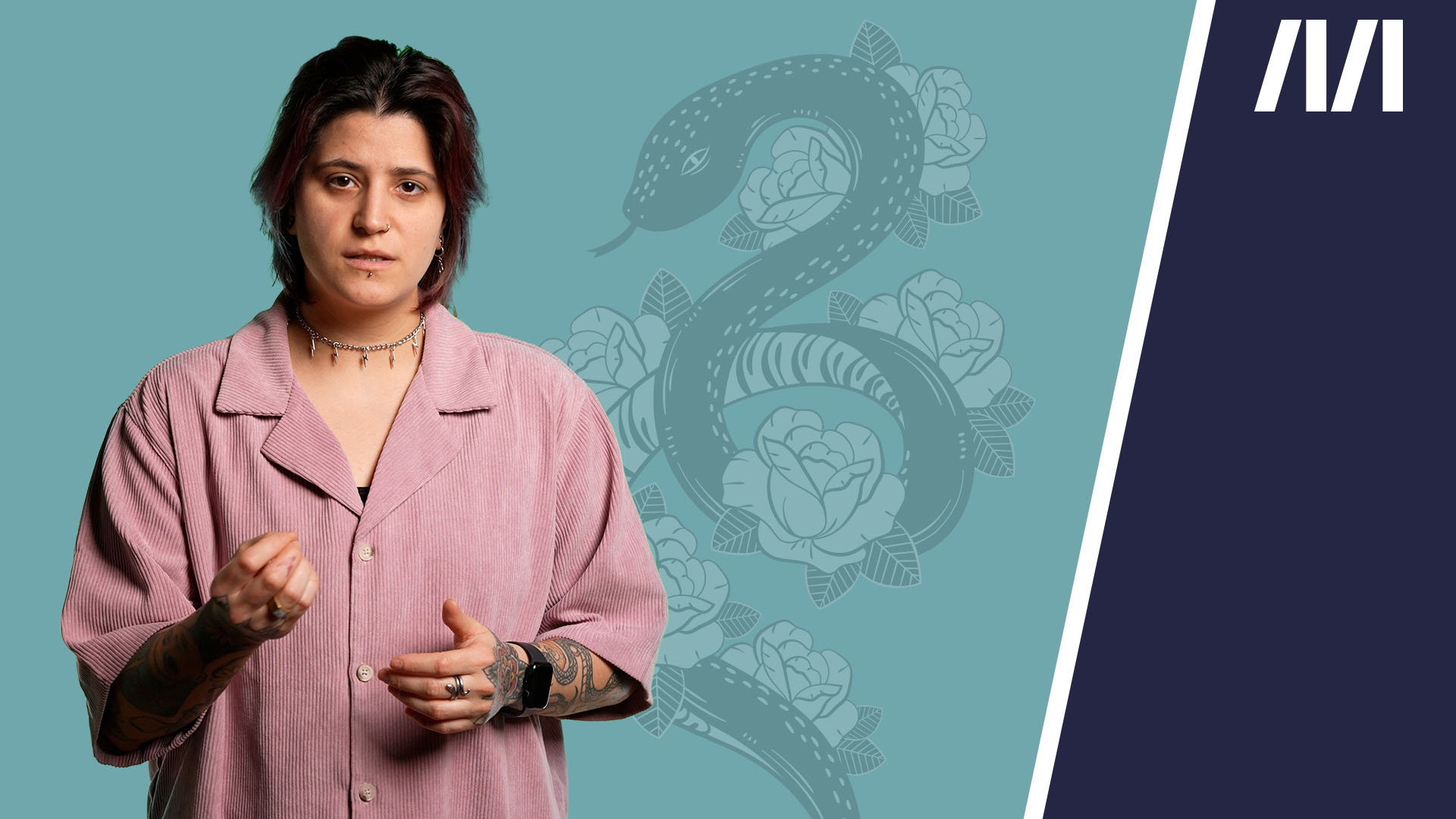Hass im Netz: wer ich bin, macht mich angreifbar
Man muss nicht lange suchen, um ihn zu finden. Den Hass im Netz. Er ist überall. Ihr wisst, wovon ich spreche – ihr habt ihn heute sicher schon gesehen. Es ist 18 Uhr 45. Im Durchschnitt habt ihr heute etwa vier Stunden online verbracht, davon 65 Minuten auf Social Media. Ihr seid durch Feeds gescrollt, habt vielleicht Kommentare unter einem ZIB-Beitrag auf Instagram gelesen oder euch die Diskussionen unter einem YouTube-Video angesehen. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr auf Worte gestoßen seid, die verletzen, herabwürdigen, vergiften.
Viele können einfach weiterscrollen oder das Gerät weglegen, wenn’s zu viel wird. Vielleicht ärgert man sich kurz, vielleicht schüttelt man den Kopf – dann klappt man den Laptop zu und vergisst es wieder.
Mein Name ist Yasmin Maatouk, und mein Laptop ist immer aufgeklappt. Hasskommentare gehören zu meinem Alltag, so selbstverständlich wie Zähneputzen. Täglich schlägt mir Hass entgegen, der sich nicht nur gegen meine Arbeit als Journalistin richtet, sondern gegen mich als Person – gegen mein Gesicht, mein Geschlecht, meine Identität. Und völlig selbstverständlich werde ich angegriffen für meine Herkunft, für meine Migrationsgeschichte. Sie nehmen mich ins Visier, weil ich sichtbar bin, weil ich Haltung zeige, weil ich Themen anspreche, die unbequem sind.
Und wisst ihr was? Ich bin gerne unbequem, um aufzuzeigen, dass dieser Hass kein privates Problem und kein Hintergrundrauschen ist. Er ist Teil eines Systems, das Menschen wie mich und viele andere gezielt angreift – wenn wir wollen, dass nicht nur weiße cis Männer – die am wenigsten betroffene Gruppe von Hass im Netz – als einzige Gruppe für Magazine und Medienhäuser sichtbar sind, müssen wir was an dieser Struktur verändern. Das darf nicht an FLINTA, People of Color, Migrant:innen, mehrfach marginalisierten Einzelperson hängen bleiben, die die Flut an Hass im Netz auffangen und halten müssen.
Die Verantwortung tragen wir alle, aber vor allem diejenigen, die von diesem rassistischen System auch noch profitieren.
In meiner Rolle als Videojournalistin und Social Media Host beim Moment Magazin bin ich nicht nur mit meinem Gesicht und meinem Namen präsent – ich stehe für Werte, Überzeugungen und Themen, die klare Haltung erfordern. In meiner Arbeit thematisiere ich immer wieder Rassismus, Sexismus, die Klimakrise und die reale Bedrohung durch Rechtsextremismus hier in Österreich. Themen, die oft verdrängt, verharmlost oder bewusst verzerrt dargestellt werden.
Herausforderungen im Netz:
Als Journalistin bin ich täglich sichtbar in der Öffentlichkeit – das macht meine Arbeit nicht nur beruflich, sondern auch emotional herausfordernd.
Als weiblich gelesene Person, wird mir mein Wissen und meine Kompetenz abgesprochen, ich werde auf mein Äußeres reduziert, um meine Stimme zu unterdrücken. Ich bin unbequem, eine „zu laute“ Frau, die sich für ihre Überzeugungen stark macht und diese offen vertritt. Andere beschreiben das als zu penetrant.
Als migrantisch und muslimisch gelesene Person werde ich regelmäßig als fremd und als Bedrohung für die nationale Ordnung dargestellt. Die Reaktionen reichen von offener Feindseligkeit bis hin zu Fetischisierung. Für viele bin ich ein „Störfaktor“, der sich Raum nimmt, der mir vermeintlich nicht zusteht. Diese Projektionen verstärken sich weiter, wenn ich als queere Person wahrgenommen werde – jede dieser Identitäten macht mich zur Zielscheibe. Und alle zusammen vervielfachen die Größe dieser Scheibe.

Medien als Verstärker von Hass und Angst:
Hass im Netz trifft uns nicht zufällig. Es sind gezielte Angriffe, die sich an Menschen richten, die sichtbar sowie unbequem sind und in der Machtpyramide nicht ganz oben stehen. Ich frage mich: Wie entstehen diese Räume? Wer profitiert davon? Und warum ist das Problem so tief in unserer Medienlandschaft verwurzelt?
Ein Blick in die Berichterstattung zeigt, wie oft Migrant:innen als Bedrohung dargestellt werden. Ein Beispiel dafür ist die Berichterstattung der Kronen Zeitung – die auflagenstärkste Zeitung in Österreich – speziell in den Wochen vor der Nationalratswahl. Riesige Schlagzeilen auf der Titelseite über Abschiebungen, straffällige Asylwerber:innen und Migrant:innen, die eine Gefahr darstellen sollen – ein Narrativ, das bewusst Zahlen verdreht und verfälscht. Es gäbe ein großes Problem, nämlich straffällige Migrant:innen und eine allumfassende Lösung: Abschiebung. Massenhaft und auch zu einem islamistischen Regime nach Afghanistan.

- “Vor Abschiebung jeder 2. kriminell”
- “Müssen noch viel mehr abschieben”
- “Asyl-Krise: Was jetzt alles passieren muss”
- “Seit Merkel schaffen wir gar nichts mehr”
- “Jetzt Abschiebungen nach Afghanistan fix”
Das Ziel? Straffälligkeit soll mit Menschen assoziiert werden, die eine Migrationsgeschichte haben. Diese Texte sollen nicht informieren – sie sollen beeinflussen. Und eine Rhetorik der Bedrohung aufbauen, die tief in die Köpfe eindringt.
Aber nicht nur der Boulevard ist schuld. Fast genauso bedrohlich sickert das Gift in die sogenannte Mitte der Gesellschaft ein, unterstützt von den sogenannten „Qualitätsmedien“, die wir eigentlich als “unabhängige” Stimmen ansehen.

Schaut euch das hier an. Und ich muss dazusagen, dass ich mich kaum entscheiden konnte, welche Zitate ich euch heute zeige. So menschenverachtend und gefährlich ignorant ist dieser Artikel:
Im Juni publizierte die größte liberale Tageszeitung, der Standard, einen Artikel von Eric Frey, einem der führenden Wirtschaftsjournalist:innen Österreichs.
Er schreibt tatsächlich:
Familienzusammenführung ist ein wertvolles Menschenrecht, aber im Zusammenspiel mit Asyl wird es zum Brandbeschleuniger.
Ähnliche Proteste lösen Berichte über Pushbacks aus. Also alle Versuche, illegal über Land oder übers Meer eindringende Migrant:innen mit Gewalt wieder aus dem eigenen Hoheitsgebiet hinauszudrängen, um zu verhindern, dass sie um Asyl ansuchen. Das ist illegal, aber etwa im Fall Griechenlands effektiv.
Ganz ernsthaft wird behauptet, dass die Jahre der ‚lockeren‘ Asylpolitik – die sich vor allem an Menschenrechten orientiert hat – jetzt vorbei sein sollten. Und nicht nur das: Frey meint, dass die Toleranz gegenüber „illegaler Einwanderung“ einer der größten politischen Fehler der letzten Jahrzehnte sei, weil sie Rechtspopulist:innen Aufwind gegeben habe. Also basically: Hören wir auf, Menschenrechte zu schützen, dann gibt es keinen Grund mehr, rechtspopulistisch zu sein.
Und das ist der Punkt: Diese bodenlose Forderung könnte genauso gut auf einem FPÖ-Wahlplakat stehen. Es könnte in der Krone oder der Heute stehen. Ich wäre schockiert, aber nicht überrascht. Es steht aber im Standard. Hier sehen wir also nicht nur den Boulevard, der Hetze schürt, sondern auch den scheinbar seriösen Journalismus, der menschenfeindliche Forderungen für salonfähig erklärt.
Persönliche Auswirkungen:
Für mich als Migrantin ist das ein Schlag ins Gesicht. Die Themen werden bereits seit Jahren von Rechten – und wenn wir ehrlich sind – Rechtsextremen vorgegeben. Sie zu ignorieren ist keine Option, wir müssen aktiv Fakten checken, geraderücken und einordnen, was da für Hetze verbreitet wird.
Ein großer Teil meiner Arbeit ist also auch, diesen menschenfeindlichen “Journalismus” aufzuarbeiten und dagegenzuhalten. So gut ich kann. Und auch wenn es mich als Mensch persönlich trifft und ich mich manchmal sehr klein fühle, möchte ich mich dieser Aufgabe annehmen. Zu sehen, wie sich dieser inhaltliche Müll immer mehr verbreitet und auch in vermeintlich progressiven Medien Platz findet – es tut mir einfach so weh. Es tut mir weh, dass unsere Stimmen in all dem Lärm kein Gehör bekommen. Es tut mir weh für meine Eltern, die dieses akademische Geschwafel, das auch sie diskriminiert, nicht einmal verstehen.
Es tut mir weh, wenn ich sehe, dass es keinen Ausblick auf Verbesserung gibt. Der Diskurs hat sich verschoben. Die Grenze zwischen Meinungsfreiheit und Hetze verschwimmt immer mehr. Und der Rassismus und die Islamfeindlichkeit steigen nicht nur spürbar immer mehr – auch die Zahlen sind erschreckend:
Und es tut mir weh für meinen kleinen 13-jährigen Bruder, der mich vor gar nicht so langer Zeit gefragt hat:
Yasmin, müssen wir uns auch Sorgen machen, abgeschoben zu werden?
Diese Frage, diese Unsicherheit, ist nicht allein das Resultat der Wahlergebnisse. Sie sind das Resultat einer Berichterstattung, die sich eines Narrativs bedient, das spaltet und Angst schürt.
Und wer trägt die Verantwortung für den Diskurs? Projekte wie web@ngels leisten wichtige Arbeit, aber fragt ihr euch nicht auch: Warum es Ehrenamtliche braucht, um den Hass in Kommentarspalten einzudämmen, während mächtige Medienhäuser selbst hasserfüllte Schlagzeilen und Artikel produzieren und keine Verantwortung für die Konsequenzen übernehmen?
Kommentarspalten knüpfen oft dort an, wo die Zeitung aufhört. Sie geben Menschen eine Plattform, um auf die Stimmung der Artikel zu reagieren. Was nicht direkt im Artikel steht, findet seinen Weg in die Kommentarspalten. Die Medienhäuser entziehen sich dieser Verantwortung, indem sie die Pflege der Diskussion – Community Management – nach außen delegieren, statt selbst Verantwortung zu übernehmen, was “innen” passiert.
Und so stellt sich mir die Frage: Wenn die Berichterstattung selbst diskriminierend ist, wie kann ein Medium dann erwarten, dass die Reaktionen darauf sachlich und respektvoll bleiben? Warum wird von Leser:innen Mäßigung erwartet, wenn sich die Medien selbst das Gegenteil erlauben?
Die Antwort dürfen wir heute Abend noch klarer erkennen als sonst: Die Verantwortung wird auf Ehrenamtliche abgeschoben. Das ist keine Problemlösung. Es ist eine Symptombehandlung.
Hass im Netz: Die Verantwortung der Medienhäuser
Medienhäuser bauen mit ihren Inhalten Communitys, oft ohne zu bedenken, welches Wertesystem sie erschaffen. Manche bedenken es, und entscheiden sich ganz bewusst dafür, weil es eine Politik stärkt, die sie und ihre Ausbeutung schützt. Stichwort: Dichand-Familie, die einen großen Teil der Krone besitzt und ein Vermögen von 850 Millionen Euro. In Österreich erreicht die Krone mehrere Millionen Menschen, und sie prägt das Bild unserer Gesellschaft. Auf diese Weise prägen Medien Meinungen, setzen Prioritäten, entscheiden, wessen Stimmen wir hören und wessen Sichtweisen als legitim gelten. Und wessen halt einfach nicht.
Was bedeutet es also für Menschen wie mich, die täglich im Rampenlicht stehen und diesen Hass spüren? Es bedeutet, dass Hass im Netz kein isoliertes Problem ist – es ist Ausdruck einer tieferen Schieflage, die sich durch Gesellschaft und Medienlandschaft zieht.
Der österreichische Journalismus leidet darunter, dass zu wenige marginalisierte Menschen in den Redaktionen sitzen und dass jene Perspektiven, die Diskriminierung besser kennen als ihnen lieb ist, in Führungspositionen einfach fehlen. Wer schaut dann drauf, wie man ein sicheres Umfeld für Betroffene schaffen kann – sei es im Betrieb oder in der Außenwirkung? Wenn es immer noch die Menschen sind, die diese Probleme nicht kennen oder spüren, die aber dann die Regeln gestalten.
Als Journalistin, FLINTA und Person mit Migrationsgeschichte will ich nicht nur diesen Hass bekämpfen. Ich will, dass die weißen cis Männer an der Spitze der Medienhäuser selbst Verantwortung übernehmen und den Weg freimachen für Perspektiven, die nicht nur von diesem Hass wissen, sondern ihn verstehen und bekämpfen können. Solange das nicht passiert, lastet die Arbeit für respektvollen Diskurs auf den Schultern Betroffener und Ehrenamtlicher – und das ist nicht fair. Es sind die Medien, die den Diskurs gestalten, und sie müssen für das Wertesystem, das sie aufbauen, Verantwortung übernehmen.
Ich wünsche mir eine Zukunft, in der Hass keinen Nährboden findet, weder in den Medien noch online. Eine Zukunft, in der Respekt und Verantwortung in der Berichterstattung selbstverständlich sind. In der nicht über Menschengruppen, sondern von Menschengruppen geschrieben wird. In dem Frauen, Flinta, BiPoCs die selben Chancen haben. Das ist der Weg zu einem digitalen Raum, in dem jede Stimme, unabhängig von Herkunft oder Identität, gehört werden kann – ohne Angst vor Hass im Netz.
Und bis dahin: Bitte lassen wir den Laptop gemeinsam aufgeklappt.
Diese Keynote ist im Rahmen der Pressekonferenz von ZARA – Zivilcourage & Anti-Rassismus-Arbeit gehalten worden, in der die Ergebnisse des Projekts web@ngels präsentiert wurden.