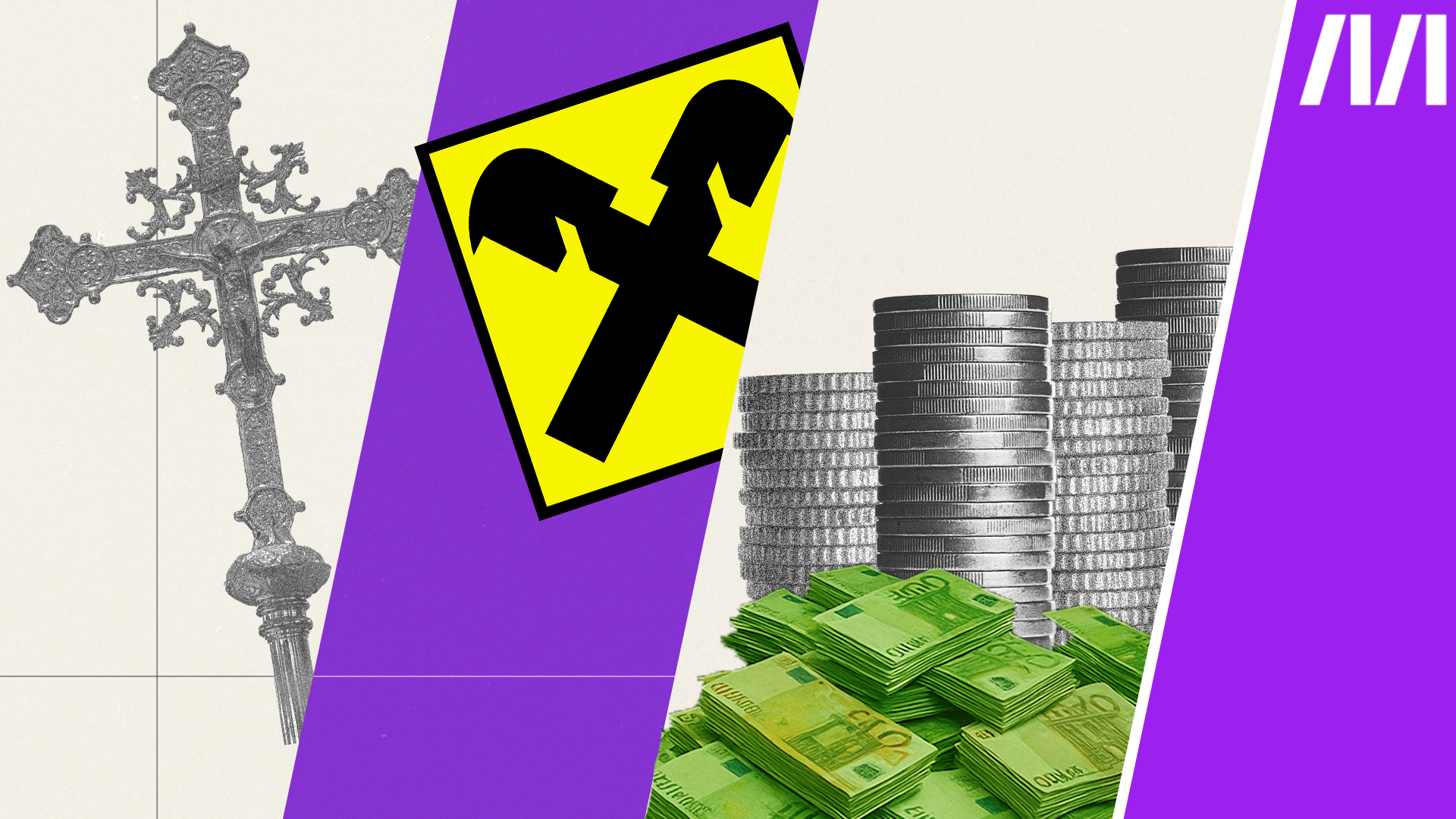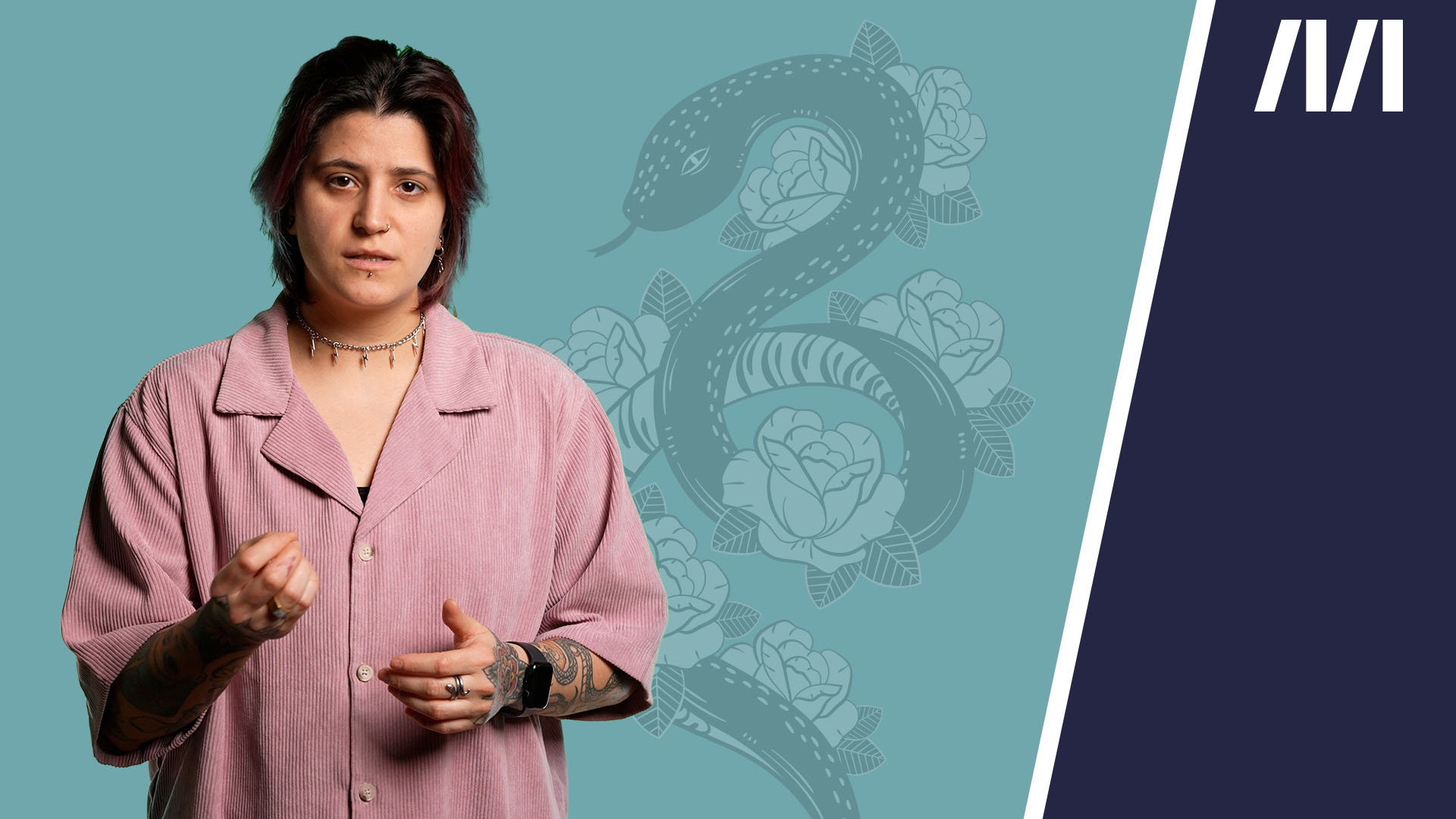Stephan Pühringer über Superreiche: “Völlig entkoppelt von der Lebensrealität aller anderen”
MOMENT.at: Ihr habt das Netzwerk der Superreichen untersucht. Von wie reich reden wir?
Stephan Pühringer: Von allen, die 500 Millionen Euro Vermögen oder mehr besitzen. Das sind 62 Personen, Familien und/oder Haushalte aus der Trend-Reichenliste.
MOMENT.at: Warum wolltet ihr das Netzwerk der Superreichen untersuchen? Warum braucht es eine solche Studie überhaupt?
Pühringer: Überreichtum ist aus dem Lot geraten – das war schon vorher klar. Sowohl in Österreich als auch international. Zum ersten Mal klaffen beide Enden der globalen Vermögensverteilung auseinander. Also die Zahl und das Vermögen an Milliardär:innen nimmt zu, aber auch absolute Armut.
Man weiß aber sehr wenig über Vermögen. Die Forschung muss sich auf Hochglanzmagazine wie Trend und Forbes stützen, weil es einfach keine Datenlage gibt.
Gerade dieser Vernetzungscharakter zwischen verschiedenen Überreichen und wie deren Reichtum über verschiedene Unternehmens- und Beteiligungskonstruktionen aufrechterhalten wird, ist ziemliches Neuland.
MOMENT.at: Du sagst, die Datenlage ist sehr dünn. Ist sie dünner als bei der ärmeren Bevölkerung?
Pühringer: Ja, absolut. Sozialleistungen werden genau kontrolliert. Es wird sehr genau geprüft, wie bedürftig Personen sind. Am obersten Ende der Vermögensverteilung haben wir im Vergleich sehr wenig Informationen.
Dazu muss man sagen, dass es nicht um die oberen zehn Prozent geht und auch nicht um das oberste Prozent. Tatsächlich geht es in einem globalen Maßstab um eine sehr kleine Gruppe von Personen. Global gesehen besitzen vier, fünf Personen so viel wie das ärmere Drittel der gesamten Weltbevölkerung.
In Österreich besitzen die reichsten Haushalte, auf die wir uns gestützt haben, so viel wie die untere Hälfte.
Wir wissen wesentlich mehr über alle anderen Bevölkerungsteile als über diese wenigen Superreichen in Österreich. Und gleichzeitig sind sie für die gesamte Verteilung äußerst relevant.
Hier wurden im Kapitalismus Rechtsrahmen geschaffen, die Superreiche begünstigen.
MOMENT.at: Die Studie zeigt, die Reichsten sind untereinander sehr gut vernetzt. Kannst du etwas genauer erzählen, wie diese Netzwerke aussehen?
Pühringer: Wir finden zunächst einmal heraus, dass es wirklich sehr enge Vernetzungen gibt innerhalb der Superreichen. Rund um die Familien, Haushalte, Individuen und teilweise auch zwischen ihnen.
Dabei sind die 62 Reichsten der Ausgangspunkt. Und dann schauen wir uns an, wo diese Leute sitzen. Wo haben sie Funktionen in Unternehmen? Wo sind sie in GmbHs, in AGs oder anderen Rechtsformen? Auch Privatstiftungen spielen eine zentrale Rolle. Wer sitzt wo im Vorstand, im Aufsichtsrat oder ist Geschäftsführer:in?
Das verfolgen wir dann zwei Ebenen weiter und spinnen dieses Netz. Da gibt es dann viele Verknüpfungen: Also strategische Partnerschaften, wo Leute dann gegenseitig im Aufsichtsrat oder Geschäftsführerin sind. Und wir sehen, dass sich fast alle diese Netzwerke sehr schnell verbinden.
Das heißt nicht, dass da eine große Verschwörung im Gange wäre. Es heißt, dass es nicht nur einzelne Personen sind, die besonders findig sind und nahe an der Illegalität handeln. Es ist ein strukturelles Verhältnis. Hier wurden im Kapitalismus Rechtsrahmen geschaffen, die Superreiche begünstigen.
MOMENT.at: Kannst du das genauer schildern?
Pühringer: In diesem Netzwerk sind Personen mit bis zu über 400 Verknüpfungen zu Firmen und anderen Rechtsformen wie Privatstiftungen. Zwölf Personen haben mehr als 100 Positionen in unterschiedlichen Unternehmen. Da geht sich teilweise nicht einmal ein Tag im Jahr in jedem Unternehmen aus. Man ist also ein sehr selten gesehener Gast in der eigenen Firma.
Das heißt, betriebswirtschaftlich und operativ ergibt das keinen Sinn. Natürlich kann es für größere Firmen in verschiedene Sektoren Sinn machen, mehrere GmbHs zu gründen, um ihre Geschäftstätigkeit besser zu strukturieren. Nicht aber in dem in unserer Studie teilweise beschriebenen Ausmaß. Dort wurden Immobilienprojekte in Dutzende kleine GmbHs mit den gleichen Akteur:innen unterteilt, die dann wieder komplex miteinander verwoben sind. Das dient nur dazu, Intransparenz zu schaffen. Das macht es den Steuerbehörden unglaublich schwierig, nachzuvollziehen, wo das Vermögen eigentlich liegt – vor allem, wenn etwas schief geht – oder wer überhaupt noch Haftungen besitzt.
Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung kann für beispielsweise einen Installationsbetrieb durchaus sinnvoll sein. Damit beispielsweise bei einem Rohrbruch die einzelne Person nicht mit ihrem Privatvermögen haftet. Es ist aber natürlich nicht Sinn dieser Rechtsform für kleine Unternehmen, sie einfach 100-fach anzuwenden und dann miteinander zu verknüpfen. So wird nur der Haftungsrahmen extrem limitiert, wie man auch bei Benko und Signa gesehen hat. Dennoch ist damit die Struktur geschaffen, um Verluste und Gewinne hin und her zu schieben. Dorthin, wo es steuerlich optimal ist.
Rund um diese Gruppe ist dann eine Industrie von Vermögensverwaltungs-Kanzleien und Rechtsanwält:innen entstanden, die sich nur auf diese überreichen Personen fokussieren und alle Rechtsrahmen nutzen. Und vielleicht sogar mitgestalten, dank politischer Nähe.
Spannend war auch, dass Superreiche selbst in ihren Netzwerken teilweise kaum vorkommen. Rene Benko ist beispielsweise der kleinste Punkt in seinem Netzwerk. Doch es gibt in diesem Netzwerk viele Leute, die gewisse Funktionen erfüllen, wie Vermögensanwälte. Außerdem sind diese Netzwerke extrem männlich.
MOMENT.at: Diese Netzwerke spannen sich bis in Politik und Medienlandschaft …
Pühringer: Wir haben auch Personen berücksichtigt, die entweder politische Ämter innehaben oder führende Positionen in Unternehmen im Staatseigentum, sowie deren Familienmitglieder. Auch ehemalige politisch exponierte Personen haben wir berücksichtigt, um den Drehtüreffekt von Politik und Wirtschaft besser nachzeichnen zu können.
In vielen dieser Netzwerke kommen auch viele politisch exponierte Personen vor. Damit beweist die Studie nicht, dass es Einflussnahme gibt. Das System bietet aber natürlich viele Möglichkeiten. Und an konkreten Beispielen wie Rene Benko oder Stefan Pierer sehen wir, dass es diese politische Einflussnahme über Parteispenden oder Zweckpartnerschaften gibt.
Auch kommen Politiker:innen nach ihrer politischen Laufbahn oft in diese Unternehmen und bringen noch politische Netzwerke mit. Und dann wird es natürlich zu einem Demokratieproblem. Wenn sich ökonomische Macht in politische Macht und soziale Grenzziehungen übersetzen kann.
MOMENT.at: Sind dadurch die Interessen von Superreichen in Österreichs Politik überrepräsentiert?
Pühringer: Dieser Schluss wäre nicht sehr gewagt. Privatstiftungen sind wahrscheinlich das beste Beispiel. Privatstiftungen sind für 99,9 Prozent der Bevölkerung in Österreich nicht relevant. Es ist eine Rechtsform, die einigen Wenigen riesengroße Möglichkeiten bietet.
Absolute Parallelwelt, die sich völlig entkoppelt hat von der Lebensrealität aller anderen – die aber stark beeinflusst, wie wir Politik und Gesellschaft gestalten.
MOMENT.at: Privatstiftungen waren auch ein großes Thema in eurer Untersuchung. Welche Ergebnisse lieferte die Netzwerkanalyse noch?
Pühringer: Es hat sich gezeigt, dass Privatstiftungen eine zentrale Rolle spielen. In Österreich gibt es rund 3.000 Privatstiftungen. Etwa 50 Prozent davon kommen in diesem erweiterten Netzwerk der 62 Haushalte vor. Der private Stiftungsverband sagt selbst, dass eine Privatstiftung ab 30 Millionen Euro Sinn macht. Mit so viel Vermögen ist man in Österreich bereits am äußersten Ende der Vermögensverteilung.
Ein weiteres Ergebnis ist, dass sehr viele Unternehmen im Immobilienbereich tätig sind. Bei Rene Benko ist das bekannt. Doch das sieht man quer durch alle superreichen Haushalte, dass Immobilienbesitz ein zentraler Punkt ist.
MOMENT.at: Wofür genau macht eine solche Privatstiftung ab 30 Millionen Euro denn Sinn?
Pühringer: Einerseits bieten Privatstiftungen die Möglichkeit, steuerliche Vorteile zu ziehen. Zunächst sind sie aber einfach eine Möglichkeit, Überreichtum zu sichern – vor Krisen wie dem Platzen einer Immobilienblase oder Spekulationsgeschäften. Das hat man eben bei Rene Benko gesehen. Im Moment platzen einige dieser Netzwerke auf und die Privatstiftung ermöglicht es, den eigenen Lebensstil beizubehalten. Das steht teilweise auch so im Stiftungszweck: “Die ökonomische Entwicklung und Absicherung von Familie X.”
Es besteht offenbar auch kein großes Interesse, sich diese Privatstiftungen genauer anzuschauen. Wie wir im COFAG-Untersuchungsausschuss gesehen haben, wurden drei Viertel aller Privatstiftungen noch nie kontrolliert.
MOMENT.at: Wie überraschend waren eure Ergebnisse für dich?
Pühringer: Dass es diese Vernetzungen gibt, dass es in Österreich Privatstiftungen gibt, dass Immobilienbesitz bei superreichen Personen eine wichtige Rolle spielt, dass politisch exponierte Personen in den Netzwerken vorkommen – das war alles nicht unbedingt neu oder überraschend. Dass das alles in dieser drastischen Form stattfindet, das war dann doch sehr überraschend.
Dass es Personen gibt, die über 400 Positionen in Unternehmen haben. Dass die Netzwerke so dicht miteinander verwoben sind. Dass Privatstiftungen quasi ausschließlich von ganz wenigen Personen genutzt werden. Diese Personen, die quer über das Netzwerk als Vernetzungs-Agent:innen von Superreichen agieren. Dass es einen Vermögensanwalt gibt, der im Vorstand von 50 Privatstiftungen sitzt, natürlich den Rechtsrahmen sehr gut kennt und den Steuerbehörden immer ein, zwei Schritte voraus ist. Das war für uns sehr überraschend.
Wir haben es auch als “merkwürdige Welt der Superreichen” beschrieben. Das hat nämlich nichts mehr damit zu tun, dass diese Menschen ein größeres Haus, ein größeres Auto oder ein dickeres Sparbuch haben. Es ist eine absolute Parallelwelt, die sich völlig entkoppelt hat von der Lebensrealität aller anderen – die aber stark beeinflusst, wie wir Politik und Gesellschaft gestalten. Und das ist natürlich gesellschaftspolitisch und ökologisch durchaus relevant.
MOMENT.at: Was sollten uns diese Erkenntnisse nun sagen? Was sollten wir deiner Meinung nach damit anstellen?
Pühringer: Der erste Aspekt ist, Transparenz zu schaffen. Dafür brauchen wir auch mehr Daten. Dabei wäre eine Vermögenssteuer hilfreich – selbst, wenn sie null Prozent betragen würde.
Man muss sich aber auch fragen: Wie wollen wir in Zukunft leben? Und wollen wir eine so starke Konzentration von ökonomischer Macht haben? Auch, weil es nicht bei ökonomischer Macht bleibt, sondern daraus auch politische Macht entsteht.
Es braucht also einerseits die Daten, andererseits eine Steuerbehörde, die auch reinschauen will. Der COFAG-Ausschuss hat wiederum gezeigt, dass es durchaus Möglichkeiten und Einflussnahmen gegeben hat, um genau das zu verhindern. Eine Idee wäre zum Beispiel, die “Taskforce Superreiche” wieder einzusetzen, wo man diese besondere Gruppe von überreichen Personen besonders ins Zentrum nimmt.
MOMENT.at: Du hast die Vermögenssteuer erwähnt. Umfragen zeigen, dass der Großteil der Bevölkerung für eine Vermögenssteuer wäre, dennoch wird sie nicht umgesetzt. Führst du das auch auf diese Netzwerke und den Einfluss der Überreichen zurück?
Pühringer: Man muss aufpassen, nicht zu sehr in eine Verschwörungstheorie zu verfallen. Es ist nicht so, dass da in irgendwelchen Hinterzimmern einzelne Personen diese Dinge steuern. Was man aber durchaus sieht, ist, dass die Medienlandschaft in Österreich extrem konzentriert ist. Eine der überreichen Familien ist die Familie Dichand und in deren Netzwerk sieht man eine extreme Häufung an verschiedensten Medienunternehmen.
Eine Blattlinie kann natürlich durch die Eigentümer:innen geprägt werden. Sowohl direkt als auch indirekt. Dann wird vielleicht nicht so gern kritisch über Vermögenssteuern gesprochen. Dadurch wird auch Einfluss auf die öffentliche Meinung genommen.
Außerdem ist ein Problem, welche Bilder und Narrative vermittelt werden. Kolleg:innen haben sich das in unterschiedlichen Studien angesehen und oft wird vermittelt, dass uns das Haus weggenommen wird oder eine große Erbschafts- oder Vermögensteuer kleine und mittelständische Unternehmen in den Ruin treibt. Das kann man natürlich mit Freibeträgen lösen und das tun viele oder alle Modelle auch.
Reichtum wird auch oft auf Leistung zurückgeführt, was sehr schnell entkräftet werden kann. Ein sehr großer Anteil der überreichen Familien hat das über einen sehr langen Zeitraum vererbt. Das Vermögen ist sehr stark konzentriert und hat nur sehr wenig mit einem operativen Geschick zu tun. Es wird ganz klar einfach weitergegeben.
Dazu kommt: In Österreich gilt es immer noch als Kavaliersdelikt, wenn es sich jemand besonders geschickt gerichtet hat und Steuerbehörden ausgetrickst hat. Obwohl das unglaubliche, gesellschaftliche Auswirkungen hat. Und auch bei Krisen wie den Banken oder Pierer (KTM-Pleite, Anm. d. Red.) sieht man, dass in letzter Konsequenz dann wieder die Öffentlichkeit einspringt. Bei einer sehr starken Individualisierung von Gewinnen werden dann Verluste doch wieder sozialisiert.
Diese Bilder zu ändern ist ein langfristiger Prozess, aber er ist absolut nötig. Man sieht aber immer wieder, dass wir daran scheitern – auch durch politischen Unwillen.
MOMENT.at: Wenn wir “Überreichtum” sagen, schwingt auch mit, dass es zu viel ist, dass es drüber ist. Müssen wir auch über eine Obergrenze sprechen?
Pühringer: Auf jeden Fall. Unsere und andere Studien zeigen, dass Überreichtum völlig aus dem Lot geraten ist. Diese extremen Relationen vor Augen zu haben, wird meiner Meinung nach helfen: Das Vermögen der rund 50 reichsten Familien entspricht in etwa 40 Prozent der Wirtschaftsleistung Österreichs in einem Jahr.
Wenn wir uns fragen, wie wir die Gesellschaft der Zukunft gestalten wollen, geht es maßgeblich um die Frage, wo diese Grenzen sind. Was ist für eine Gesellschaft noch akzeptabel und was nicht? Wir sind schon lange über eine gerechte und sozial verträgliche Konzentration an Vermögen hinausgeschossen. Und der Trend geht noch weiter.
International kann man nun auch sehen, wie einzelne Personen sich quasi Länder und deren Politik kaufen oder extremen Einfluss darauf nehmen können. Wenn man sich Twitter kauft und damit quasi die öffentliche Meinung ganz gezielt steuern kann; wenn man über Projekte wie Starlink die Infrastruktur des Internets absichert; wenn Überreiche solche Funktionen übernehmen, dann ist es demokratiepolitisch ein Riesenproblem und dann muss man absolut über eine Obergrenze sprechen.
Wo die Grenze verläuft, das muss Teil einer Debatte sein. Das wird nicht aus einer Studie kommen. Aber darüber zu sprechen, was noch akzeptabel ist und was nicht, halte ich für notwendig.
Ich bin mir sicher, dass die Art und Weise, wie das jetzt auseinanderklafft, für niemanden nachvollziehbar und akzeptabel ist. Das hat nichts mehr mit Leistung oder einer tollen Idee oder mit unternehmerischem Risiko zu tun. Das ist einfach völlig aus dem Lot geraten. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz zentraler Punkt, über den es zu sprechen gilt – national und natürlich auch international.
Zur Person: Stephan Pühringer ist Sozioökonom, stellvertretender Leiter des Instituts für die Gesamtanalyse der Wirtschaft (ICAE) und Leiter des Socio-Ecological Transformation Labs am Linz Institute for Transformative Change (LIFT_C) an der Johannes Kepler Universität Linz. Gemeinsam mit Kolleg:innen hat er im Auftrag der Arbeiterkammer das Netzwerk der Superreichen untersucht.